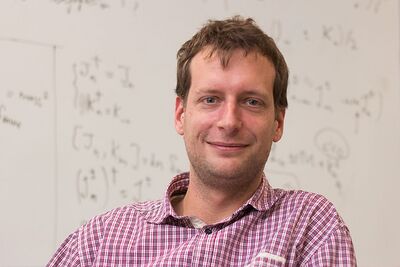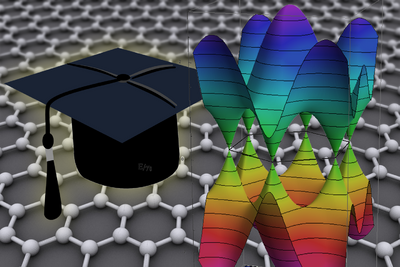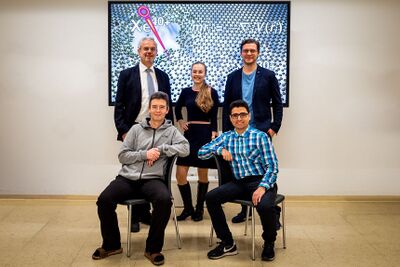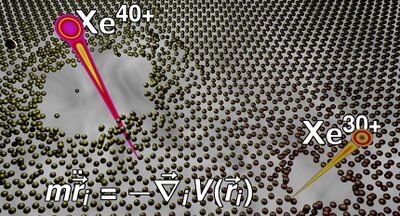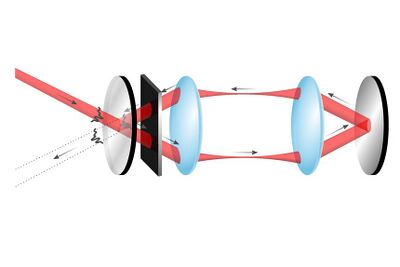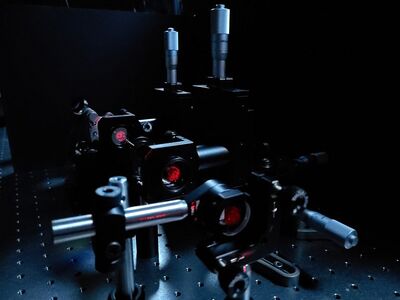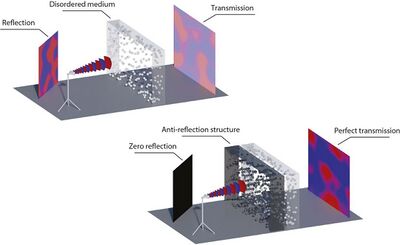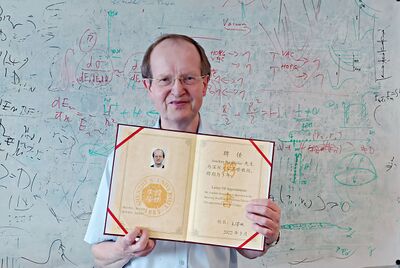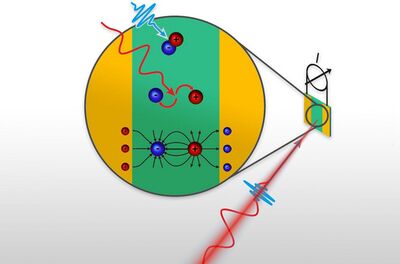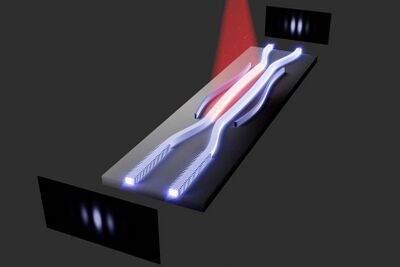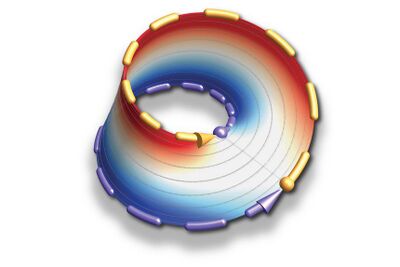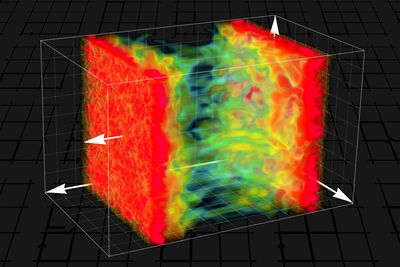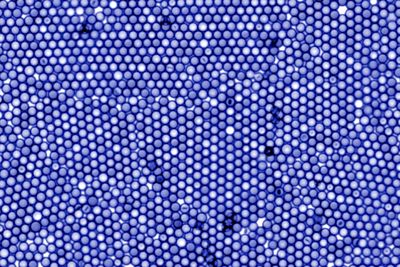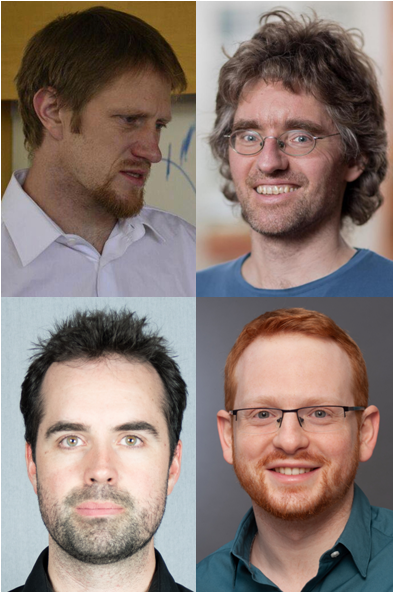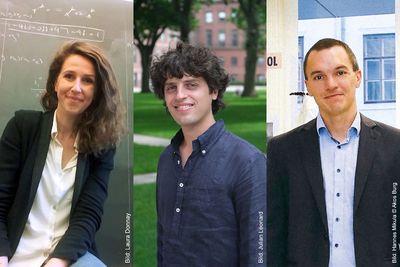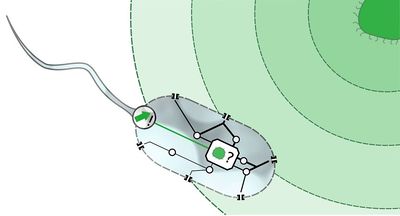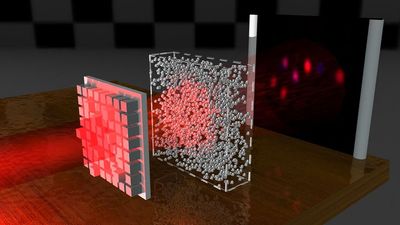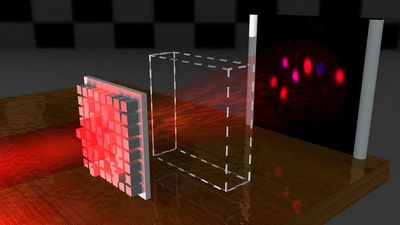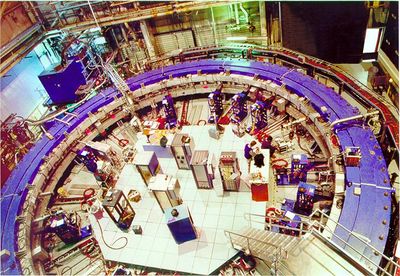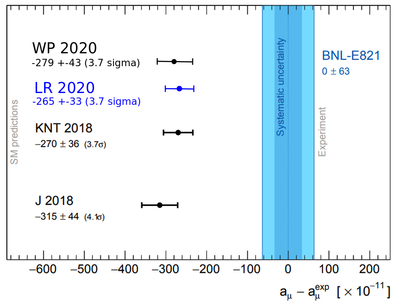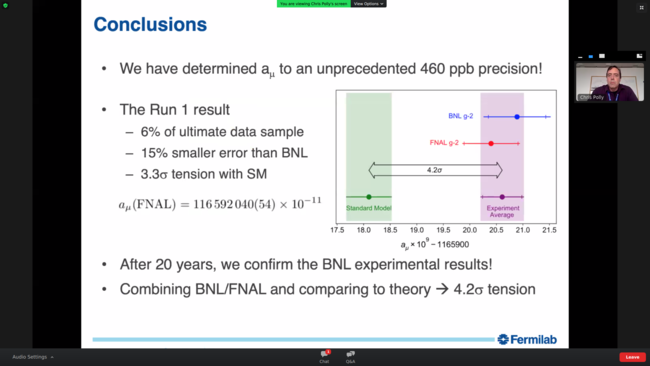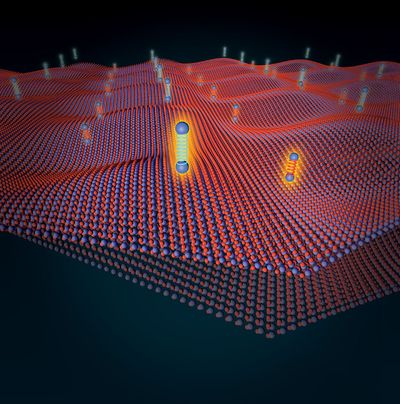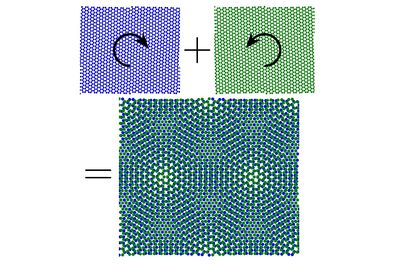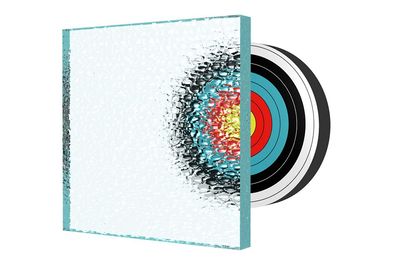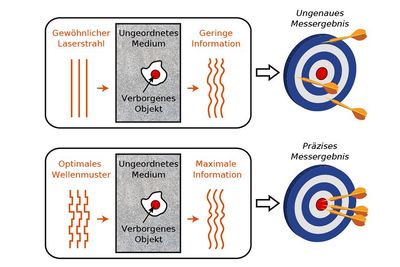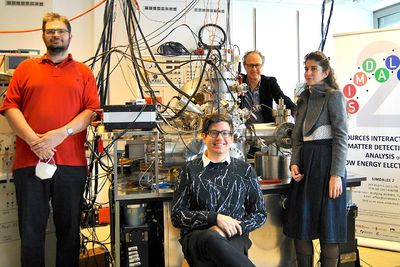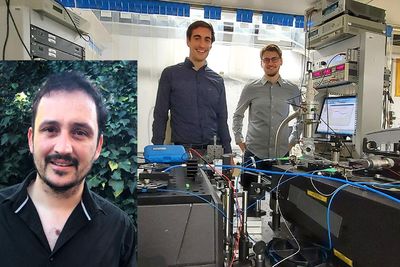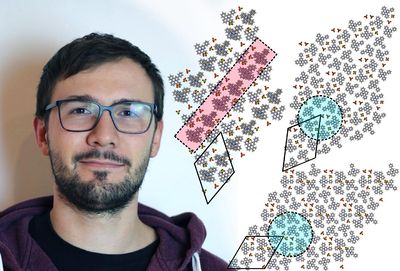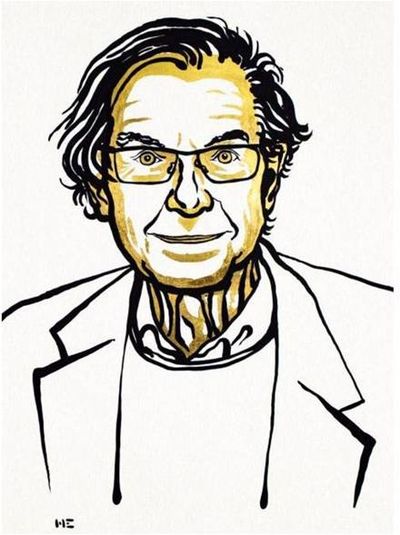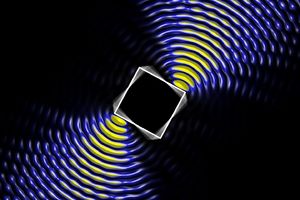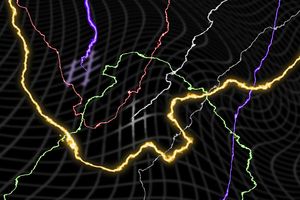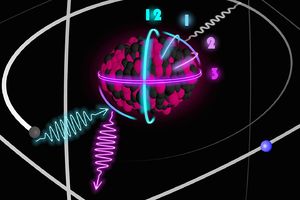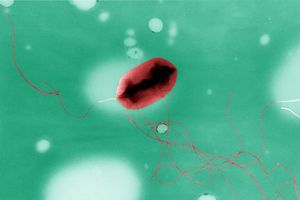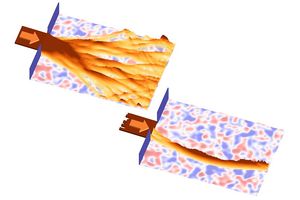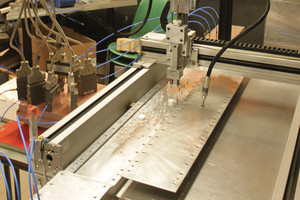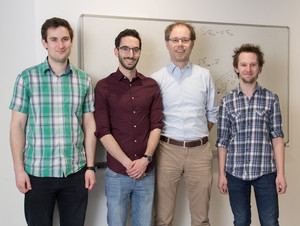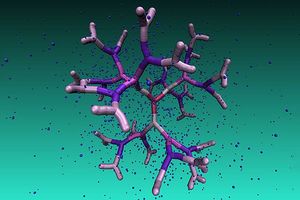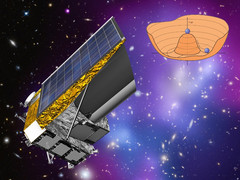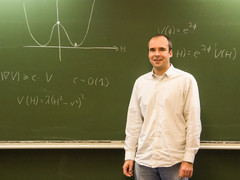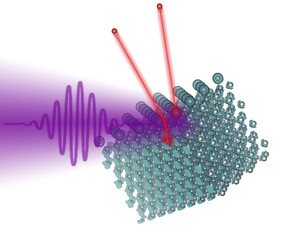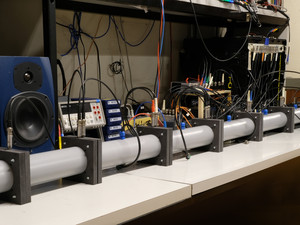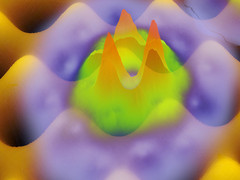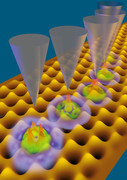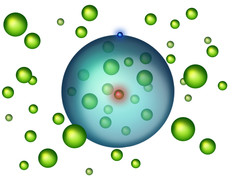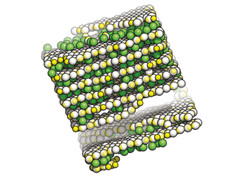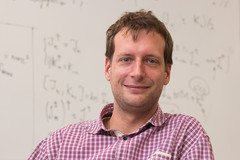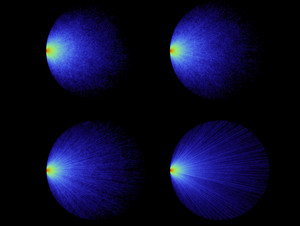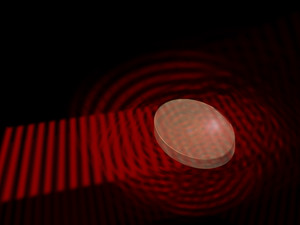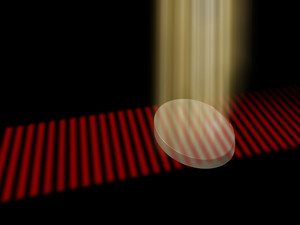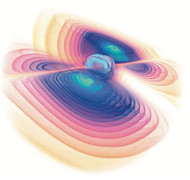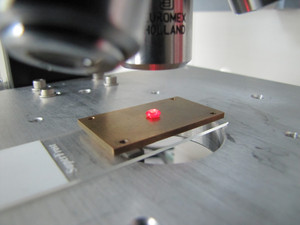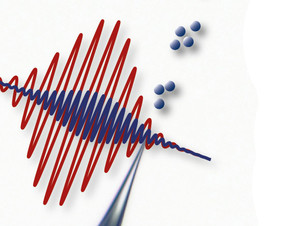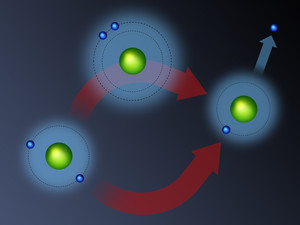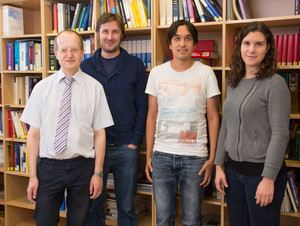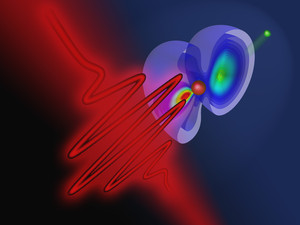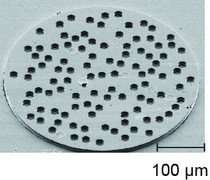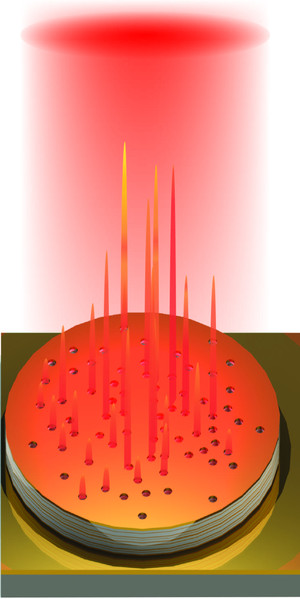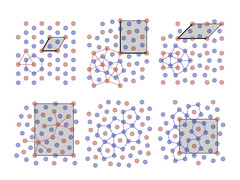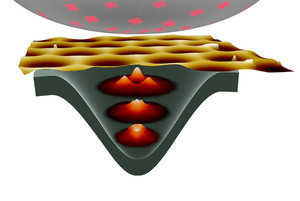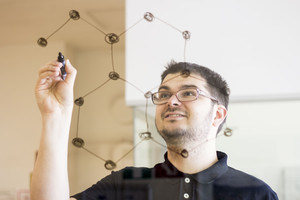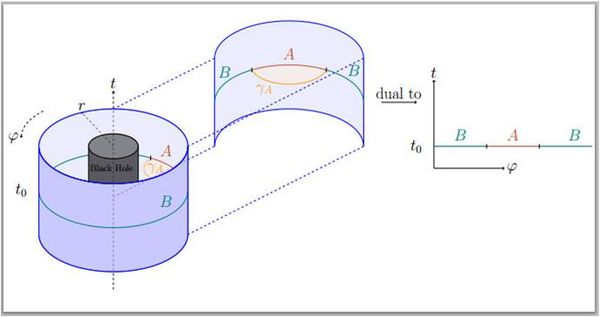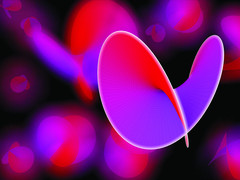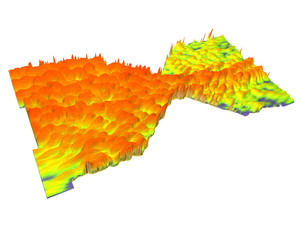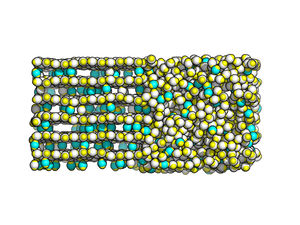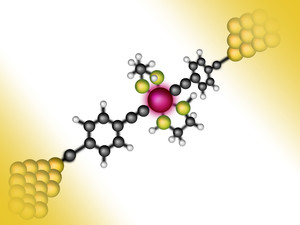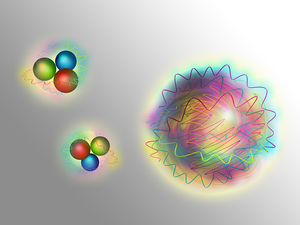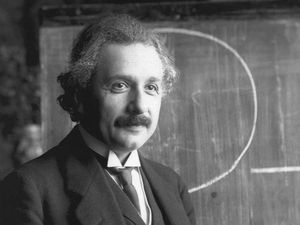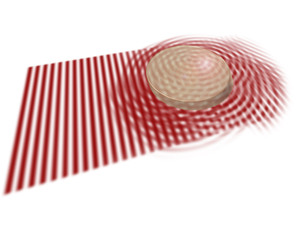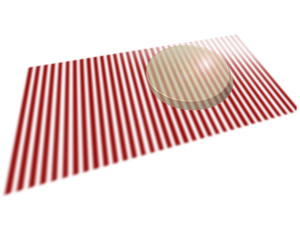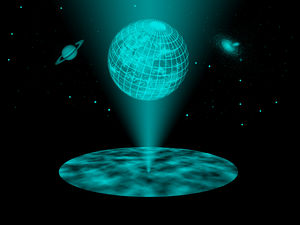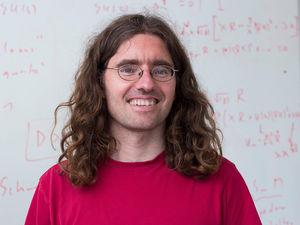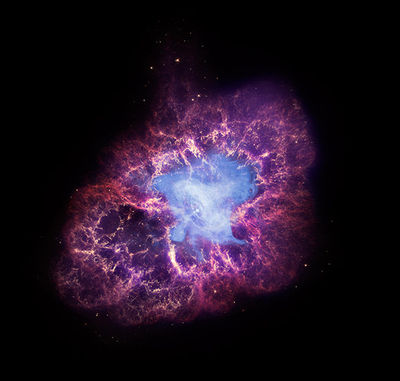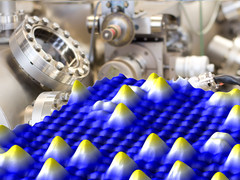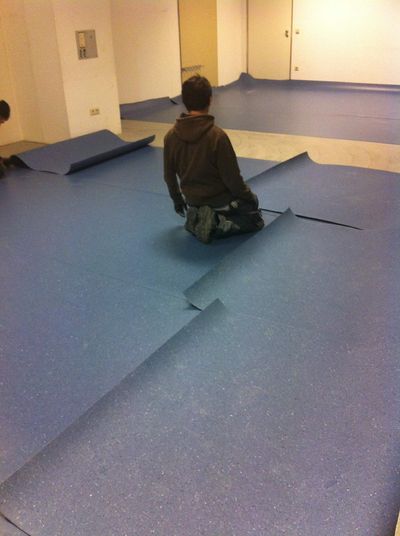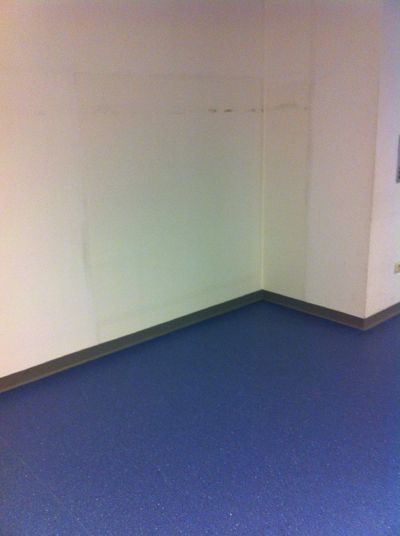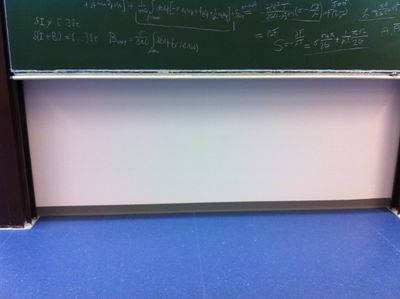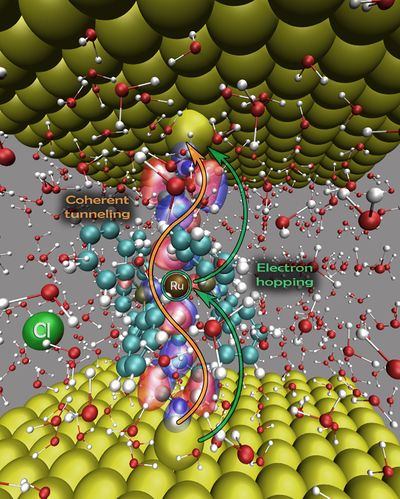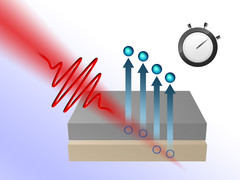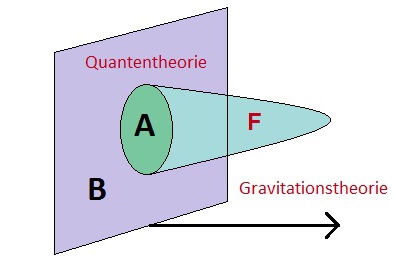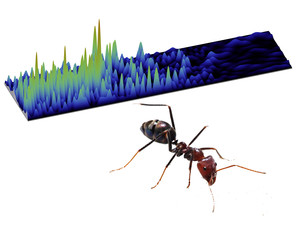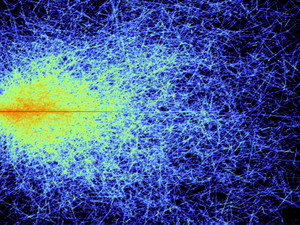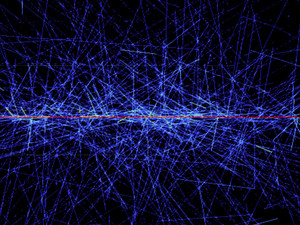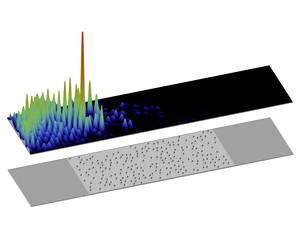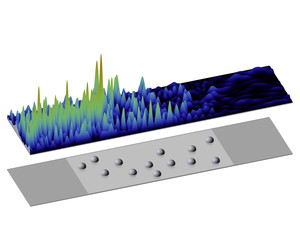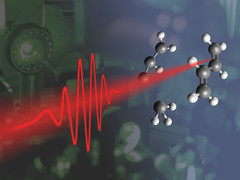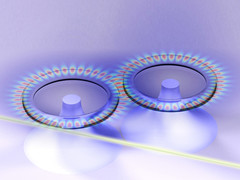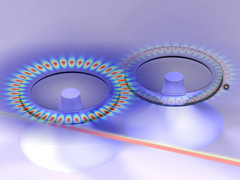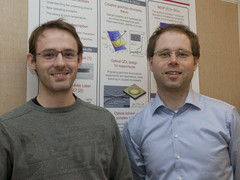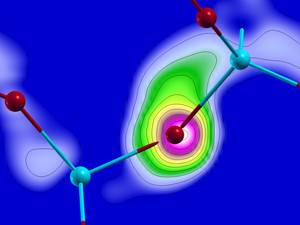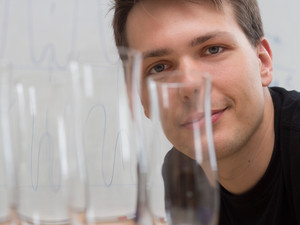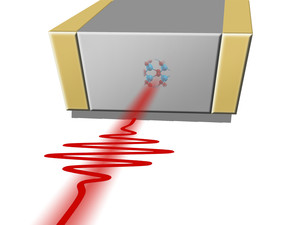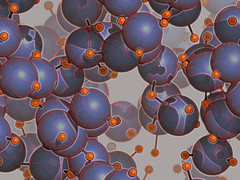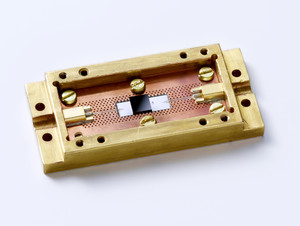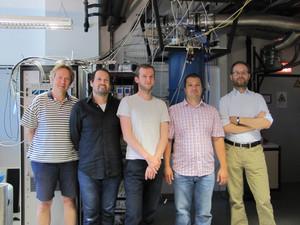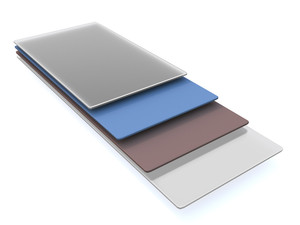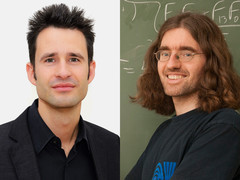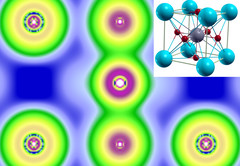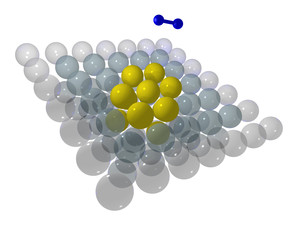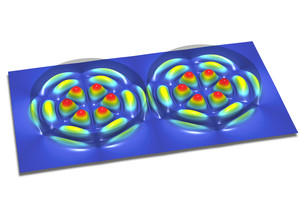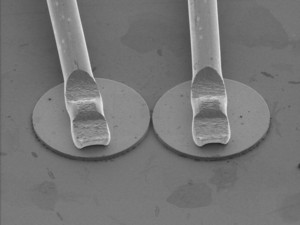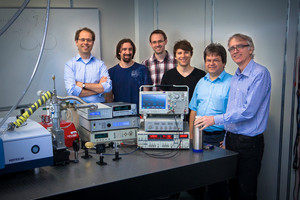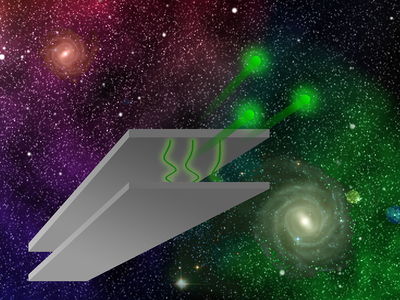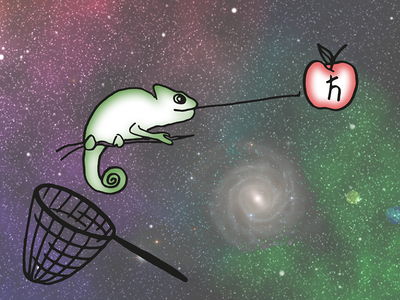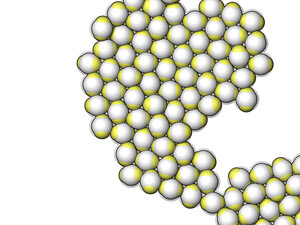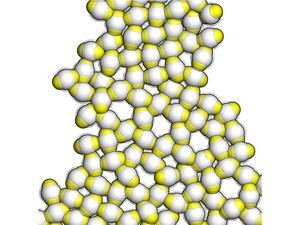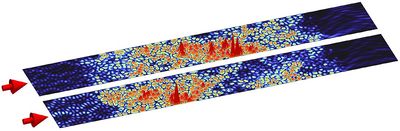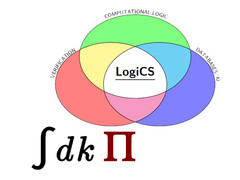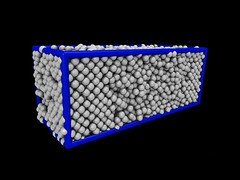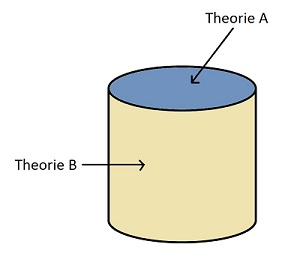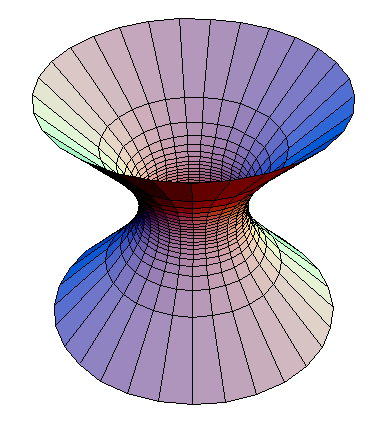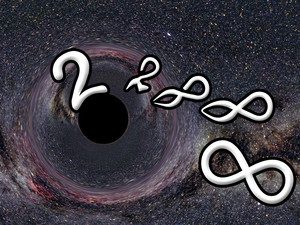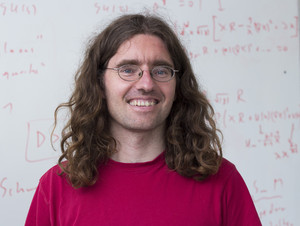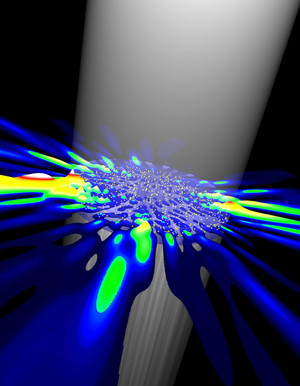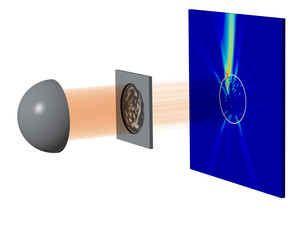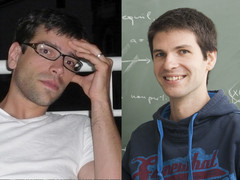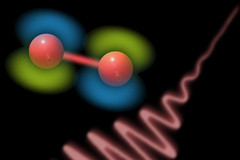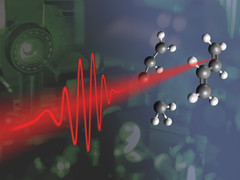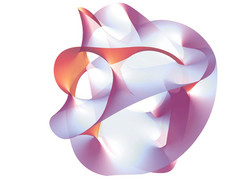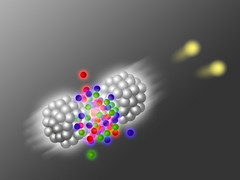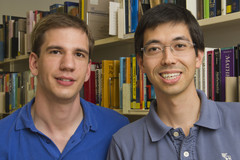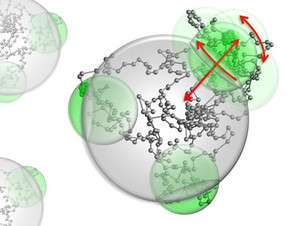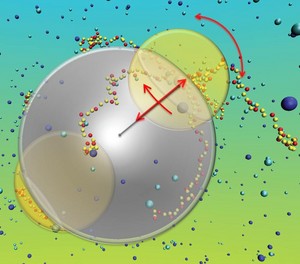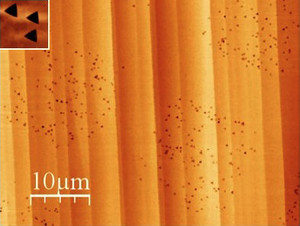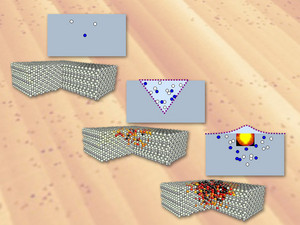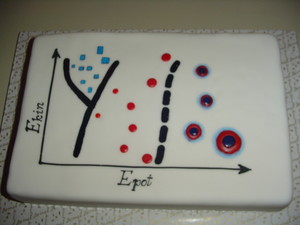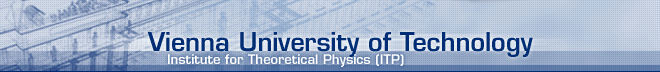
News
„Unlösbar“ ist keine Ausrede
Mit einem ESPRIT-Stipendium des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF entwickelt Tobias Schäfer neue Rechenmethoden, um bisher unlösbare quantenphysikalische Probleme in der computergestützten Materialphysik zu lösen.
Tobias Schäfer
Fast hundert Jahre alt ist die Schrödingergleichung, die berühmte Grundgleichung der Quantentheorie, die Erwin Schrödinger im Jahr 1926 erstmals publizierte. Mit dieser Gleichung gelang es erstmals, die Eigenschaften eines Wasserstoffatoms exakt zu erklären, in unzähligen Anwendungen hat sie sich seither glänzend bewährt.
Aber die Schrödingergleichung hat ein großes Problem: Wenn viele Teilchen gleichzeitig im Spiel sind, wird sie äußerst kompliziert und kann selbst mit den besten Supercomputern der Welt nicht exakt gelöst werden. Und das ist schade – denn gerade mit solchen Vielteilchen-Aufgaben hat man es in der Materialphysik besonders oft zu tun: Wie präzise lassen sich Materialeigenschaften berechnen? Was passiert an der Oberfläche eines Katalysators auf atomarer Ebene? Wie stark reduzieren gewisse Materialoberflächen die energetischen Barrieren für die Herstellung von solaren Brennstoffen?
Hochdotierte Förderung für Tobias Schäfer
Tobias Schäfer arbeitet als Postdoc am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Er befasst sich mit neuartigen Rechenmethoden, mit denen man quantenphysikalische Fragen beantworten kann, die bei bloßer naiver Anwendung der Schrödingergleichung völlig unlösbar wären. Dafür erhielt er nun ein ESPRIT-Stipendium des FWF, dotiert mit fast € 300.000.
Das ESPRIT-Programm des FWF hat das Ziel, junge Wissenschaftler_innen in einer frühen Phase ihrer Forschungskarriere zu unterstützen – der Abschluss der Dissertation darf nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Mit dem ESPRIT-Stipendium soll es möglich werden, ein eigenständiges Forschungsprofil zu entwickeln und eine international erfolgreiche Laufbahn zu starten.
Nicht exakt – aber fast
Tobias Schäfer wird sich in seinem Forschungsprojekt in den nächsten drei Jahren mit verschiedenen Rechenverfahren für Quanten-Vielteilchensysteme befassen.
Eine der wichtigsten Methoden in der Materialforschung ist die Dichtefunktionaltheorie – eine führende Rolle bei der Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie spielte der Physiker Walter Kohn, der 1998 dafür mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. In der Praxis wird dabei die komplizierte Schrödingergleichung durch eine mathematisch viel simplere Gleichung ersetzt. Bestimmte Eigenschaften von Vielteilchen-Systemen lassen sich damit gut berechnen. Wenn aber die Korrelationen der vielen Elektronen die Materialeigenschaften mitbestimmen, verliert die Dichtefunktionaltheorie rasch an Genauigkeit. Man braucht dann andere Methoden – ein besonders vielversprechender Kandidat dafür ist die „Coupled-Cluster-Methode“, mit der man das quantenphysikalisch hochkomplexe Zusammenspiel mehrerer Teilchen sehr präzise erfassen kann.
„Man bekommt dadurch streng genommen zwar nicht die exakte Lösung, aber eine Näherung, welche die Anforderungen von wissenschaftlicher und auch industrieller Forschung deutlich besser erfüllt.“, sagt Tobias Schäfer. „Wir entwickeln einen neuen Ansatz, um die Rechenkosten massiv zu reduzieren und dadurch den Anwendungsbereich der Coupled-Cluster-Methode deutlich auszuweiten sodass drängende Fragen mit dieser Methode beantwortet werden können.“
Das FWF-ESPRIT-Projekt „Coupled Cluster Berechnungen für große Simulationszellen“ startet offiziell am 01.04.2023 und ist auf eine Gesamtdauer von 3 Jahren ausgelegt.
Rückfragen:
Dr. Tobias Schäfer
Institut für Theoretische Physik
TU Wien
tobias.schaefer@tuwien.ac.at
Die Bewegungs-Einfrier-Maschine
Mit maßgeschneiderten Laser-Lichtfeldern kann man die Bewegung mehrerer Teilchen verlangsamen und diese damit auf extrem tiefe Temperaturen abkühlen – das zeigt ein Team der TU Wien.
Licht wird durch spezielle Masken geschickt und erreicht die Atome dann in der passenden Wellenform, sodass sie abgebremst werden.
Laser zu verwenden, um Atome abzubremsen, ist eine Technik, die schon lange verwendet wird: Wenn man Tieftemperatur-Weltrekorde im Bereich des absoluten Temperatur-Nullpunkts erzielen möchte, greift man auf Laser-Kühlung zurück, bei der den Atomen mit einem passenden Laserstrahl Energie entzogen wird.
Seit Kurzem werden solchen Techniken auch auf kleine Teilchen im Nano- und Mikrometer-Bereich angewandt. Bei einzelnen Teilchen funktioniert das bereits recht gut – wenn man allerdings mehrere Teilchen gleichzeitig kühlen möchte, stellt sich das Problem als viel schwieriger heraus. Prof. Stefan Rotter und sein Team am Institut für Theoretische Physik der TU Wien haben nun eine Methode vorgestellt, mit der man auch in diesem Fall eine extrem effektive Kühlung erreichen kann.
Nicht nur ein Strahl, sondern ein ganzes Lichtmuster
„In der Laser-Kühlung von Atomen verwendet man nur einen ganz gewöhnlichen Laserstrahl. Für die Kühlung von Nano-Teilchen funktioniert dieser Ansatz jedoch nicht. Unser Trick besteht nun darin, die räumliche Struktur des Laserstrahls kontinuierlich an die Teilchenbewegung so anzupassen, dass zu jedem Zeitpunkt eine optimale Abkühlung erfolgt“, sagt Stefan Rotter. „Mit der Methode, die wir entwickelt haben, kann man sehr schnell berechnen wie dieses Lichtmuster aussehen muss. Während die Teilchen ihre Position verändern, passt man das Lichtmuster laufend an und kann die Teilchen somit kontinuierlich abbremsen“, ergänzt Jakob Hüpfl, der im Rahmen seiner Doktorarbeit an diesem Thema forscht.
Interessanterweise muss man zur Anwendung der neuen Methode nicht wissen, wo sich die Teilchen genau befinden – man muss nicht einmal wissen, um wie viele Teilchen es sich handelt und wie sie sich bewegen. Man sendet einfach nur Licht durch das System und misst, wie dieses Licht durch die Teilchen verändert wird. Daraus wird das optimale Lichtmuster ermittelt, mit dem die Teilchen im nächsten Augenblick bestrahlt werden müssen, um sie noch ein Stückchen weiter abzubremsen – bis ihre Bewegung schließlich „einfriert“. Bisher handelt es sich nur um eine theoretische Arbeit, aber Experimente dazu sind bereits in Planung.
Die Methode wurde nun in den Fachjournalen „Physical Review Letters“ und „Physical Review A“ präsentiert – hervorgehoben durch eine „Editors‘ Suggestion“ und durch einer Besprechung im Journal „Physics“ der American Physical Society: https://physics.aps.org/articles/v16/s30
Die beiden Originalpaper
Hüpfl et al., Optimal Cooling of Multiple Levitated Particles through Far-Field Wavefront Shaping (2023).
Physical Review Letters: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.083203
Physical Review A: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.107.023112
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
TU Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
ERC-Grant für Andreas Grüneis
Neue Methoden, mit denen man die Eigenschaften von Materialien berechnen kann, entwickelt Prof. Andreas Grüneis von der TU Wien. Dafür erhält er nun einen ERC Consolidator Grant.
Andreas Grüneis
Man kann nicht immer perfekte Lösungen finden. Viele physikalische Fragen sind so kompliziert, dass es völlig aussichtlos ist, nach einem absolut korrekten Ergebnis zu suchen. Ganz besonders häufig trifft das in der Materialforschung zu: Will man die Eigenschaften neuer Materialien mit quantenphysikalischen Formeln berechnen, stößt man rasch an die Grenzen des Möglichen. Dann braucht man ausgeklügelte Näherungsmethoden, um der Wahrheit zumindest möglichst nahe zu kommen.
An solchen Methoden forscht Prof. Andreas Grüneis mit seinem Team am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Nun wurde er mit einem ERC Consolidator Grant ausgezeichnet, dotiert mit 2 Millionen Euro – einer der höchstdotierten und prestigeträchtigsten Förderungen der europäischen Forschungslandschaft. Für Andreas Grüneis ist es bereits der zweite ERC-Grant: Schon 2016 erhielt er einen ERC Starting Grant, damals noch als Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart.
Zwischen klein und groß
Das wirklich Komplizierte ist das Mittelgroße: Man weiß heute sehr genau, wie man das Verhalten eines Systems berechnet, das nur aus ein oder zwei Teilchen besteht – die Quantentheorie liefert hier exzellente Ergebnisse. Man weiß auch, wie man das Verhalten eines Systems berechnet, das aus Trillionen Teilchen besteht – da kann man Details oft getrost ignorieren und exakte Durchschnittswerte berechnen.
Aber was ist, wenn man sich dazwischen befindet? Wenn man Effekte erklären will, an denen zehn, hundert, oder vielleicht tausend Teilchen beteiligt sind? Für diesen Bereich hat man bis heute keine perfekten Methoden. Die Formeln der Quantentheorie, etwa die berühmte Schrödingergleichung, werden in diesem Fall derart kompliziert, dass selbst die größten Supercomputer der Welt keine Lösung mehr finden können. Gleichzeitig ist man aber noch nicht in einem Bereich angelangt, in dem man die Besonderheiten der Quantentheorie vernachlässigen kann.
Genau in diesem Spannungsfeld bewegt man sich oft, wenn man chemische oder physikalische Eigenschaften von Materialien berechnen möchte. Solche Eigenschaften werden vom quantenphysikalischen Zusammenspiel vieler Teilchen bestimmt, für das man Näherungslösungen finden muss.
„Es gibt in diesem Bereich verschiedene nützliche Ansätze“, sagt Prof. Andreas Grüneis. „Etwa die Dichtefunktionaltheorie, bei der man die komplizierte Schrödingergleichung durch eine viel einfachere Gleichung ersetzt.“ Freilich erkauft man sich solche Vereinfachungen immer durch geringere Genauigkeit und den Verzicht auf Allgemeingültigkeit – für manchen Fragen findet man mit solchen Methoden sehr gute Antworten, für andere hingegen sind sie nicht geeignet.
Kristalle und Planeten
„Wir bauen auf bestehenden Methoden auf, verknüpfen sie und entwickeln dadurch neue Rechenverfahren, mit denen man dann wichtige Fragen aus der Materialforschung beantworten kann“, erklärt Andreas Grüneis. Dabei geht es etwa um die Frage, wie bestimmte Materialien Licht absorbieren oder welche Schwingungen sich in den Materialien ergeben. Im ERC-Projekt wird Andreas Grüneis mit seinem Team etwa die elektronischen Eigenschaften von Kristallen untersuchen, in die man einzelne Thorium-Atome einbaut. Damit könnte man möglicherweise Uhren bauen, mit denen man die Genauigkeit heutiger Atomuhren in den Schatten stellen könnte.
Auch auf sogenannte 2D-Materialien sollen die neuen Methoden angewandt werden – also auf Materialien, die aus atomar dünnen Schichten bestehen, und deshalb ganz spezielle Materialeigenschaften aufweisen. Und sogar in die Physik fremder Planeten soll ein neuer Einblick gewonnen werden: Bei extrem hohem Druck, etwa im Zentrum des Planeten Jupiter, kann Wasserstoff metallische Eigenschaften annehmen. Wie und wann das genau passiert, gilt seit Jahrzehnten als ungelöste Frage. Mit neuen Rechenmethoden soll sie sich beantworten lassen.
Wien, Cambridge, Stuttgart, Wien
Andreas Grüneis studierte an der Universität Wien Physik, wo er 2011 bei Prof. Georg Kresse auch promovierte. Schon damals beschäftigte er sich mit numerischer Vielteilchen-Quantenphysik. Als Postdoc ging er daraufhin nach Cambridge, wo er auch an der „Coupled Cluster Methode“ arbeitete, die bis heute ein wichtiger Teil seiner Forschungsarbeit ist. Mit einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften kehrte er dann nach Wien zurück, 2015 wurde er Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Im Jahr 2016 wurde er mit einem ERC Starting Grant des European Research Council ausgezeichnet. Seit Juli 2017 ist er als Professor an der TU Wien tätig.
Rückfragehinweis:
Prof. Andreas Grüneis
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
andreas.grueneis@tuwien.ac.at
https://cqc.itp.tuwien.ac.at/
Physics World reveals its top 10 Breakthroughs of the Year for 2022
Physics World is delighted to announce its top 10 Breakthroughs of the Year for 2022, which span everything from quantum and medical physics to astronomy and condensed matter. The overall Physics World Breakthrough of the Year will be revealed on Wednesday 14 December.
Courtesy: IOP Publishing
The 10 Breakthroughs were selected by a panel of Physics World editors, who sifted through hundreds of research updates published on the website this year across all fields of physics. In addition to having been reported in Physics World in 2022, selections must meet the following criteria:
• Significant advance in knowledge or understanding
• Importance of work for scientific progress and/or development of real-world applications
• Of general interest to Physics World readers
The Top 10 Breakthroughs for 2022 are listed below in no particular order. Come back next week to find out which one has bagged the overall Physics World Breakthrough of the Year award.
The fastest possible optoelectronic switch
To Marcus Ossiander, Martin Schultze and colleagues at the Max Planck Institute for Quantum Optics and LMU Munich in Germany; the Vienna University of Technology and the Graz University of Technology in Austria; and the CNR NANOTEC Institute of Nanotechnology in Italy, for defining and exploring the “speed limits” of optoelectronic switching in a physical device.
The team used laser pulses lasting just one femtosecond (10−15 s) to switch a sample of a dielectric material from an insulating to a conducting state at the speed needed to realize a switch that operates 1000 trillion times a second (one petahertz). Although the apartment-sized apparatus required to drive this super-fast switch means it will not appear in practical devices any time soon, the results imply a fundamental limit for classical signal processing and suggest that petahertz solid-state optoelectronics is, in principle, feasible.
Read more:
“Quantum physics sets a speed limit for fastest possible optoelectronic switch“:
https://physicsworld.com/a/quantum-physics-sets-a-speed-limit-for-fastest-possible-optoelectronic-switch/
Perfecting light transmission and absorption
To a team led by Stefan Rotter of Austria’s Technical University of Vienna and Matthieu Davy of the University of Rennes in France for creating an anti-reflection structure that enables perfect transmission through complex media; along with a collaboration headed up by Rotter and Ori Katz from the Hebrew University of Jerusalem in Israel, for developing an “anti-laser” that enables any material to absorb all light from a wide range of angles.
In the first investigation, the researchers designed an anti-reflection layer that’s mathematically optimized to match the way waves would reflect from the front surface of an object. Placing this structure in front of a randomly disordered medium completely eliminates reflections and makes the object translucent to all incoming light waves.
In the second study, the team developed a coherent perfect absorber, based around a set of mirrors and lenses, that traps incoming light inside a cavity. Due to precisely calculated interference effects, the incident beam interferes with the beam reflected back between the mirrors, so that the reflected beam is almost completely extinguished.
Read more:
“Anti-reflection coating allows perfect light transmission”:
https://physicsworld.com/a/anti-reflection-coating-allows-perfect-light-transmission/
“Anti-laser enables near-perfect light absorption“:
https://physicsworld.com/a/anti-laser-enables-near-perfect-light-absorption/
Congratulations to all the teams who have been honoured – and stay tuned for the overall winner, which will be announced on Wednesday 14 December 2022.
Full article under:
https://physicsworld.com/a/physics-world-reveals-its-top-10-breakthroughs-of-the-year-for-2022/
ÖPG Studierendenpreis für Florian Lindenbauer
Florian Lindenbauer wurde für seine Masterarbeit mit dem ÖPG Studierendenpreis geehrt.
Vlnr: Maurizio E. Musso (Präsident der ÖPG), Florian Lindenbauer, Benjamin Klebel-Knobloch (ÖPG, Young Minds Arbeitskreis)
Die Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG), vergibt jährlich den mit 1.000 Euro dotierten Studierenden-Preis für herausragende Master- und Diplomarbeiten im Bereich der experimentellen oder theoretischen Physik. Am 28. September 2022 wurde Florian Lindenbauer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien nun mit diesem Preis, der österreichweit nur an wenige Master-Absolvent_innen vergeben wird, ausgezeichnet. Der Titel seiner Arbeit lautet: „Jet momentum broadening in a gluonic plasma from effective kinetic theory“, betreut wurde sie von Kirill Boguslavski und Anton Rebhan.
Wir gratulieren Florian Lindenbauer sehr herzlich!
Ein Doktoratskolleg für 2D-Materialien
Völlig neue Phänomene werden mit 2D-Materialien möglich – sie sind das zentrale Thema des Doktoratskollegs „TU-D“ an der TU Wien, das jetzt mit Finanzierung des FWF weitergeführt wird.
Graphen ist das berühmteste 2D-Material - doch mittlerweile forscht man auch an anderen.
Ein Material, das nur aus einer einzigen Schicht von Atomen besteht, hat keine klar definierbare Dicke – man spricht in diesem Fall daher von „2D-Materialien“. Erstmals hergestellt wurden sie im Jahr 2004, im Jahr 2010 wurde dafür der Physik-Nobelpreis vergeben. An der TU Wien wird seit Jahren an solchen Materialien geforscht – sowohl an ihren theoretischen Grundlagen als auch an ihren technologischen Anwendungen.
Mit der Förderung des Doktoratskollegs „TU-D“ durch den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF kann die Forschung und Ausbildung in diesem Bereich nun weiter ausgebaut werden. Dabei handelt es sich um ein sehr interdisziplinäres Doktoratskolleg: die Fakultäten für Physik, technische Chemie sowie Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Wien werden eng miteinander kooperieren.
Mehr als nur Graphen
Es begann mit Kohlenstoff: Das erste 2D-Material war Graphen, eine Schicht aus wabenförmig angeordneten Kohlenstoff-Atomen. Graphen ist für viele Anwendungen interessant – sowohl seine mechanischen als auch seine elektronischen Eigenschaften sind höchst ungewöhnlich. Mittlerweile sind aber auch noch andere 2D-Materialien entdeckt worden, man kann sie auch sandwichartig aufeinanderschichten, um sogenannte Heterostrukturen zu erzeugen, die wieder andere Eigenschaften aufweisen.
„Anwendungsmöglichkeiten für solche 2D-Materialien gibt es viele“, sagt Prof. Florian Libisch vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien – er ist Koordinator des neuen Doktoratskollegs. „2D-Materialien haben das Potenzial, ganze Technologiebereiche zu revolutionieren. In unserem Doktoratskolleg wollen wir besonders ihren Einsatz für Photovoltaik, Nanoelektronik und Biosensorik erforschen.“
Schon 2016 startete die TU Wien das Doktoratskolleg „TU-D“ zum Thema 2D-Materialien. Der Wissenschaftsfonds FWF fördert nun gezielt Doktoratskollegs, die von österreichischen Universitäten bereits mit Erfolg etabliert wurden. Im Rahmen dieser Förderung kann „TU-D“ nun ausgebaut werden: Insgesamt sollen in den nächsten 4 Jahren etwa 30 neue Doktorand_innen in TU-D ausgebildet werden - 10 davon werden direkt vom FWF im Rahmen des nun geförderten Antrags gezahlt. Entsprechende Stellenausschreibungen wird es ab Frühjahr 2023 geben.
Rückfragehinweis:
Prof. Dr. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
florian.libisch@tuwien.ac.at
Wie man Materialien durchschießt, ohne etwas kaputt zu machen
Wenn man geladene Teilchen durch ultradünne Materialschichten schießt, entstehen manchmal spektakuläre Mikro-Explosionen, manchmal bleibt das Material fast unversehrt. Das konnte man an der TU Wien nun erklären.
Die Autoren der Wiener Studie: v.l.n.r: Friedrich Aumayr, Christoph Lemell, Anna Niggas, Alexander Sagar Grossek, Richard A. Wilhelm. Foto: David Rath, TU Wien.
Das an der TU Wien entwickelte Modell erklärt, warum es in manchen zweidimensionalen Materialien beim Beschuss mit hochgeladenen Ionen zur Bildung winziger – nur wenige Nanometer großer - Löcher kommt, in anderen aber nicht. Der Effekt der Nano-Lochbildung lässt sich ausnutzen, um neuartige Siebe für bestimmte Moleküle herzustellen.
Es klingt ein bisschen wie ein Zaubertrick: Manche Materialien kann man mit schnellen, elektrisch geladenen Ionen durchschießen, ohne dass sie danach Löcher haben. Was auf makroskopischer Ebene unmöglich wäre, ist auf Ebene einzelner Teilchen erlaubt. Allerdings verhalten sich in solchen Situationen nicht alle Materialien gleich – in den letzten Jahren wurden von unterschiedlichen Forschungsgruppen Experimente mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt.
An der TU Wien konnte man nun eine detaillierte Erklärung finden, warum manche Materialien durchlöchert werden und andere nicht. Interessant ist das zum Beispiel für die Bearbeitung dünner Membrane, die maßgeschneiderte Löcher aufweisen sollen, um dort ganz bestimmte Atome oder Moleküle einzufangen, festzuhalten oder durchzulassen.
Ultradünne Materialien – Graphen und seine Artgenossen
„Es gibt heute eine ganze Reihe von ultradünnen Materialien, die nur aus einer oder aus wenigen Atomlagen bestehen“, sagt Prof. Christoph Lemell vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das wohl bekannteste davon ist Graphen, ein Material aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen. Aber auch an anderen ultradünnen Materialien wird heute weltweit geforscht, etwa an Molybdändisulfid.“
In der Forschungsgruppe von Prof. Friedrich Aumayr am Institut für Angewandte Physik der TU Wien beschießt man solche Materialien mit ganz besonderen Projektilen – mit hochgeladenen Ionen. Man nimmt Atome, typischerweise Edelgase wie etwa Xenon, und entreißt ihnen eine große Zahl von Elektronen. So entstehen Ionen mit 30- bis 40-facher elektrischer Ladung. Diese Ionen werden beschleunigt und treffen dann mit hoher Energie auf die dünne Materialschicht.
„Dabei kommt es je nach Material zu völlig unterschiedlichen Effekten“, sagt Anna Niggas, Experimentalphysikerin am Institut für Angewandte Physik „Manchmal durchdringt das Projektil die Materialschicht, ohne dass sich die Materialschicht dadurch merklich verändert. Manchmal wird die Materialschicht rund um den Einschlagsort auch vollkommen zerstört, zahlreiche Atome werden herausgelöst und ein Loch mit einem Durchmesser von einigen Nanometern entsteht.“
Die Geschwindigkeit der Elektronen
Diese erstaunlichen Unterschiede lassen sich dadurch erklären, dass nicht die Wucht des Projektils für die Löcher hauptverantwortlich ist, sondern seine elektrische Ladung. Wenn ein Ion mit vielfacher positiver Ladung auf die Materialschicht trifft, zieht es eine größere Menge von Elektronen an sich und nimmt sie mit. Somit bleibt in der Materialschicht eine positiv geladene Region zurück.
Welche Auswirkungen das hat, hängt davon ab, wie schnell sich Elektronen in diesem Material bewegen können. „Graphen hat eine extrem hohe Elektronenmobilität. Dort kann diese lokale positive Ladung also in kurzer Zeit ausgeglichen werden. Elektronen fließen einfach von anderswo nach“, erklärt Christoph Lemell.
In anderen Materialien wie Molybdändisulfid ist die Sache aber anders: Dort sind die Elektronen langsamer, sie können nicht rechtzeitig von außen an die Einschlagstelle nachgeliefert werden. Und so kommt es dann an der Einschlagstelle zu einer Miniexplosion: Die positiv geladenen Atome, denen das Projektil ihre Elektronen weggenommen hat, stoßen einander gegenseitig ab, sie fliegen davon – und dadurch entsteht ein Loch.
„Wir konnten nun ein Modell entwickeln, mit dem man sehr gut einschätzen kann, in welchen Situationen es zu einer Bildung von Löchern kommt und in welchen nicht – und zwar abhängig von der Elektronenmobilität im Material und vom Ladungszustand des Projektils“, sagt Alexander Sagar Grossek, Erstautor der Publikation im Fachjournal Nano Letters.
Das Modell erklärt auch die erstaunliche Tatsache, dass sich die aus dem Material herausgeschlagenen Atome relativ langsam bewegen: Die hohe Geschwindigkeit des Projektils spielt für sie keine Rolle, sie werden erst durch elektrische Abstoßung aus dem Material entfernt, nachdem das Projektil die Materialschicht bereits durchquert hat. Und bei diesem Prozess wird nicht die gesamte Energie der elektrischen Abstoßung auf die herausgeschlagenen Atome übertragen – ein großer Teil der Energie wird in Form von Schwingungen bzw. Hitze im verbleibenden Material absorbiert.
Sowohl die Experimente als auch die theoretischen Berechnungen wurden an der TU Wien durchgeführt. Das damit erzielte tiefere Verständnis atomarer Oberflächenprozesse lässt sich etwa nutzen, um Membranen gezielt mit maßgeschneiderten „Nanoporen“ auszustatten. So könnte man etwa ein „molekulares Sieb“ bauen, oder bestimmte Atome auf kontrollierte Weise festhalten. Es gibt sogar Überlegungen, mit solchen Materialien CO2 aus der Luft zu filtern. „Durch unsere Erkenntnisse haben wir nun exakte Kontrolle über die Bearbeitung von Materialien auf der Nano-Skala. Damit steht ein ganz neues Werkzeug zur Manipulation ultradünner Schichten erstmals auf präzise berechenbare Weise zur Verfügung“, sagt Alexander Sagar Grossek.
Originalpublikation:
A. S. Grossek, A. Niggas, R. A. Wilhelm, F. Aumayr, and C. Lemell Model for Nanopore Formation in Two-Dimensional Materials by Impact of Highly Charged Ions Nano Letters 2022 DOI:10.1021/acs.nanolett.2c03894:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c03894
Rückfragehinweise:
Prof. Dr. Christoph Lemell
Institut für Theoretische Physik
christoph.lemell@tuwien.ac.at
TU Wien Aktionstag 7.11.: Bekenntnis zu MINT unter Zugzwang
Konsequenzen ihrer Finanzsituation aufzeigen: Das wollen TUW-Angehörige am 7.11., ab 08:00 Uhr bei ihrem Aktionstag am Campus Karlsplatz/Resselpark.
Das Rektorat der Technischen Universität (TU) Wien steht kurz vor der Verhandlung mit dem BMBWF über ein Zusatzbudget. Dass die allen Universitäten zur Verfügung stehende Summe von 500 Mio € nicht einmal die Hälfte der erwarteten Zusatzkosten abdeckt, trifft die TU Wien besonders hart. „Niemand hat im Jahr 2020, als das Budget für die aktuelle Leistungsvereinbarungsperiode verhandelt wurde, voraussehen können, dass wir von einer globalen Krise in die nächste rutschen und diese sich überlagern“, erläutert Rektorin Sabine Seidler und führt weiter aus: „50 Prozent unseres Mehrbedarfs ergeben sich allein aus den steigenden Preisen für Strom und eine TU kann ohne Strom nicht arbeiten.“
Hinter Rektorin Sabine Seidler, ihrem Rektoratsteam und dem designierten Rektor Jens Schneider (Anm.: Amtsantritt 01.10.2023) stehen Dekan_innen, Senat, mehrere hundert Studierende, Forscher_innen, Nachwuchswissenschaftler_innen und das Verwaltungspersonal. Sie alle unterstützen den „TUW Aktionstag“ am Campus Karlsplatz/Resselpark am 7. November 2022 ab 8 Uhr. Als Warnsignal und zur Verdeutlichung der Auswirkungen der akuten Finanzsituation werden 30 Lehrveranstaltungen und Vorträge und 1.400 Studier- und Lernplätze ins Freie vor das TU-Hauptgebäude verlegt. Ab 12 Uhr formiert sich ein „Kompetenzmarsch“ vom Karlsplatz über den Ring mit einer Zwischenkundgebung vor dem Parlament zum BMBWF am Minoritenplatz, um aufzuzeigen, welche wissenschaftlichen Kompetenzen nicht mehr vermittelt werden, wenn kein gemeinsamer Lösungsweg für das bestehende Finanzproblem gefunden wird. Programm: www.tuwien.at/aktionstag
Neue Tagesordnung
„Wir können in dieser akuten Krisensituation nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, warnt TU-Rektorin Sabine Seidler, „denn insbesondere als MINT-Universität trägt die TU Wien gegenüber ihren Angehörigen und der Gesellschaft große Verantwortung.“
Die Tagesordnung für die bevorstehenden Gespräche muss daher die Diskussion um die Deckung des Budgetdefizits beinhalten:
1. ENERGIE
Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Forschung und Lehre sind abhängig vom Betrieb energieintensiver Infrastrukturen und Geräte, die sich nicht ohne weiteres abschalten lassen. 60 % des Stromverbrauchs der TU Wien entstehen in den Labors und deren Infrastruktur. Durch die Entwicklungen auf dem Energiemarkt entstehen Mehrkosten von etwa 90 Mio €.
2. MIETEN
Inflationsbedingte Indexsprünge erhöhen die Mietkosten um ca. 10 Mio €.
3. PERSONAL
Die MINT-Branche ist sowohl auf universitärer als auch auf unternehmerischer Seite in arger Bedrängnis. Ein adäquater Abschluss der Kollektivvertragsverhandlungen wird zu weiteren zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 35 Mio € führen.
4. INFLATION
Naturwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Forschung und Lehre sind auch abhängig von Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten. Selbst bei höchst effizientem Einsatz entstehen Mehrkosten von ca. 29 Mio € über einkalkulierte Preissteigerungen hinaus.
5. BEITRAG TU WIEN
Die TU Wien fährt bereits seit Monaten ein Energiesparprogramm, das alle Universitätsangehörigen mittragen. Dadurch wird der Stromverbrauch in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode konstant gehalten. Allein dadurch sollen insgesamt 20 Mio € eingespart werden.
6. KRISENGIPFEL
Die Situation der TU Wien zeigt, dass der finanzielle Mehrbedarf der Universitäten für die Jahre 2022 - 24 nochmals überprüft werden muss. Die Universitäten fordern daher erneut einen Krisengipfel, um angesichts der dramatischen Situation nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Das ist das Gebot der Stunde.
Konsequenzen der Finanzierungslücke
Ohne ausreichende zusätzliche Bundesbudgetmittel für die TU Wien für die Jahre 2022 - 2024 ist der Betrieb der Universität gefährdet und die TUW-Forschungsteams und Universitätslehrer_innen können ihre Aufgaben in Forschung (Innovation, Wissens- und Technologietransfer) und Lehre (MINT-Studierendenausbildung) nicht erfüllen.
Angehörige der TU Wien können nicht in höchster Qualität weiterforschen und lehren und dadurch sind MINT-Studierende automatisch unterversorgt, die Zahl der Absolvent_innen wird sinken, Forschungskooperationen werden nicht mehr möglich sein. So einen Mangel kann sich das Innovationsland Österreich nicht leisten.
Rückfragehinweise:
Simon Los
HTU Vorsitz
+43 664 60588 4957
vorsitz@htu.at
Bettina Neunteufl
Technische Universität Wien
Büro der Rektorin | Pressesprecherin
+43 664 484 50 28
bettina.neunteufl@tuwien.ac.at
Best Teaching Awards 2022 – herzliche Gratulation an Herbert Balasin und Felix Hummel!
Bereits zum sechsten Mal wurden im Rahmen einer festlichen Veranstaltung im Kuppelsaal die Best Teaching Awards der TU Wien vergeben.
© Matthias Heisler
Herbert Balasin dankt für den Best Teacher Award 2022
© Matthias Heisler
VR Kurt Matyas gratuliert Felix Hummel (Mitte) und Herbert Balasin (rechts)
© Matthias Heisler
Alle Gewinner_innen und Nominierten der Best Teaching Awards 2022.
Best Teacher Award 2022
Der Best Teacher Award wurde engagierten Lehrpersonen der TU Wien, die im Wintersemester 2021/22 oder im Sommersemester 2022 Lehrveranstaltungen gehalten haben, überreicht. Dabei ist die gesamte Lehrleistung und nicht eine spezielle Lehrveranstaltung der_des Lehrenden ausschlaggebend. Im Finale für den Best Teacher Award 2022 standen pro Fakultät je drei Personen.
Die Gewinner_innen des Best Teacher Award 2022 sind:
Fakultät für Physik
• Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Herbert Balasin
Best Lecture 2022
In dieser Kategorie wurden besonders positiv erlebte Lehrveranstaltungen aus dem Studienjahr 2021/22 ausgezeichnet. Gewonnen haben drei Lehrveranstaltungen mit ihren Lehrendenteams.
Die stolzen Gewinner_innen sind:
Elektrodynamik I VU (136.015 – 2022S)
• Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr.techn. Herbert Balasin
• Univ.Ass. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Felix Hummel
Wir gratulieren sehr herzlich!
Am 13. Oktober lud das Vizerektorat Studium und Lehre zu den sechsten Best Teaching Awards. Im feierlichen Rahmen des Kuppelsaals wurden besonders engagierte Lehrende und positiv erlebte Lehrveranstaltungen ausgezeichnet. Mit dem Sonderpreis „Digital Teaching“ wurden Lehrveranstaltungen prämiert, die digitale Lehrmöglichkeiten bestmöglich in die Lehrveranstaltung integrierten.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Kurt Matyas, Vizerektor Studium und Lehre. Gemeinsam mit Moderator Wolfgang Gerlich, Lehrbeauftragter am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen, führte er durch den spannenden Abend. Christian Marschnigg und Lisa Hoffmann stellten die einzelnen Nominierten anhand von Kommentaren der Studierenden näher vor.
Die Bilder aller Gewinner_innen werden in Kürze ergänzt:
https://www.tuwien.at/studium/lehren-an-der-tuw/best-teaching-awards
Der Livestream zum Nachschauen folgt auf tuwien.ac.at.
Dr. Herbert Balasin
+43 1 58801-13624
herbert.balasin@tuwien.ac.at
Dr. Felix Hummel
+43 1 58801-13668
felix.hummel@tuwien.ac.at
Eine perfekte Falle für Licht
An der TU Wien und der Hebräischen Universität Jerusalem wurde eine „Lichtfalle“ entwickelt, in der ein Lichtstrahl sich selbst am Entkommen hindert. Dadurch lässt sich Licht perfekt absorbieren.
Die "Lichtfalle", bestehend aus einem teildurchlässigen Spiegel, einem dünnen, schwachen Absorber, zwei Sammellinsen und einem totalreflektierenden Spiegel. Normalerweise würde der einfallende Lichtstrahl zum größten Teil reflektiert werden. Aufgrund genau berechneter Interferenzeffekte überlagert sich aber der einfallende Lichtstrahl mit dem zwischen den Spiegeln zurückgeleiteten Lichtstrahl, so dass der reflektierte Lichtstrahl letztlich völlig ausgelöscht wird. Die Energie des Lichts wandert vollständig in den dünnen, eigentlich schwachen Absorber.
Foto des experimentellen Setups an der Hebräischen Universität Jerusalem
Egal ob bei der Photosynthese oder in einer Photovoltaik-Anlage: Wenn man Licht effizient nutzen will, muss man es möglichst vollständig absorbieren. Schwierig ist das aber, wenn die Absorption in einer dünnen Materialschicht stattfinden soll, die normalerweise einen Großteil des Lichts durchlässt.
Nun fanden Forschungsteams der TU Wien und der Hebräischen Universität Jerusalem gemeinsam einen überraschenden Trick, mit dem man auch in dünnsten Schichten einen Lichtstrahl vollständig absorbieren kann: Rund um die dünne Schicht baut man mit Spiegeln und Linsen eine „Lichtfalle“, in der man den Lichtstrahl im Kreis lenkt und am Ende mit sich selbst überlagert – und zwar exakt so, dass er sich selbst blockiert und das System nicht mehr verlassen kann. Somit bleibt dem Licht nichts anderes übrig, als von der dünnen Schicht absorbiert zu werden – einen anderen Ausweg gibt es nicht. Diese Absorptions-Verstärker-Methode, die nun im Fachjournal „Science“ präsentiert wurde, ist das Resultat einer erfolgreichen Zusammenarbeit zweier Teams: Die Idee wurde von Prof. Ori Katz (Hebräische Universität Jerusalem) vorgeschlagen und mit Prof. Stefan Rotter (TU Wien) entwickelt, das Experiment wurde in Jerusalem durchgeführt und die theoretische Berechnungen kamen aus Wien.
Dünne Schichten sind lichtdurchlässig
„Licht zu absorbieren ist einfach, wenn es auf ein massives Objekt trifft“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Ein dicker schwarzer Wollpullover kann leicht Licht absorbieren. Aber bei vielen technischen Anwendungen hat man nur eine dünne Materialschicht zur Verfügung und möchte, dass das Licht genau in dieser Schicht absorbiert wird.“
Schon bisher gab es Versuche, die Absorption von Materialien zu verbessern: Man kann das Material etwa zwischen zwei Spiegeln platzieren. Das Licht wird zwischen den beiden Spiegeln hin und her reflektiert, durchquert dabei jedes Mal das Material und hat somit eine größere Chance, absorbiert zu werden. Allerdings dürfen die Spiegel nicht perfekt sein – einer von ihnen muss teilweise durchlässig sein, sonst kann das Licht gar nicht in den Bereich zwischen den beiden Spiegel eindringen. Das bedeutet aber auch, dass immer, wenn das Licht auf diesen teildurchlässigen Spiegel trifft, ein Teil des Lichts verlorengeht.
Das Licht blockiert sich selbst
Um genau das zu verhindern, kann man nun die Welleneigenschaften des Lichts auf ausgeklügelte Weise nutzen. „Durch unsere Methode können wir alle Reflexionen durch Welleninterferenz auslöschen“, sagt Prof. Ori Katz (Hebräische Universität Jerusalem). Helmut Hörner (TU Wien), der seine Diplomarbeit diesem Thema widmete, erklärt: „Auch bei unserem Verfahren fällt das Licht zunächst auf einen teildurchlässigen Spiegel. Wenn man einfach nur einen Laserstrahl auf diesen Spiegel schickt, wird er in zwei Teile aufgespalten: Der größere Teil wird reflektiert, ein kleiner Teil durchdringt den Spiegel.“
Dieser Anteil des Lichtstrahls, der den Spiegel durchdringt, wird nun durch die absorbierende Materialschicht geschickt und dann mit Linsen und einem weiteren Spiegel wieder zum teildurchlässigen Spiegel zurückgeleitet. „Das Entscheidende daran ist: Man justiert die Länge dieses Weges und die Position der optischen Elemente so, dass der zurückgeleitete Lichtstrahl und dessen Mehrfachreflexionen, die zwischen den Spiegeln hin und her laufen, den direkt am ersten Spiegel reflektierten Lichtstrahl exakt auslöscht“, erklären Yevgeny Slobodkin und Gil Weinberg, die beiden Doktoratsstudenten, die das Experiment in Jerusalem aufgebaut haben.
Die beiden Teilstrahlen überlagern sich so, dass sich das Licht gewissermaßen selbst blockiert: Obwohl der teildurchlässige Spiegel alleine eigentlich einen Großteil des Lichts reflektieren würde, wird durch den anderen Strahl genau diese Reflexion unmöglich gemacht. Der zunächst teildurchlässige Spiegel wird für den einfallenden Laserstrahl vollständig durchlässig. So entsteht eine Einbahnstraße für das Licht: Der Lichtstrahl kann zwar in das System eindringen, kann dann aber wegen der Überlagerung des reflektierten und des durchs System im Kreis geführten Anteils nicht mehr entkommen. So bleibt dem Licht nichts anderes übrig, als absorbiert zu werden – der gesamte Laserstrahl wird von einer dünnen Schicht verschluckt, die sonst einen Großteil des Strahls durchlassen würde.
Ein robustes Phänomen
„Das System muss genau auf die Wellenlänge abgestimmt werden, die man absorbieren möchte“, sagt Stefan Rotter. „Aber abgesehen davon gibt es keine Vorgaben. Der Laserstrahl muss keine bestimmte Form haben, er kann an manchen Stellen intensiver sein als an anderen – eine fast perfekte Absorption wird immer erreicht.“
Nicht einmal Luftturbulenzen und Temperaturschwankungen können dem Mechanismus etwas anhaben, wie man bei den Experimenten zeigen konnte, die an der Hebräischen Universität Jerusalem durchgeführt wurden. Das beweist, dass es sich um einen robusten Effekt handelt, der eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten verspricht – so könnte der vorgestellte Mechanismus gut dafür geeignet sein, selbst Lichtsignale, die bei der Übertragung durch die Erdatmosphäre verzerrt werden, perfekt einzufangen. Auch um Lichtwellen von schwachen Lichtquellen (etwa weit entfernten Sternen) optimal in einen Detektor einzuspeisen, könnte der neue Ansatz von sehr praktischem Nutzen sein.
Originalpublikation:
Massively degenerate coherent perfect absorber for arbitrary wavefronts, Science 377, 6609 (2022). DOI: 10.1126/science.abq8103:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq8103
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Wellen im Labyrinth ohne Wiederkehr
Vom Mobilfunk bis zur trüben Glasscheibe: Oft stören lästige Reflexionen die ungehinderte Ausbreitung von Wellen. Eine verblüffende Lösung des Problems präsentieren TU Wien und Universität Rennes im Journal „Nature“.
Skizze der Idee: Ein ungeordnetes Medium (a) wird zu einem perfekt übertragenden Medium durch das Hinzufügen einer maßgeschneiderten Antireflex-Schicht (b).
Ein schlechtes WLAN-Signal, das Rauschen im Radio oder schlechte Sicht im Nebel – all diese Ärgernisse haben damit zu tun, dass Wellen wie sichtbares Licht oder Mikrowellen-Signale von zahlreichen ungeordneten Hindernissen abgelenkt und reflektiert werden. Die TU Wien und die Universität Rennes (Frankreich) haben nun gemeinsam eine erstaunliche Methode entwickelt, mit der man Wellenreflexionen zur Gänze eliminieren kann:
Die Methode erlaubt die Berechnung einer maßgeschneiderten Antireflex-Struktur. Man kann damit etwa berechnen, wie man einer Wand, die für ein WLAN-Signal nur teilweise durchlässig ist, eine zusätzliche Schicht hinzufügen muss, damit das gesamte WLAN-Signal reflexionsfrei durch die Wand geschleust wird.
Bisher war nicht einmal auf theoretischer Ebene klar, dass so etwas überhaupt möglich ist – nun konnte das Forschungsteam eine konkrete Berechnungsmethode dafür präsentieren und diese auch im Experiment erfolgreich testen: Mikrowellen wurden durch ein komplexes, ungeordnetes Labyrinth von Hindernissen geschickt, dann wurde die genau dafür passende Antireflex-Struktur berechnet und im Experiment vor die Hindernisse gestellt – tatsächlich konnte die Reflexion fast vollständig zum Verschwinden gebracht werden: keine der Wellen kehrte zu der Seite zurück, von der aus sie eingestrahlt wurden.
Eine Antireflex-Schicht für fast alles
„Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie die Antireflex-Beschichtung auf einer Brille“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Man fügt dem Brillenglas eine zusätzliche Schicht hinzu, die dann dazu führt, dass Lichtwellen besser zum Auge gelangen als vorher. Die Reflexion wird reduziert.“
Beim Brillenglas ist das noch relativ einfach. Viel schwieriger ist es, wenn es sich um ein ungeordnetes Medium handelt, in dem eine Welle immer wieder gestreut und abgelenkt wird, bis sie auf komplizierten Wegen aus diesem Labyrinth wieder hinausfindet. Eine trübe Glasscheibe oder ein Stück Zucker fällt in diese Kategorie – oder eben auch eine Stahlbetonwand, die von Funksignalen durchdrungen wird. Die Wellen werden an vielen Punkten gestreut, sodass nur ein Teil davon hindurchgelangt, der Rest wird reflektiert oder in der Wand absorbiert.
Doch wie sich nun herausstellt, kann man auch bei komplexer Wellenstreuung eine „Zusatzschicht“ finden, die jede Reflexion verhindert. „Man muss zunächst einfach bestimmte Wellen durch das Medium schicken und genau vermessen, auf welche Weise diese Wellen von dem Material reflektiert werden“, erklärt Michael Horodynski (TU Wien), der Erstautor der aktuellen Publikation. „Wir konnten zeigen, dass man mit dieser Information für beliebige Medien, die Wellen auf komplexe Weise streuen, ein entsprechendes Ausgleichs-Medium berechnen kann, sodass die Kombination aus beiden Medien die Welle vollständig durchlässt. Der Schlüssel dazu ist eine mathematische Methode, mit der sich die exakte Form dieser Antireflex-Schicht berechnen lässt.“
Experiment mit Mikrowellen
In der in Rennes durchgeführten experimentellen Umsetzung dieser neuen Methode wurden Mikrowellen zunächst durch einen metallischen Wellenleiter geschickt, in dem die Wellen an Dutzenden, völlig zufällig und ungeordnet platzierten kleinen Objekten aus Metall und Teflon gestreut werden. Nur ungefähr die Hälfte der Mikrowellenstrahlung gelangt auf die andere Seite, der Rest wird reflektiert.
Nachdem man auf diese Weise das Streuverhalten dieses Systems genau vermessen hatte, konnte man mit der neuentwickelten Methode ausrechnen, welche zusätzlichen Streupunkte eine perfekte „Anti-Reflex-Schicht“ für genau dieses zufällige System bilden würden.
Und tatsächlich: Wenn man dann Wellen zuerst durch die Antireflex-Region mit den mathematisch optimierten zusätzlichen Streupunkten schickt und die Wellen dann von dort aus durch die Region mit den zufällig angeordneten Streuern wandern, dann gelangen sie am Ende zu hundert Prozent auf die andere Seite – keine Welle kehrt zum Ausgangspunkt zurück und die Reflexion ist vernachlässigbar; und zwar für jede beliebige Wellenform, die auf die Antireflex-Struktur trifft.
Vom WLAN bis zum Mikroskop
Die Tatsache, dass man Wellenstreuung durch zusätzliche Streuung ausgleichen kann, und dass man sogar einen Algorithmus angeben kann, um diese nötige Ausgleichs-Streuung zu berechnen, eröffnet Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen: Nicht nur für ein besseres WLAN, sondern auch für bildgebende Verfahren, etwa in der Biophysik, könnte die Technik nützlich sein. Auch bei 6G, der nächsten Generation des Mobilfunks nach 5G, wird Wellendynamik und Wellenstreuung ebenfalls eine große Rolle spielen: Man könnte die Intensität von Mobilfunk-Signalen reduzieren, wenn man es schafft, sie möglichst reflexionsarm auf passenden Pfaden vom Sender zum Empfänger zu senden.
Originalpublikation:
Customized anti-reflection structure for perfect transmission through complex media, Nature (2022), DOI: 10.1038/s41586-022-04843-6
Frei verfügbare Version: arXiv:2203.05429:
https://arxiv.org/abs/2203.05429
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Ein Schwarzes Loch als Silbermünze
In Zusammenarbeit mit der TU Wien hat die Münze Österreich eine ganz besondere Silbermünze produziert. Zwei öffentliche Vorträge geben im Juli Einblick in die Physik Schwarzer Löcher.
© Münze Österreich AG
Die Münze: Auf der einen Seite bedruckt und ausgebuchtet, um die Raumzeitkrümmung zu visualisieren
Ein Schwarzes Loch ist ein ganz besonderer Ort. Die Gesetze der Natur stoßen dort an ihre Grenzen. Und so ist es nur logisch, dass auch eine Münze, die ein Schwarzes Loch darstellen soll, auch eine ganz besondere Münze sein muss. In Zusammenarbeit mit Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien brachte die Münze Österreich nun eine Silbermünze mit Nennwert von 20 Euro heraus, die nicht eben, sondern in der Mitte trichterförmig gekrümmt ist – damit wird die Krümmung der Raumzeit um ein Schwarzes Loch symbolisiert. Auf der anderen Seite ist die Münze mit einem Farbaufdruck verziert.
Die Veröffentlichung der Münze fällt passenderweise in die Vorbereitungszeit für die große Stringtheorie-Konferenz „Strings 2022“, die von 18. bis 22. Juli in Wien stattfinden wird. Die Münze war ein großer Erfolg: Sie war bereits kurz nach dem Start ausverkauft. Ausgezeichnete Gelegenheiten, mehr über die faszinierende Physik Schwarzer Löcher zu erfahren, gibt es allerdings noch:
Schwarze Löcher für alle: Zwei öffentliche Vorträge
Zwei allgemeinverständliche Vorträge in englischer Sprache werden einen Einblick in die Physik Schwarzer Löcher bieten:
Public Lecture: „Black Hole Information Paradox“
Netta Engelhardt, MIT
22. Juli 2022, 19:00
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Kann Information einem Schwarzen Loch entkommen? Auf diese Fragen geben die Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, seit fast 50 Jahren unterschiedliche Antworten. Erstere beschreibt das Verhalten von Schwarzen Löchern, die Quantenmechanik beschreibt das Verhalten von Information. Beide Perspektiven können (noch) nicht zur Deckung gebracht werden. Die Uneinigkeit wird als „Black Hole Information Paradox“ bezeichnet.
Kolloquium: „Black Holes: the Most Paradoxical Objects in the Universe“
Andrew Strominger, Harvard University
23. Juli 2022, 19:00
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien
In der vergangenen Dekade rückten Schwarze Löcher mehr ins Zentrum theoretischer Überlegungen wie auch der beobachtenden Wissenschaft. Seit Stephen Hawking weiß man, dass Schwarze Löcher präzisen, aber noch rätselhaften Gesetzen gehorchen, die sie – paradoxerweise – sowohl zu den einfachsten als auch zu den komplexesten Objekten des Universums machen. In jüngster Zeit sind mit LIGO und dem Event Horizon Telescope außergewöhnliche Beobachtungen gelungen, die jene rätselhaften Gesetze bereits ein wenig aufhellen. So ist man beispielsweise davon überzeugt, dass den Symmetrien, die in der Nähe der Schwarzen Löcher auftreten, eine besondere Bedeutung zukommt.
Ehrenprofessur für Joachim Burgdörfer
Die Shenzhen Universität in China ernannte den Physiker Prof. Joachim Burgdörfer zum Ehrenprofessor.
Joachim Burgdörfer mit der Urkunde aus Shenzhen
Prof. Joachim Burgdörfers wissenschaftliche Arbeit war immer sehr international ausgerichtet: Forschungskooperationen pflegt er mit Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern der Welt – unter anderem auch mit China. Die Shenzhen Universität in der südchinesischen Provinz Guangdong ernannte ihn nun zum Ehrenprofessor.
Die Shenzhen Universität gilt als eines der führenden Inkubationszentren für Hochtechnologie in China, unter anderem ist dort HUAWEI beheimatet. Joachim Burgdörfer kollaborierte mit der Shenzhen Universität im Forschungsprojekten zur optischen Physik, Attosekundenphysik und der Wechselwirkung von Licht und Materie.
Zahlreiche Auszeichnungen
Studiert hat Burgdörfer an der Freien Universität Berlin, bald schon führte ihn seine wissenschaftliche Karriere allerdings in die USA, wo er 15 Jahre lang an der University of Tennessee und am Oak Ridge National Laboratory forschte - darüber hinaus hatte er Visiting Positions in Utrecht (Niederlande), dem Harvard Smithsonian Center for Astrophysics und der Universität Tokio inne. 1997 kehrte er nach Europa zurück, um eine Professur an der TU Wien anzutreten.
Joachim Burgdörfer erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine wissenschaftlichen Leistungen: So ist er unter anderem Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und Fellow der American Physical Society, in Japan wurde er mit dem RIKEN Eminent Scientist Award ausgezeichnet.
Wie man die Raumzeit am besten krümmt
Hat man die Relativitätstheorie bisher unnötig kompliziert formuliert? Neue Berechnungen der TU Wien und der Universität Wien unterstreichen die Bedeutung einer Idee von Roger Penrose.
Herbert Balasin
Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie hält noch immer große Rätsel bereit – das liegt nicht zuletzt daran, dass sie mathematisch sehr kompliziert ist. Sogar Einstein selbst brauchte Jahre, um die Mathematik zu verstehen, mit der man gekrümmten Raum und verbogene Zeit beschreiben kann.
Einsteins Herangehensweise war aber nicht die einzige und auch nicht die eleganteste Möglichkeit, die Geometrie der Raumzeit zu beschreiben. Roger Penrose, der für seine Arbeiten über Schwarze Löcher 2020 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde, schlug einen originellen alternativen Zugang vor: Anstatt einen gekrümmten vierdimensionalen Raum zu verwenden, geht Penrose von zweidimensionalen Vektorräumen aus – allerdings sind dort dafür komplexe Zahlen erlaubt.
Herbert Balasin vom Institut für theoretische Physik der TU Wien und Peter Aichelburg, Gravitationsphysiker an der Universität Wien nahmen diesen Ansatz von Roger Penrose nun genauer unter die Lupe und konnten zeigen: Auch bestimmte Arten von Gravitationswellen lassen sich in diesem Formalismus korrekt darstellen.
Abstände in Raum und Zeit
Wenn wir im Alltag Abstände berechnen, verwenden wir dafür den Satz des Pythagoras: Man summiert die Abstandsquadrate in jeder räumlichen Richtung und bekommt das Quadrat des Gesamtabstands. In der Relativitätstheorie kommt zu den drei Raumdimensionen als vierte Dimension die Zeit hinzu – nun kann man auf ganz ähnliche Weise einen Raumzeit-Abstand zwischen zwei Ereignissen ausrechnen. Allerdings ändert sich dabei ein Vorzeichen: Das Abstandsquadrat ist das Quadrat des zeitlichen Abstands minus dem Quadrat des räumlichen Abstands – nicht mit Pluszeichen dazwischen, wie beim gewöhnlichen Satz des Pythagoras.
„Das bedeutet, dass der Abstand positiv oder negativ werden kann. Man bekommt drei verschiedene Arten von Abständen“, erklärt Herbert Balasin. Wenn der zeitliche Abstand größer ist als der räumliche Abstand, ist der Gesamtabstand größer als null – man spricht von einem „zeitartigen Intervall“. Im umgekehrten Fall hat man es mit einem „raumartigen Intervall“ zu tun. Und das Licht selbst ist genau an der Grenze dazwischen – es legt pro Sekunde immer genau die Distanz von einer Lichtsekunde zurück. Der raumzeitliche Abstand zwischen zwei lichtartig verbundenen Ereignissen – etwa die Entstehung eines Photons in der Sonne und seine Absorption acht Minuten später auf der Erde – beträgt immer genau null.
Kein Abstand ohne Metrik
„Um herauszufinden, in welche dieser drei Kategorien ein bestimmter Vektor in der Raumzeit gehört, muss man normalerweise allerdings die Metrik kennen“, sagt Herbert Balasin. Die Metrik (oder „metrischer Tensor“) ist ein mathematisches Objekt, das in Einsteins Relativitätstheorie eine zentrale Rolle spielt. Sie legt an jedem Punkt die Beziehung zwischen räumlichen und zeitlichen Abständen fest und beschreibt damit die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, die etwa durch schwere Massen hervorgerufen wird. „Ohne diese Metrik kann man keine Abstände ausrechnen – sie sagt uns erst, was der Abstandsbegriff überhaupt bedeutet“, sagt Herbert Balasin.
Deswegen klang es für Relativitätstheorie-Profis zunächst überraschend, dass Roger Penrose zeigte: Man kann auch völlig ohne Verweis auf eine Metrik Nullvektoren konstruieren – also die Ausbreitung des Lichts durch Raum und Zeit beschreiben. Der Schlüssel dazu war, dass Penrose statt vierdimensionaler Vektoren in Raum und Zeit zweidimensionale Spinoren verwendet – mathematische Objekte, die etwas anderen Regeln gehorchen. Sie lassen sich außerdem nicht bloß in reellen Zahlen aufschreiben, wie die Koordinaten eines Vektors in Raum und Zeit, sondern in komplexen Zahlen. Unserer physikalischen Intuition mag es schwerfallen, statt über vierdimensionale Raumzeiten über zweidimensionale komplexe Räume nachzudenken, aber mathematisch wird die Sache dadurch klarer. „Die Idee von Roger Penrose ist eine bahnbrechende neue Einsicht, die uns auch viel besser als bisher zeigt, wie eng unterschiedliche Theorien miteinander zusammenhängen – etwa die Relativitätstheorie und die Elektrodynamik“, erklärt Herbert Balasin. „Plötzlich kann man unterschiedliche Theorien auf mathematisch ganz ähnliche Weise darstellen.“
Gravitationswellen im Spinor-Raum
Ob es sich dabei allerdings bloß um mathematische Eleganz handelt, oder um ein praktikables Werkzeug, muss sich zeigen, wenn man die Theorie für konkrete Berechnungen einsetzt. Genau das probierten Herbert Balasin und Peter Aichelburg nun aus, und zwar anlässlich des neunzigsten Geburtstags von Roger Penrose. Sie konnten zeigen, dass man mit dem alternativen Zugang von Penrose ganz ohne Metrik bestimmte Sorten von Gravitationswellen beschreiben kann – die sogenannten „ebenfrontigen Gravitationswellen“.
„Das heißt natürlich nicht, dass die Art, wie man die allgemeine Relativitätstheorie bisher betrachtet hat, falsch war“, sagt Herbert Balasin. Aber wenn sich diese neue Darstellung in komplexen zweidimensionalen Räumen bewährt, kann das weitreichende Konsequenzen haben. Die Betrachtungsweise ermöglicht einfachere, klarere Einblicke in die Zusammenhänge zwischen Theorien – vielleicht rückt damit sogar das große Ziel näher, Relativitätstheorie und Quantentheorie endgültig zu vereinen.
Die Forschungsarbeit über Gravitationswellen in Penroses Spinor-Formalismus wurde nun als „Featured Article“ im Fachjournal AVS Quantum Science publiziert. Auch in der Lehre an der TU Wien fließen die neuen Betrachtungsweisen bereits ein – etwa in Balasins Vorlesung „Geometrie und Gravitation II“.
Originalpublikation:
P.C. Aichelburg and H. Balasin: Curvature without metric: the Penrose construction for half-flat pp-waves, AVS Quantum Sci. 4, 020801 (2022):
https://avs.scitation.org/doi/full/10.1116/5.0074308
Rückfragehinweis:
Dr. Herbert Balasin
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
herbert.balasin@tuwien.ac.at
Die Höchstgeschwindigkeit der Quanten
Halbleiterelektronik wird immer schneller – aber irgendwann erlaubt die Physik keine Steigerung mehr. Die kürzest mögliche Zeitskala optoelektronischer Phänomene wurde nun untersucht.
Ein ultrakurzer Laserpuls sorgt dafür, dass sich geladene Teilchen frei bewegen können, ein zweiter (rot) sorgt für das elektrische Feld, das die Ladungsträger in die gewünschte Richtung bewegt.
Wie schnell kann Elektronik werden? Wenn Computerchips mit immer kürzeren Signalen und immer kleineren Zeitabständen arbeiten, stößt man irgendwann auf physikalische Grenzen: Die quantenmechanischen Prozesse, die in einem Halbleitermaterial die Entstehung von elektrischem Strom ermöglichen, brauchen ihre Zeit. Schneller ist Signalentstehung und Signalübertragung einfach nicht möglich.
Diese Grenzen konnten TU Wien, TU Graz und das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching nun gemeinsam ausloten: Spätestens bei etwa einem Petahertz (eine Million Gigahertz) kann die Geschwindigkeit nicht weiter gesteigert werden, selbst wenn man das Material auf optimale Weise mit Laserpulsen anregt. Dieses Resultat wurde nun im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.
Vom Feld zum Strom
Elektrischer Strom und Licht (also elektromagnetische Felder) gehören untrennbar zusammen. Das ist auch in der Mikroelektronik so: In Mikrochips wird Strom mit Hilfe elektromagnetischer Felder kontrolliert. So kann man etwa ein elektrisches Feld an einen Transistor anlegen, und je nachdem, ob das Feld eingeschaltet ist oder nicht, lässt der Transistor Strom fließen oder blockiert ihn. So wird ein elektromagnetisches Feld in ein Stromsignal umgewandelt.
Wenn man die Grenzen dieser Umwandlung von elektromagnetischen Feldern zu Stromsignalen ausloten möchte, dann verwendet man statt Transistoren vorzugsweise Laserpulse – die schnellsten, präzisesten elektromagnetischen Felder, die es gibt.
„Man untersucht ein Material, das zunächst keinen elektrischen Strom leitet“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Es wird mit einem ultrakurzen Laserpuls mit einer Wellenlänge im extremen UV-Bereich beschossen. Dieser Laserpuls bringt die Elektronen in einen energiereicheren Zustand, sodass sie sich plötzlich frei bewegen können. So wird das Material durch den Laserpuls kurzfristig zum elektrischen Leiter.“ Sobald sich im Material frei bewegliche Ladungsträger befinden, können sie von einem zweiten, etwas längeren Laserpuls in eine bestimmte Richtung bewegt werden. So entsteht ein elektrischer Strom, der dann mit Elektroden auf beiden Seiten des Materials detektiert werden kann.
Diese Vorgänge laufen extrem schnell ab – auf einer Zeitskala von Atto- oder Femtosekunden. „Lange Zeit hat man solche Prozesse als instantan betrachtet“, sagt Prof. Christoph Lemell (TU Wien). „Heute allerdings haben wir die technologischen Möglichkeiten, den zeitlichen Ablauf dieser ultraschnellen Vorgänge im Detail zu studieren.“ Die entscheidende Frage ist: Wie schnell reagiert das Material auf den Laser? Wie lange dauert die Signalentstehung und wie lange muss man warten, bis das Material dem nächsten Signal ausgesetzt werden kann? Die Experimente dazu wurden in Garching und Graz durchgeführt, die theoretische Arbeit sowie aufwändige Computersimulationen entstanden an der TU Wien.
Zeit oder Energie – aber nicht beides
Man stößt bei diesem Experiment auf ein klassisches Unschärfe-Dilemma, wie es in der Quantenphysik oft vorkommt: Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, braucht man extrem kurze UV-Laserpulse, damit sehr rasch freie Ladungsträger entstehen. Extrem kurze Pulse bedeuten aber, dass man den Elektronen nicht eine ganz bestimmte präzise definierte Energie überträgt, sondern die Elektronen ganz unterschiedliche Energien aufnehmen können. „Man kann zwar genau sagen, zu welchem Zeitpunkt die freien Ladungsträger entstehen, aber nicht in welchem Energiezustand sie sich danach befinden“, sagt Christoph Lemell. „Festkörper haben unterschiedliche erlaubte Energie-Bänder, und mit kurzen Laserpulsen werden viele von ihnen zwangsläufig gleichzeitig von freien Ladungsträgern bevölkert.“
Je nachdem, wie viel Energie sie tragen, reagieren die Elektronen ganz unterschiedlich auf das elektrische Feld. Wenn ihre exakte Energie unbekannt ist, kann man sie daher nicht mehr präzise steuern, und das Stromsignal, das am Ende entsteht, wird verfälscht – besonders bei hohen Laser-Intensitäten.
„Daraus ergibt sich, dass bei etwa einem Petahertz eine Obergrenze für kontrollierte optoelektronische Prozesse liegt“, sagt Joachim Burgdörfer. Das heißt freilich nicht, dass man Computerchips mit einer Taktfrequenz von knapp unter einem Petahertz herstellen kann – realistische technische Obergrenzen liegen wohl noch deutlich darunter. Klar ist: Gewisse Grenzen lassen sich nicht überlisten, aber mit ausgeklügelten Methoden kann es gelingen, diese Grenzen auszuloten und genau zu verstehen.
Originalpublikation
M. Ossiander et al., The speed limit of optoelectronics, Nature Communications (2021). DOI: 10.1038/s41467-022-29252-1: https://www.nature.com/articles/s41467-022-29252-1
Rückfragehinweis
Prof. Christoph Lemell
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
christoph.lemell@tuwien.ac.at
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at
Donuts und Laserstrahlen
In der Materialforschung erzielt man große Erfolge, indem man Erkenntnisse aus der Topologie nutzt. Ähnliche Werkzeuge lassen sich nun auch auf Laser anwenden.
Arbeitsweise des Lasers: Das Licht kann in den beiden dicht beieinanderliegenden Licht-Bahnen (rote und blaue Bahn) hin- und herlaufen und wird an den Enden teilweise reflektiert. Der linken Bahn wird von außen Energie zugeführt. Als Resultat der nicht-trivialen topologischen Struktur, die das Laserlicht durchläuft, entstehen an den beiden Enden des Lasers genau gegenteilige Interferenzmuster.
Ein Möbius-Band als topologisch nicht-triviale Schleife: Folgen die möglichen Energien des Laserlichtes dieser Schleife, kehren diese nach einer Runde nicht zu ihren Ausgangswerten zurück.
Ein Donut ist keine Semmel. Aus mathematischer Sicht sind das zwei grundverschiedene Objekte: Der Donut hat ein Loch, die Semmel nicht. Einen Kreis, der im Donut rund um das Loch in seiner Mitte herumführt, kann man nicht zu einem Punkt zusammenziehen. Einen beliebigen Kreis innerhalb der Semmel hingegen schon.
Die mathematische Disziplin, die sich mit solchen Kategorisierungen von Flächen und Körpern befasst, ist die Topologie. Sie hat in den letzten Jahren auch in der Physik eine wachsende Rolle gespielt: 2016 wurde der Nobelpreis für die Anwendung topologischer Konzepte auf die Festkörperphysik vergeben. Nun zeigt sich: Topologie kann auch für die Erzeugung von Laserlicht eine entscheidende Rolle spielen. Durch eine Kooperation der TU Wien mit Forschungsteams aus den USA wurde ein spezieller Laser entwickelt, der Lichtstrahlen mit charakteristischen topologischen Eigenschaften emittiert. Publiziert wurde dieser Erfolg nun im Fachjournal „Science“.
Stabil gegen Störungen
Topologische Eigenschaften sind unter anderem deshalb so interessant, weil sie relativ stabil gegenüber Störungen sind: Lassen sich gewisse physikalische Eigenschaften nur von der Tatsache ableiten, dass ein Donut eben genau ein Loch besitzt, dann spielen Details wie der äußere Umfang plötzlich keine Rolle mehr. Auch ein etwas gequetschter Donut sieht nun einmal nicht aus wie eine Semmel.
In der Physik geht es freilich nicht nur um die geometrische Form eines Objekts, sondern um seine inneren Eigenschaften – auch dabei kann man, wenn auch auf etwas abstraktere Weise, auf topologisch interessante Phänomene stoßen: „Die erlaubten Energiewerte eines Systems können zumeist nur auf ganz bestimmten Flächen liegen. Die topologische Struktur dieser Flächen bestimmt dann mitunter die Eigenschaften des ganzen Objektes“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das sind keine Flächen im dreidimensionalen Raum, wie wir ihn kennen, sondern im Raum der Energiewerte – aber das Prinzip bleibt dasselbe“, erklärt Alexander Schumer, der Erstautor der soeben publizierten Studie. Auch diese Flächen in abstrakten, mathematisch definierten Parameterräumen werden durch kleine Störungen bloß verformt, bewahren aber ihre topologischen Eigenschaften.
Theorie und Experiment in Zusammenarbeit
Alexander Schumer und Stefan Rotter forschen in Wien schon seit längerer Zeit mit Hilfe von Computersimulationen an den topologischen Eigenschaften von Lichtwellen. Wie man die daraus gewonnenen Erkenntnisse in der Laserphysik einsetzen kann, war Gegenstand von Alexander Schumers Doktorarbeit. Über ein von der EU gefördertes Projekt verbrachte er mehrere Monate in Kalifornien und Florida, wo die Forschungsergebnisse gemeinsam mit den dortigen Forschungsgruppen auch im Experiment umgesetzt wurden.
Der nun realisierte Laser besteht aus zwei dicht beieinanderliegenden Licht-Bahnen. Entlang dieser Bahnen kann sich das Licht ausbreiten, an ihren Enden wird es reflektiert. Während des Hin- und Herlaufens kann das Licht von einer Licht-Bahn auf die andere wechseln, es kann durch Energiezufuhr von außen verstärkt oder auch abgeschwächt werden.
„So gelang es, einen Laser zu bauen, dessen Energien einer topologisch nicht trivialen Schleife folgen“, sagt Alexander Schumer. Im gewöhnlichen dreidimensionalen Raum betrachtet geht das Licht einfach vor und zurück. Stellt man hingegen den Weg, den das Licht im Laser zurücklegt, im Raum der möglichen Energiewerte dar, dann zeigt sich: Die Energie beschreibt eine Schleife rund um einen sogenannten „Ausnahmepunkt“ – dieser Punkt erfüllt sozusagen die Funktion des Donutlochs, aber im Energieraum.
„Diese topologische Schleife im Energieraum mag abstrakt und belanglos wirken, hat jedoch für das Licht im Laser eine entscheidende Auswirkung: die Energie des Lichts kehrt bei der Umrundung des Ausnahmepunkts nicht zu ihrem Ausgangspunkt zurück, sondern zu einem anderen Punkt – ähnlich wie eine Bahn auf einem Möbius-Band“, erklärt Alexander Schumer.
Wenn man nun beide Seiten des Lasers leuchten lässt, werden genau diese beiden unterschiedlichen Endpunkte der Bahn um den Ausnahmepunkt sichtbar: die zwei Lichtstrahlen, die vom Laser in die entgegengesetzte Richtung emittiert werden, weisen den charakteristischen Unterschied auf, dass sie sich auf einer Seite im Zentrum verstärken, auf der anderen Seite hingegen auslöschen. „Das ist eine direkte Konsequenz der topologischen Eigenschaften“, betont Alexander Schumer.
„Damit haben wir gezeigt, wie man diese topologischen Konzepte auch in der Laserphysik zugänglich machen kann, ohne auf photonische Gitter oder Kristallstrukturen zurückgreifen zu müssen“, sagt Stefan Rotter. „Das könnte, ähnlich wie in der Festkörperphysik, zu wichtigen neuen Anwendungsmöglichkeiten führen. Man könnte damit möglicherweise besonders robuste, starke Laser bauen, in denen man über einen langen Pfad hinweg das Licht verstärken kann.“
Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den Forschungsgruppen von Prof. Mercedeh Khajavikhan (University of Southern California; Ming Hsieh Department of Electrical Engineering; Los Angeles), Prof. Patrick LiKamWa und Prof. Demetrios Christodoulides (beide: University of Central Florida; College of Optics and Photonics; Orlando) durchgeführt.
Originalpublikation:
A. Schumer et al., Topological Modes in a Laser Cavity via Exceptional State Transfer, Science (2021), DOI: 10.1126/science.abl6571:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl6571
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Dipl.-Ing. Alexander Schumer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
alexander.schumer@tuwien.ac.at
Benedikt Hartl - sub auspiciis Promotionen am 26. Jänner 2022 an der TU Wien
Sieben Absolventen der TU Wien wurden am 26. Jänner 2022 im Rahmen der Sub auspiciis Promotionen für ihre herausragenden Leistungen in Schule und Studium geehrt. Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen verlieh ihnen den Ehrenring der Republik Österreich.
© Thomas Blazina_TU Wien
Promovenden von links: oben: Alexander Aschauer, Benedikt Hartl, Lukas Daniel Klausner, unten: Michael Neunteufel, Paul Szabo, Thomas Hausberger und Emanuel Sallinger
© Thomas Blazina_TU Wien
Promovenden von links: Benedikt Hartl, Michael Neunteufel, Thomas Hausberger, Lukas Daniel Klausner, Alexander Aschauer, Paul Szabo und Emanuel Sallinger; letzte Reihe hinten von links: Rektorin Sabine Seidler, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, VR Kurt Matyas
Für Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen gab es noch einen zweiten Grund zum Feiern: sein fünfjähriges Amtsjubiläum. Die TU Wien gratuliert herzlich und freut sich, dass Herr Van der Bellen an diesem besonderen Tag an der TU Wien war.
Vier Fragen an DI Benedikt Hartl
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?
Mit meinem direkten Umfeld stehe ich ja regelmäßig in Kontakt und gerade gegen Ende meines Studiums wurde die Möglichkeit einer Sub auspiciis Promotion öfter zum Thema. Für viele kam mein Erfolg wenig überraschend, obwohl das für mich dann doch einen gewissen selbstauferlegten Druck darstellte. Schade war nur, dass meine Defense während eines Lockdowns stattfand und ich danach mit niemandem anstoßen konnte.
Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?
Ich habe von Sport, Musik und Literatur bis hin zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen recht viele Interessen. Womit ich meine Freizeit verbringe, ist also sehr unterschiedlich. Derzeit freue ich mich aber, dass ich nach einer hartnäckigen Knieverletzung wieder längere Strecken laufen kann. Wo ich darüber nachdenke, liegt meine Leidenschaft – im wahrsten Sinne des Wortes – aber wohl darin, dass ich mir ständig neue Herausforderungen suche und mir zum Ziel setze, diese so gut wie möglich zu meistern. Sei das eine respektable Halbmarathon-Zeit zu laufen, ein neues Musikstück oder Instrument zu lernen oder neue Konzepte der künstlichen Intelligenz am Computer auszuprobieren.
Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: Wer wäre das und wieso?
Diese Frage kann ich nur schwer beantworten, da es so viele interessante Persönlichkeiten gibt und vor allem gegeben hat. Wenn es keine berühmte Persönlichkeit sein müsste, wäre meine Antwort einfach, denn dann würde ich gerne ein letztes Mal mit meinem Vater plaudern, vielleicht sogar bei einem Gläschen Whisky. Aber so fällt meine Wahl wohl auf Stan Lee, einem der Gründer von Marvel Comics. Denn neben seinem Humor finde ich den immer wiederkehrenden Grundgedanken in seinen Werken, nämlich, dass “eben auch ein Einzelner einen Unterschied machen kann”, wichtiger denn je.
Abschließend noch ein paar Worte zu Ihrer Dissertation:
In meiner Doktorarbeit habe ich mich mit der Selbstorganisation von geladenen Teilchen oder Molekülen in der Nähe von Oberflächen beschäftigt, also mit der Formierung von geordneten, teils aperiodischen Strukturen unter geometrischen Einschränkungen. Speziell habe ich versucht, diese physikalischen Abläufe am Computer zu simulieren, um die Strukturbildung solcher Systeme vorherzusagen. Dafür kamen verschiedenste Algorithmen wie Monte-Carlo-Simulationen, evolutionäre Algorithmen, aber auch Konzepte von Machine Learning und künstlicher Intelligenz zum Einsatz.
Interessant sind solche Strukturvorhersagen deswegen, weil neben den Eigenschaften der atomaren oder molekularen Bausteine eines Materials auch deren exakte räumliche Anordnung – deren Struktur – großen Einfluss auf entsprechende Materialeigenschaften wie Leitfähigkeit, Kompressibilität und Ähnliches hat. Kennt man die Struktur eines Materials, weiß man oft sehr viel über dessen potenzielle Einsatzmöglichkeiten. Umso besser, wenn man dafür einfach einen Computer verwenden kann, als auf oft aufwendige Labormethoden angewiesen zu sein.
Wenn man es dann zusätzlich schaffen würde, die Bestandteile eines Materials so zu designen, dass sie sich selbständig in vordefinierte Strukturen anordnen, sind Anwendungen wie Nano-Schaltkreise, Nano-Maschinen oder künstliche Rezeptoren durchaus denkbar. Man könnte also quasi Materie programmieren, um ganz spezifische Aufgaben zu lösen.
Im Kuppelsaal der TU Wien wurden zum „Doktor der Technischen Wissenschaften“ promoviert:
Dipl.-Ing. Benedikt Hartl, BSc
Dissertation: „Confinement-Driven Self-Assembly of Charged Particles"
Fakultät für Physik
Dissertationsbetreuer: Ao.Univ.Prof. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerhard Kahl
Dipl.-Ing. Alexander Aschauer, BSc
Dissertation: „Optimal Scheduling in a Hot Rolling Mill for Refractory Metals"
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Andreas Kugi
Dipl.-Ing. Lukas Daniel Klausner, BSc
Dissertation: „Creatures and Cardinals“
Fakultät für Mathematik und Geoinformation
Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin Goldstern
Dipl.-Ing. Michael Neunteufel, BSc
Dissertation: „Mixed finite element methods for nonlinear continuum mechanics and shells”
Fakultät für Mathematik und Geoinformation
Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Joachim Schöberl
Dipl.-Ing. Paul Szabo, BSc
Dissertation: „On Interaction with Realistic Surfaces: Case Studies for Space Weathering and Nuclear Fusion Research”
Fakultät für Physik
Dissertationsbetreuer: Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dipl.-Ing. Dr.techn. Friedrich Aumayr
Dipl.-Ing. Thomas Hausberger, BSc
Dissertation: „Nonlinear High-Speed Model Predictive Control with Long Prediction Horizons for Power Converter Systems”
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Dissertationsbetreuer: Associate Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Wolfgang Kemmetmüller
Mag. rer.soc.oec. Dipl.-Ing. Dr. techn. Emanuel Sallinger, BSc
Dissertation: „Information Management: dependencies in research, teaching and business”
Fakultät für Informatik
Dissertationsbetreuer: O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Georg Gottlob
Künstliche Intelligenz für die Teilchenphysik
Kann man mit machine learning den Geheimnissen des Quark-Gluon-Plasmas auf die Spur kommen? Ja – aber nur mit ausgeklügelten neuen Methoden.
Ein Quark-Gluon-Plasma nach der Kollision zweier Atomkerne
Das Team: Daniel Schuh, Andreas Ipp (oben), Matteo Favoni, David Müller (unten) (vlnr)
Komplizierter geht es kaum: Mit extrem hoher Energie schwirren winzige Teilchen wild umher, in dem wirren Durcheinander von Quantenteilchen kommt es zu unzähligen Interaktionen, und so ergibt sich ein Materiezustand, den man als „Quark-Gluon-Plasma“ bezeichnet. Unmittelbar nach dem Urknall war das ganze Universum in diesem Zustand, heute stellt man ihn durch hochenergetische Atomkernkollisionen her, etwa am CERN.
Wenn man solche Prozesse analysieren will, ist man auf Hochleistungscomputer angewiesen – und auf hochkomplexe Computersimulationen, deren Ergebnisse schwierig auszuwerten sind. Daher liegt die Idee nahe, künstliche Intelligenz bzw. machine learning dafür zu verwenden. Gewöhnliche machine-learning-Algorithmen sind für diese Aufgabe allerdings nicht geeignet. Die mathematischen Eigenschaften der Teilchenphysik machen eine ganz besondere Struktur von neuronalen Netzen notwendig. An der TU Wien konnte nun gezeigt werden, wie man neuronale Netze mit Erfolg für diese herausfordernden Aufgaben der Teilchenphysik nutzen kann.
Neuronale Netze
„Ein Quark-Gluon-Plasma möglichst realistisch zu simulieren nimmt extrem viel Rechenzeit in Anspruch“, sagt Dr. Andreas Ipp vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Selbst die größten Supercomputer der Welt sind damit rasch überfordert.“ Es wäre daher wünschenswert, wenn man nicht jedes Detail präzise berechnen müsste, sondern mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz gewisse Eigenschaften erkennen und vorhersagen könnte.
Man verwendet daher neuronale Netze, wie sie etwa auch für die Bilderkennung verwendet werden: Virtuelle „Zellen“ werden am Computer auf ähnliche Weise vernetzt wie Neuronen im Gehirn – und so entsteht ein Netz, das zum Beispiel erkennen kann, ob auf einem bestimmten Bild eine Katze zu sehen ist oder nicht.
Wenn man diese Technik auf das Quark-Gluon-Plasma anwendet, stößt man allerdings auf ein schwerwiegendes Problem: Die Felder, mit denen man die Teilchen und die Kräfte zwischen ihnen mathematisch beschreibt, können auf unterschiedliche Arten dargestellt werden. „Man spricht hier von Eichsymmetrien“, sagt Ipp. „Das Grundprinzip kennen wir aus dem Alltag: Wenn ich ein Messgerät anders eiche, etwa wenn ich bei meinem Thermometer statt der Celsius-Skala die Kelvin-Skala verwende, dann erhalte ich völlig andere Zahlen, auch wenn ich denselben physikalischen Zustand beschreibe. Bei Quantentheorien ist es ähnlich – nur dass dort die erlaubten Eichungen mathematisch viel komplizierter sind.“ Mathematische Objekte, die auf den ersten Blick völlig unterschiedlich aussehen, können denselben physikalischen Zustand beschreiben.
Eichsymmetrien in die Struktur des Netzes eingebaut
„Wenn man diese Eichsymmetrien nicht berücksichtigt, kann man die Ergebnisse der Computersimulationen nicht sinnvoll interpretieren“, sagt Dr. David I. Müller. „Einem neuronalen Netz beizubringen, diese Eichsymmetrien von sich aus zu erkennen, wäre extrem schwierig. Viel besser ist es, von vornherein die Struktur des neuronalen Netzes so zu gestalten, dass die Eichsymmetrie automatisch berücksichtigt wird – dass also unterschiedliche Darstellungen desselben physikalischen Zustands im neuronalen Netz auch dieselben Signale hervorrufen. Genau das ist uns jetzt gelungen: Wir haben ganz neue Netzwerk-Schichten entwickelt, die von sich aus die Eichinvarianz berücksichtigen.“ In einigen Beispielanwendungen wurde gezeigt, dass diese Netze tatsächlich viel besser lernen können, mit den Simulationsdaten des Quark-Gluon-Plasmas umzugehen.
„Mit solchen neuronalen Netzwerken wird es möglich, Vorhersagen über das System zu treffen – etwa abzuschätzen, wie das Quark-Gluon-Plasma zu einem späteren Zeitpunkt aussehen wird, ohne wirklich jeden einzelnen zeitlichen Zwischenschritt im Detail ausrechnen zu müssen“, sagt Andreas Ipp. „Und gleichzeitig ist sichergestellt, dass nur solche Ergebnisse herauskommen können, die der Eichsymmetrie nicht widersprechen – die also prinzipiell physikalisch sinnvoll sind.“
Bis man etwa Atomkernkollisionen am CERN mit solchen Methoden vollständig simulieren kann, wird noch einige Zeit vergehen, aber die neue Art neuronaler Netze liefert ein völlig neues und vielversprechendes Werkzeug um physikalische Phänomene zu beschreiben, bei denen alle anderen Rechenmethoden sehr rasch völlig überfordert sind.
Originalpublikation:
M. Favoni, A. Ipp, D. I. Müller, and D. Schuh, Lattice Gauge Equivariant Convolutional Neural Networks, Phys. Rev. Lett. 128, 032003 (2022):
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.032003
Kontakt:
Dr. Andreas Ipp
Technische Universität Wien
Institut für Theoretische Physik
andreas.ipp@tuwien.ac.at
Die Kristall-Formel
Eine besonders harte Nuss in der Theorie der Kondensierten Materie konnte nun geknackt werden: Universität Tübingen, Universität Konstanz und TU Wien berechnen erstmals Korrelationsfunktionen von (Kolloid-)Kristallen.
© Wikimedia Commons, Zephyris, CC BY-SA 3.0
Eine zweidimensionale Anordnung von Colloid-Teilchen. In drei Dimensionen können solche Teilchen würfelartige Strukturen ausbilden.
Die Frage klingt zunächst ganz einfach: Wenn sich ein Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort befindet, mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet es sich dann zu einem anderen Zeitpunkt an einem bestimmten anderen Ort? Die Antwort auf diese Frage beschreibt man mathematisch durch sogenannte „Korrelationsfunktionen“. Sie spielen in der Teilchenphysik und in der Festkörperphysik eine wichtige Rolle.
Leider sind diese Korrelationsfunktionen aber für realistische Situationen extrem schwer zu berechnen, daher musste man sich bisher oft mit groben Näherungen begnügen. Nun gelang aber einem Forschungsteam der Universität Konstanz, der Universität Tübingen und der TU Wien ein wichtiger Durchbruch: Mit großem Computeraufwand schaffte man es, die Korrelationsfunktion eines kubischen Kristalls (wie ihn etwa Kolloidteilchen bilden) explizit zu berechnen. Die Ergebnisse zeigen, dass bisherige Abschätzungen teilweise um Größenordnungen falsch lagen, und sie eröffnen bisher unmögliche Einblicke in die theoretische Materialforschung – etwa in die elastischen Eigenschaften von Kristallen.
Walter Kohns Dichtefunktionaltheorie
Die theoretischen Fundamente des Forschungsprojekts gehen auf den in Wien geborenen Nobelpreisträger und Ehrendoktor der TU Wien Walter Kohn zurück. Er begründete die Dichtefunktionaltheorie, einen für die Festkörperphysik bis heute sehr wichtigen Ansatz, der die elektronischen Eigenschaften von Materialien mit Hilfe der ortsabhängigen Elektronendichte beschreibt, bzw. die strukturellen und thermodynamischen Eigenschaften mit Hilfe der Teilchendichte.
„Die Dichtefunktionaltheorie sagt uns, wie man die Korrelationsfunktionen mathematisch berechnen kann, die für uns entscheidend sind“, erklärt Prof. Gerhad Kahl vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Diese Funktionen liefern uns nicht nur Aussagen über die Struktur und die Thermodynamik bestimmter Kristalle, sondern sie geben auch Auskunft über viele andere relevante Systemeigenschaften, etwa über die Auswirkung von Defekten im Kristallgitter oder zur Elastizität des Materials.“
Ersatzfunktionen: Kein guter Ersatz
Bisherige Versuche, diese Korrelationsfunktionen explizit zu berechnen, waren am immensen numerischen Aufwand gescheitert. Daher verwendete man bisher behelfsmäßig Ersatzfunktionen aus der Theorie der Flüssigkeiten – auch wenn eine Flüssigkeit physikalisch gesehen freilich etwas ganz anderes ist als ein fester Kristall.
Durch die Zusammenarbeit von Uni Konstanz, Uni Tübingen und TU Wien sowie durch einen für Grafikkarten (GPUs) trickreich optimierten Computercode gelang es mit enormem Rechenaufwand nun erstmals, die Korrelationsfunktion von kubischen Kristallstrukturen zu berechnen. Und das Ergebnis zeigt, dass die bisher verwendeten Ersatzfunktionen doch ziemlich große Mängel aufweisen: „Das sehen wir nicht nur daran, dass der Wert der Funktion in weiten Bereichen um Größenordnungen falsch war, sondern auch an Symmetrien und der Richtungsabhängigkeit der Funktion“, erklärt Gerhard Kahl. „Wenn wir unsere Ergebnisse mit Literaturdaten vergleichen, dann können wir außerdem zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Funktionen und der Defektdichte in realen Kristallen gibt. Dass es diesen Zusammenhang geben muss, war bereits bekannt, aber wir konnten diese These nun erstmals mit echten Daten untermauern.“
Präzisere Antworten auf alte Fragen
Das Forschungsprojekt wurde sowohl vom österreichischen FWF als auch von der deutschen DFG finanziell unterstützt. Die Ergebnisse sollen nun helfen, die Theorie von Kristallen besser zu verstehen. Die Korrelationsfunktionen können Auskunft darüber geben, wie etwa Fehler im Kristallgitter, die in der Praxis immer wieder auftreten, die Materialeigenschaften beeinflussen können, und wie sich die Elastizität von Kristallen sowie ihre Abhängigkeit von der Temperatur im Detail verstehen lässt.
Originalpublikation
S.-C. Lin, M. Oettel, J.M. Häring, R. Haussmann, M. Fuchs, and G. Kahl, Direct correlation function of a crystalline solid, Physical Review Letters 127, 085501 (1-7) (2021):
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.085501
Kontakt
Prof. Gerhard Kahl
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Best Distance Learning Award 2021
m Rahmen einer Galaveranstaltung wurden am 7. Oktober bereits zum fünften Mal die Best Teaching Awards im Kuppelsaal der TU Wien überreicht.
Vlnr:
Oben: Benjamin Koch, Daniel Grumiller
Unten: David Andriot, Kirill Boguslavski
Eine besonders herausragende Lehrveranstaltung eines Teams von Lehrenden oder einzelnen Lehrenden mit dem Schwerpunkt auf Distance Learning wird in dieser Kategorie geehrt. 14 Lehrveranstaltungen waren nominiert.
Ausgezeichnet wurden sechs Lehrveranstaltungen mit ihren Lehrendenteams. Die stolzen Gewinner vom Institut für Theoretische Physik sind:
Elektrodynamik I VU
• Univ.Ass. Dr. David Andriot
• Univ.Ass. Dr.rer.nat. Kirill Boguslavski
• Associate Prof. Dr.techn. Daniel Grumiller
• Univ.Ass. Dr.phil.nat. Benjamin Koch
Wir gratulieren sehr herzlich!
Mehr Europa in der Physik
Prof. Joachim Burgdörfer wird Editor-in-Chief des European Physical Journal D. In dieser neuen Funktion möchte er sich für mehr europäisches Selbstbewusstsein in der Wissenschaft einsetzen.
Joachim Burgdörfer
Europa ist in der Wissenschaft eine Weltmacht – oft ist man sich dessen aber gar nicht bewusst. Die European Physical Society (EPS) hat rund 120.000 Mitglieder, mehr als doppelt so viele wie die American Physical Society (APS). Doch in vielen wichtigen Bereichen gibt die US-amerikanische Forschungslandschaft trotzdem den Ton an. So wird etwa die Publikationslandschaft der Physik-Fachjournale immer noch von den Magazinen der APS dominiert.
Prof. Joachim Burgdörfer plädiert daher für mehr europäische Zusammenarbeit. 2016 wurde er Dekan der Fakultät für Physik der TU Wien, diese Aufgabe hat er nun an Prof. Thorsten Schumm abgegeben. Dafür nimmt er nun eine neue Herausforderung an: Er wird Editor-in-Chief des European Physical Journal D des Springer-Nature-Verlags. Gleichzeitig ist Burgdörfer auch Division Chair der European Physical Society. In diesen beiden Funktionen möchte er sich nun für mehr europäisches Denken in der Physik einsetzen.
Prof. Joachim Burgdörfer im Interview
Sie möchten die europäische Forschungslandschaft stärken – aber gibt es die überhaupt?
Burgdörfer: Immer noch wird oft in nationalen Kategorien gedacht. So besteht etwa die European Physical Society aus 42 nationalen physikalischen Gesellschaften, viele Leute wissen gar nicht, dass man auch direkt Mitglied bei der EPS sein kann, ohne Mitglied einer nationalen Teilorganisation zu sein. Aber natürlich gibt es eine europäische Forschungslandschaft – und die ist sehr erfolgreich. Wir sollten uns als Teil eines europäischen Kontinents fühlen, der eine führende Rolle in Technologie und Wissenschaft spielt. Und wir sollten Kommunikations-Plattformen haben, die diesen Führungsanspruch wiederspiegeln, was Qualität und Sichtbarkeit betrifft.
Sie haben selbst lange in den USA geforscht und kennen die amerikanische Forschungslandschaft. Worin besteht eigentlich das Problem an einer US-Dominanz bei wissenschaftlichen Journalen? Warum sollte man hier überhaupt ein Konkurrenzverhältnis sehen?
Burgdörfer: Um Konkurrenzdenken geht es gar nicht. Wir arbeiten ja gerne und mit großem Erfolg mit unseren Freunden in den USA zusammen. Es geht darum, dass Europa die Chancen nutzt, die es aufgrund seiner Größe hat. Ein Beispiel: Die jährlichen Fachkonferenzen der verschiedenen Fachgruppen der American Physical Society sind echte Anziehungspunkte für führende Physiker und Physikerinnen weltweit. Die European Physical Society hat derzeit nichts Vergleichbares anzubieten – und das ist natürlich ein Nachteil, gerade für Studierende oder junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es sich oft nicht leisten können, für solche Konferenzen in die USA zu reisen. Und zu einer verbesserten Kommunikationsinfrastruktur gehört natürlich auch eine gemeinsame starke und unabhängige Publikationslandschaft.
Gibt es so etwas wie eine europäische Identität in der Wissenschaft?
Burgdörfer: Natürlich ist Wissenschaft zuallererst etwas Globales. Aber gleichzeitig gibt es etwa in der Physik bestimmte Forschungsgebiete, die in Europa mehr im Zentrum stehen als in den USA – und umgekehrt. Im Moment wird Europa vielfach in erster Linie als Geldquelle wahrgenommen, wir profitieren von Forschungsförderungen der EU. Aber die Frage soll nicht nur sein: Wo kriegen wir unser Geld her? Sondern auch: Wie stärken wir den europäischen Wissenschaftsraum im globalen Wettbewerb? Und dazu gehört auch: Wo und wie kommunizieren und publizieren wir unsere Ergebnisse?
Text: Florian Aigner
Drei START-Preise für die TU Wien
Laura Donnay, Julian Léonard und Hannes Mikula, drei Nachwuchsforschende der TU Wien, werden vom FWF mit dem prestigeträchtigen START-Preis ausgezeichnet.
Laura Donnay, Julian Léonard und Hannes Mikula (von links) wurden mit dem START-Preis ausgezeichnet.
Der START-Preis gilt als die wichtigste österreichische Auszeichnung für junge Wissenschaftler_innen. Er ist mit bis zu 1,2 Millionen Euro dotiert und soll exzellente Nachwuchswissenschaftler_innen dabei unterstützen, eine eigene Forschungsgruppe auf internationalem Spitzenniveau aufzubauen.
Der österreichische Wissenschaftsfonds FWF gab am 22. Juni das Ergebnis der diesjährigen Preisvergabe bekannt: Gleich drei der insgesamt sechs START-Preise gehen dieses Jahr an die TU Wien. Die Physikerin Laura Donnay wird für ihre Forschung an Schwarzen Löchern ausgezeichnet, Julian Léonard erhält den START-Preis für sein Vorhaben, ein neues Quanten-Computing-Konzept zu realisieren und Hannes Mikula erforscht Möglichkeiten, Tumorzellen gezielt zu bekämpfen – ohne dabei gesunde Zellen zu beschädigen.
Alle drei blicken bereits auf eine hochkarätige, internationale Forschungskarriere zurück – sie alle sind oder waren unter anderem an der Harvard University tätig.
Laura Donnay: Die Symmetrien Schwarzer Löcher
Schwarze Löcher gehören wohl zu den merkwürdigsten Objekten im Weltall und werfen noch immer neue Rätsel auf. Laura Donnay, START-Preisträgerin 2021, möchte daher einige Schlüsselfragen der Physik Schwarzer Löcher aufklären und insbesondere den Ursprung ihrer enormen Entropie verstehen. Den Ansatz, den die junge Forscherin dabei verfolgt, ist erst wenige Jahre alt: Im Jahre 2015 entdeckte Donnay, dass in der Nähe der Ereignishorizonte Schwarzer Löcher unendliche Symmetrien auftreten. Dieses Phänomen wird als „weiches Haar“ (engl. „soft hair“) bezeichnet. Donnay erwartet, dass die dort beobachteten Symmetrien wichtige Einblicke in die Physik Schwarzer Löcher geben.
Um Licht ins Dunkel zu bringe, geht die Physikerin einen einzigartigen Weg und kombiniert zwei Ansätze: Die neu entdeckten Raumzeitsymmetrien und das holographische Prinzip. Letzteres zeigt völlig neue Verbindungen zwischen Gravitationstheorien und Quantenfeldtheorien auf. Es spielt in der theoretischen Physik eine zentrale Rolle, wenn man die fundamentalen Eigenschaften der Quantengravitation entschlüsseln möchte.
Laura Donnay nahm 2007 ihr Studium der Physik an der Université de Liège (Belgien) auf. Ihren Master absolvierte sie an der Université Libre de Bruxelles, an der sie 2016 ebenfalls promovierte. Nach Abschluss ihres Doktorstudiums übersiedelte die Physikerin an die Harvard University (USA), wo sie als Postdoc arbeitete, bis sie 2019 als Marie Sklodowska-Curie-Stipendiatin an die TU Wien wechselte. Sie arbeitet dort nun als Projektassistentin am Institut für Theoretische Physik.
Julian Léonard: Rechnen mit Quantenteilchen
Julian Léonard wechselt mit seinem START-Preis von der Harvard University in den USA ans Atominstitut der TU Wien. In seinem Projekt „OPTIMAL“ möchte er ein neues Quantum-Computing-Konzept realisieren. Damit ein Quantencomputer möglich ist, müssen grundsätzlich zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein: Einerseits benötigt man Quantensysteme, die Information speichern können – etwa einzelne Atome, und andererseits braucht man einen Mechanismus, mit dem man diese Quantenelemente manipulieren und miteinander verschränken kann, denn nur so können Quantenalgorithmen angewandt und Berechnungen durchgeführt werden.
Julian Léonard möchte das erreichen, indem er neutrale Atome zwischen zwei Spiegeln platziert. Es handelt sich um Spezialspiegel mit extrem hoher Reflektivität, sodass Photonen millionenfach hin und her gespiegelt werden können. Auf diese Weise kann man erreichen, dass die Lichtteilchen mit genau den gewünschten Atomen auf genau die richtige Weise wechselwirken, um ganz gezielt verschiedene Atome quantenphysikalisch miteinander zu verschränken und Information zu übertragen. Sowohl Atome als auch Licht müssen sehr präzise kontrolliert werden, um mit einem solchen Konzept Rechenoperationen durchführen zu können – Julian Léonard hat auf beiden Gebieten bereits viel Erfahrung vorzuweisen.
An der TU München begann Julian Léonard Physik zu studieren, schon als Student knüpfte er Kontakte an das Max Planck Institut für Quantenoptik in Garching, seine Diplomarbeit schrieb er dann an der École Normale Supérieure, Paris und Sorbonne Université, Paris. Danach ging er an die ETH Zürich, wo er 2017 sein Doktoratsstudium abschloss. Derzeit ist er Postdoctoral Fellow am Physik-Institut der Harvard University, USA.
Hannes Mikula: Punktgenaue Krebstherapie
Krebszellen zu töten, wäre eigentlich gar nicht so schwierig. Die große Herausforderung in der Krebstherapie besteht darin, andere Zellen zu schonen. Wenn nicht nur Tumorzellen, sondern auch gesunde Zellen angegriffen werden, kann das zu schweren Nebenwirkungen führen.
Hannes Mikula möchte in seinem Forschungsprojekt an chemischen Methoden arbeiten, Wirkstoffe zielgerichtet in Krebszellen zu transportieren – und nirgendwo anders hin. Man entwickelt daher spezielle Moleküle und Reaktionen, mit denen der Wirkstoff in die Krebszelle transportiert und erst dann freigesetzt werden kann, wenn er am Zielort angekommen ist. Um das zu erreichen, sollen chemische Kaskaden entwickelt werden: Das Transportmolekül muss nicht nur an der Krebszelle andocken und den Wirkstoff abgeben, man muss auch sicherstellen, dass das Wirkstoffmolekül dann tatsächlich in die Krebszelle eingeschleust und nicht versehentlich von benachbarten, gesunden Zellen aufgenommen wird. Mikula wird dazu mit seinem Team am Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien mehrstufige chemische Prozesse entwickeln, die es ermöglichen sollen, Wirkstoffe in einer zellulären Umgebung gezielt navigieren zu können.
Hannes Mikula studierte Technische Chemie an der TU Wien, danach war er als Universitätsassistent am Institut für Angewandte Synthesechemie (IAS) der TU Wien tätig. 2013 schloss er sein Doktoratsstudium an der TU Wien mit einer Promotio sub auspiciis ab. Bis 2014 war er Postdoc am IAS und wechselte dann als Schrödinger Fellow ans Center for Systems Biology, Massachusetts General Hospital & Harvard Medical School, bevor er 2016 wieder an die TU Wien zurückkehrte, wo er in den letzten Jahren als Assistant Professor seine eigene Gruppe aufgebaut hat.
Kontakt:
Laura Donnay, PhD
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
laura.donnay@tuwien.ac.at
Julian Léonard, PhD
Harvard University
leonard@fas.harvard.edu
Ass. Prof. Dr. Hannes Mikula
Institut für Angewandte Synthesechemie
Technische Universität Wien
hannes.mikula@tuwien.ac.at
Stefan Donsa - sub auspiciis Promotionen am 14. Juni 2021 an der TU Wien
Fünf Absolventen der TU Wien wurden am 14. Juni 2021 im Rahmen der sub auspiciis Promotionen für ihre herausragenden Leistungen in Schule und Studium geehrt. Dr. Michael Ludwig verlieh in Vertretung von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen den Ehrenring der Republik Österreich.
© Thomas Blazina / TU Wien
Gerald Berger, Bürgermeister Michael Ludwig, Martin Riedler, Rektorin Sabine Seidler, Tomas Peitl, Vizerektor Kurt Matyas, Michael Wais, Stefan Donsa (von links)
Im Kuppelsaal der TU Wien wurden zum „Doktor der Technischen Wissenschaften“ promoviert:
DI Stefan Donsa BSc
Dissertationsthema: Ionization phases and electron angular distributions of multielectron atoms probed by attosecond pulses
Fakultät für Physik, Institut für Theoretische Physik
Dissertationsbetreuung: O.Univ.Prof. Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Joachim Burgdörfer
DI Gerald Berger BSc
Dissertationsthema: Static Analysis for Ontology-Mediated Querying
Fakultät für Informatik, Institut für Logic and Computation
Dissertationsbetreuung: O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Georg Gottlob
DI Martin Riedler BSc
Dissertationsthema: Advances in Decomposition Approaches for Mixed Integer Linear Programming
Fakultät für Informatik, Institut für Logic and Computation
Dissertationsbetreuung: Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Raidl
DI Michael Wais BSc
Dissertationsthema: Building Solids for Function
Fakultät für Physik, Institut für Festkörperphysik
Dissertationsbetreuung: Univ.Prof. Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Karsten Held
Mgr Tomas Peitl Bc
Dissertationsthema: Quantified Boolean formulas (QBF), AI, Automated theorem proving, Computational Complexity Theory
Fakultät für Informatik, Institut für Logic and Computation
Dissertationsbetreuung: Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dr.rer.nat. Stefan Szeider
DI Stefan Donsa BSc
Nach Abschluss des Gymnasiums Friesgasse, kam Stefan Donsa an die TU Wien und entschied sich für ein Bachelor- und Masterstudium an der Fakultät für Physik. Danach schloss Donsa ein Doktorratsstudium an und verbrachte 5 Monate davon an der University of Central Florida. Seit 2016 ist er als Projektassistent am Institut für theoretische Physik an der TU Wien tätig.
3 Fragen an Stefan Donsa
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die sub auspiciis-Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?
Mein Umfeld hat sich über meine Promotion sehr gefreut, ob sub auspiciis ist oder nicht hat keinen großen Unterschied gemacht. Die Bezeichnung sub auspiciis war im privaten Umfeld nicht vielen ein Begriff, noch viel weniger welche Bedingungen dafür genau erfüllt werden müssen.
Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?
Ich verbringe gerne Zeit in der Natur, genieße es im Zelt unter dem Sternenhimmel zu schlafen, einen Tag bei einem knisternden Lagerfeuer ausklingen zu lassen, oder von Bergspitzen in die Ferne blicken zu können. Als Ausgleich zur Ruhe in den Bergen, verbringe ich meine Zeit als Jugendleiter bei den Pfadfindern und auf Konzerten von Metalcore, über Hip-Hop bis zu Pop-Punk.
Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend – zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: wer wäre das und wieso?
Ich würde mich mit Arthur Schnitzler treffen, und mit ihm über Wien zwischen 1880 und 1930 sprechen. Seine Einblicke in das Leben und dessen Veränderung in Wien vor und nach der Jahrhundertwende geben sicherlich spannende Einblicke, weit über das hinaus, was man in Geschichtsbüchern lesen kann.
DI Gerald Berger BSc
Der gebürtige Oberösterreicher kam nach Abschluss der HTL Grießkirchen nach Wien und begann an der TU Wien ein Bachelorstudium an der Fakultät für Informatik. Er schloss ein Masterstudium und ein Doktoratsstudium an derselben Fakultät ab. Neben seinem Studium arbeitete Berger als Tutor und Vortragender an der TU Wien sowie als Gast-Vortragender an der Uni Wien.
3 Fragen an Gerald Berger
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die sub auspiciis-Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?
Die meisten konnten mit dem Begriff etwas anfangen, jedoch wunderte es manche, warum ich nach absolviertem Rigorosum noch keinen Doktortitel führen durfte – besonders, da sich ja aufgrund der COVID19-Pandemie die Promotion um zwei Jahre verzögerte.
Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?
Ich lese gerne, treibe gerne Sport (im Winter am liebsten Skisport). Falls sich Gelegenheiten ergeben und meine Geschicklichkeit es erlaubt, handwerke ich gerne. Ist das Glück auf meiner Seite, so habe ich auch nichts gegen das ein oder andere Kartenspiel.
Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend – zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: wer wäre das und wieso?
Da Sie explizit Kaffee erwähnen und nun die Wiener Kaffeehäuser wieder aufgesperrt haben, denke ich da an Stefan Zweig, der ja interessante Eindrücke – auch aus „Kaffeehaussicht“ – über „die Welt von gestern“ hinterließ. Es wäre spannend zu erfahren, welchen Eindruck er von „der Welt von heute" hat.
DI Martin Riedler BSc
Der gebürtige Oberösterreicher Martin Riedler spezialisierte sich an der TU Wien ebenfalls auf das Thema Informatik und entschied sich nach einem Bachelor- und Masterstudium für ein Doktorat in diesem Fach. Er arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Wien und hat auch Erfahrung als Vortragender an der TU Wien.
3 Fragen an Martin Riedler
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die sub auspiciis-Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?
Innerhalb der Familie war die Auszeichnung den meisten bereits ein Begriff und es wurde stets mitverfolgt, dass ich mit jedem Schritt meiner schulischen und akademischen Laufbahn, die weiteren Bedingungen erfüllte. Weniger klar war hingegen, ob ich jemals ein Doktorstudium beginnen würde. Dies entschied sich erst gegen Ende des Masterstudiums.
Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?
Auch außerhalb der Arbeit in der Informatik zieht es mich immer wieder zum Computer, um mit einem Computerspiel zu entspannen. Als Ausgleich dazu betreibe ich regelmäßig Sport, um mich im Gegensatz zur geistigen Arbeit auch körperlich fit zu halten. Darüber hinaus verreise ich gerne und hoffe, dass dies bald wieder möglich sein wird.
Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend – zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: wer wäre das und wieso?
In Geschichte und Gegenwart gibt es zahllose interessante Persönlichkeiten, mit denen man spannende Unterhaltung führen könnte. Daraus nur eine auszuwählen, scheint schier unmöglich. Als Beispiel möchte ich hier den Mathematiker George Dantzig nennen, der mit der Entwicklung des Simplex-Verfahrens den Grundstein für die lineare Optimierung legte und damit einer der Väter meines Forschungsgebiets ist.
DI Michael Wais BSc
Nach Abschluss der HTL Hollabrunn, entschied sich Michael Wais für ein Bachelorstudium an der Fakultät für Physik an der TU Wien. Er setze mit einem Masterstudium der gleichen Fachrichtung fort und schloss danach noch ein Doktorratsstudium an derselben Fakultät an. Zu Forschungszwecken für seine Doktorarbeit verbrachte er 6 Monate in Singapur. Wais blickt auch auf eine vier-jährige Erfahrung als Projekt-Assistent an der TU Wien zurück. Er forschte im Bereich computational non-equlibrium dynamics. Über dieses Fachgebiet verfasste er auch seine Doktorarbeit.
3 Fragen an Michael Wais
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die sub auspiciis-Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?
Meine Familie hat sich natürlich sehr gefreut und da ich der erste in der Familie bin, der an der Universität studiert und promoviert hat, habe ich tatsächlich erst einmal erklären müssen, worum es bei der Promotion Sub Auspiciis überhaupt geht.
Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?
Meine Leidenschaft abseits der Physik liegt im Karate, das ich bereits seit meiner Kindheit ausübe. Es stellt für mich einen wichtigen Ausgleich zu meiner geistigen Arbeit dar und hat mich gelehrt, nie aufzugeben auch wenn es anstrengend wird. Das hat mir sicherlich beim Abschluss des Doktorats sehr geholfen.
Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend – zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: wer wäre das und wieso?
Da gibt es einige, aber da es in meiner Doktorarbeit hauptsächlich um die Lösung der Boltzmann-Gleichung gegangen ist, wäre natürlich Ludwig Boltzmann naheliegend. Da die vollständige Lösung seiner berühmten Gleichung zu seinen Lebzeiten abseits von Spezialfällen undenkbar war, würde es mich sehr interessieren was er zu den numerischen Resultaten die wir präsentieren zu sagen hätte.
Mgr Tomas Peitl Bc
Der gebürtige Slowake Tomas Peitl absolvierte sein Bachelor- und Masterstudium im Fachbereich Mathematik an der Universität in Bratislava und kam im Jahr 2015 nach Österreich, um an der TU Wien sein Doktorratsstudium an der Fakultät für Informatik zu machen. Peitl hat unter anderem an Universitäten in Kanada und Deutschland geforscht und war 4 Jahre an der TU Wien als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Derzeit forscht er als Postdoc Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller Universität in Deutschland.
3 Fragen an Tomas Peitl
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das genau ist?
Da ich aus der Slowakei und nicht aus Österreich komme, hatten meine Familie und meine Freunde bisher von so einer Auszeichnung noch nichts gehört. Nachdem ich ihnen erklärt habe, was sub auspiciis für eine Auszeichnung ist, bekam ich viele Glückwünsche, manche haben sich auch ein wenig über die Größe der Zeremonie lustig gemacht.
Wo liegt Ihre Leidenschaft/Ihr Interesse, und zwar außerhalb Ihres Fachgebiets?
Meine Lieblingsbeschäftigung ist das Schachspielen. Ich gehe auch gerne wandern und bin sehr interessiert an jeder Art Transport, auch im Hinblick auf die Anwendung in mathematischen Theorien.
Wenn Sie sich mit einer bekannten/berühmte Persönlichkeit – bereits verstorben oder noch lebend – zu einer Plauderei bei Kaffee treffen könnten: wer wäre das und wieso?
Ich würde gerne den slowakischen Ökologen, Umweltschützer und Filmemacher Erik Baláž treffen. Ich bewundere ihn für seine Vision und seinen Einsatz, die Natur zu schützen und Naturwildnis zu bewahren, um das Klima zu schützen und die Vielfältigkeit der Natur zu zeigen.
Wie man als Einzeller ans Ziel gelangt
Wie gelingt es einfachen Lebewesen, sich aus eigener Kraft gezielt an einen bestimmten Ort zu bewegen? Künstliche Intelligenz und ein physikalisches Modell der TU Wien können das erklären.
Der Einzeller nimmt wahr, in welcher Richtung die Nahrungskonzentration höher ist.
Von links nach rechts: Benedikt Hartl, Andreas Zöttl, Maximilian Hübl, Gerhard Kahl
Wie ist es ohne Gehirn und Nervensystem möglich, sich gezielt in die gewünschte Richtung zu bewegen? Einzellern gelingt dieses Kunststück offenbar problemlos: Sie können sich zum Beispiel mit Hilfe kleiner Geißelschwänzchen (den sogenannten Flagellen) fortbewegen und ganz gezielt in jene Richtung schwimmen, in der es am meisten Nahrung gibt.
Wie das diesen extrem einfach gebauten Lebewesen gelingt, war bisher nicht ganz klar. Ein Forschungsteam der TU Wien konnte diesen Prozess nun allerdings am Computer simulieren: Man berechnete die physikalische Wechselwirkung zwischen einem ganz einfachen Modell-Organismus und seiner Umgebung. Diese Umgebung ist eine Flüssigkeit mit uneinheitlicher chemischer Zusammensetzung, sie enthält Nahrungsquellen, die ungleichmäßig verteilt sind. Der Organismus wurde mit der Fähigkeit ausgestattet, auf ganz simple Weise Information über Nahrung in seiner Umgebung zu verarbeiten. Mit Hilfe eines Machine-Learning-Algorithmus wurde die Informationsverarbeitung des virtuellen Wesens dann in vielen Evolutionsschritten verändert und optimiert. Das Resultat war ein Computer-Organismus, der sich bei seiner Nahrungssuche ganz ähnlich bewegt wie seine realen Vorbilder.
Chemotaxis: Immer dorthin, wo die Chemie stimmt
„Auf den ersten Blick ist es überraschend, dass ein derartig einfaches Modell eine so schwierige Aufgabe lösen kann“, sagt Andras Zöttl, der das Forschungsprojekt leitete, welches im Bereich „Theorie der Weichen Materie“ (Arbeitsgruppe Gerhard Kahl) am Institut für Theoretische Physik der TU Wien durchgeführt wurde. „Bakterien können durch Rezeptoren feststellen, in welcher Richtung etwa die Sauerstoff- oder die Nährstoffkonzentration zunimmt, und diese Information löst dann eine Bewegung in die gewünschte Richtung aus. Man bezeichnet das als Chemotaxis.“
Das Verhalten von anderen, mehrzelligen Lebewesen kann man über die Verschaltung von Nervenzellen erklären. Doch ein Einzeller hat keine Nervenzellen – in diesem Fall sind nur extrem einfache Verarbeitungsschritte innerhalb der Zelle möglich. Bisher war nicht klar, wie ein derart geringer Grad an Komplexität ausreichen kann, um simple Sinneseindrücke – etwa von chemischen Sensoren – mit zielgerichteter Motorik in Verbindung zu bringen.
„Um das erklären zu können, braucht man ein realistisches, physikalisches Modell für die Bewegung dieser Einzeller“, sagt Andreas Zöttl. „Wir haben das einfachstmögliche Modell gewählt, das eigenständige Bewegung in einer Flüssigkeit physikalisch überhaupt erst erlaubt. Unser Einzeller besteht aus drei durch vereinfachte Muskeln miteinander verbundenen Massen. Es stellt sich nun die Frage: Können diese Muskeln so koordiniert werden, dass sich der gesamte Organismus in die gewünschte Richtung bewegt? Und vor allem: Ist dieser Prozess auf einfache Weise realisierbar, oder braucht es dazu eine komplizierte Steuerung?“
Ein kleines Netz aus Signalen und Befehlen
„Auch wenn der Einzeller kein Netz aus Nervenzellen hat – die logischen Schritte, die seine ,Sinneseindrücke‘ mit seiner Bewegung verknüpfen, lassen sich mathematisch auf ähnliche Weise beschreiben wie ein neuronales Netz“, ergänzt Benedikt Hartl, der mit seiner Expertise in künstlicher Intelligenz das Modell am Computer umgesetzt hat. Auch im Einzeller gibt es logische Verbindungen zwischen unterschiedlichen Elementen der Zelle. Chemische Signale werden ausgelöst und führen am Ende zu einer bestimmten Bewegung des Organismus‘.
„Diese Elemente und die Art, wie sie sich gegenseitig beeinflussen, wurden am Computer simuliert und mit einem genetischen Algorithmus angepasst: Generation für Generation wurde die Bewegungsstrategie der virtuellen Einzeller leicht verändert“, berichtet Maximilian Hübl, der viele der Rechnungen zu diesem Thema im Rahmen seiner Masterarbeit durchgeführt hat. Jene Einzeller, denen es am besten gelang, ihre Bewegung dorthin zu steuern, wo sich die gewünschten Chemikalien befanden, durften sich bevorzugt „fortpflanzen“, die weniger erfolgreichen Varianten „starben aus“. So entstand – ganz ähnlich wie in der biologischen Evolution – nach vielen Generationen ein Steuerungsnetzwerk, das es einem virtuellen Einzeller erlaubt, auf extrem einfache Weise und mit ganz wenigen Verschaltungen, chemische Wahrnehmungen selbstständig in zielgerichtete Bewegung umzusetzen.
Zufällige Wackelbewegung – aber mit konkretem Ziel
„Man darf sich das nicht so vorstellen, wie ein hochentwickeltes Tier, das bewusst etwas wahrnimmt und dann genau darauf zuläuft“, sagt Andreas Zöttl. „Es ist eher eine zufällige Wackelbewegung. Aber eben eine, die letztendlich im Mittel in die richtige Richtung führt. Und genau das beobachtet man auch bei Einzellern in der Natur.“
Die Computersimulationen und die algorithmischen Konzepte, die vor kurzem in der renommierten Zeitschrift PNAS publiziert wurden, beweisen, dass ein minimaler Komplexitätsgrad des Steuerungsnetzwerkes tatsächlich genügt, um relativ komplex erscheinende Bewegungsmuster umzusetzen. Berücksichtigt man die physikalischen Bedingungen korrekt, dann genügt eine bemerkenswert einfache innere Maschinerie, um im Modell genau jene Bewegungen zu reproduzieren, die man aus der Natur kennt.
Originalpublikation:
B. Hartl et al., Microswimmers learning chemotaxis with genetic algorithms, PNAS, 2021 118 (19):
https://www.pnas.org/content/118/19/e2019683118
Kontakt:
Dr. Andreas Zöttl
Institut für Theoretische Physik
andreas.zoettl@tuwien.ac.at
Der unverwüstliche Lichtstrahl
TU Wien und Universität Utrecht erzeugen spezielle Lichtwellen, die selbst undurchsichtige Materialien so durchdringen können als wäre das Material gar nicht vorhanden.
© Allard Mosk/Matthias Kühmayer
© Allard Mosk/Matthias Kühmayer
Der Lichtstrahl durchdringt ein ungeordnetes Medium und erzeugt am Detektor trotzdem dasselbe Bild als wäre das Medium gar nicht da.
Warum ist Zucker nicht durchsichtig? Weil Licht, das ein Stück Zucker durchdringt, auf hochkomplizierte Weise gestreut, verändert und abgelenkt wird. Wie ein Forschungsteam der TU Wien und der Universität Utrecht (Niederlande) nun zeigen konnte, gibt es allerdings eine Klasse ganz spezieller Lichtwellen, für die das nicht gilt: Für jedes spezifische ungeordnete Medium – wie etwa das Stück Würfel-Zucker das Sie vielleicht gerade in Ihren Kaffee gegeben haben – lassen sich maßgeschneiderte Lichtstrahlen konstruieren, die von diesem Medium praktisch nicht verändert, sondern nur abgeschwächt werden. Der Lichtstrahl durchdringt das Medium und auf der anderen Seite kommt ein Lichtmuster an, das dieselbe Form hat, als wäre das Medium gar nicht da. Diese Idee der „streuungsinvarianten Lichtmoden“ lässt sich auch verwenden, um das Innere von Objekten gezielt zu untersuchen. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Photonics“ publiziert.
Astronomisch viele mögliche Wellenformen
Die Wellen auf einer turbulenten Wasseroberfläche können unendlich viele verschiedene Formen annehmen – und auf ähnliche Weise kann man auch Lichtwellen in unzähligen unterschiedlichen Formen herstellen. „Jedes dieser Lichtwellenmuster wird auf ganz bestimmte Weise verändert und abgelenkt, wenn man es durch ein ungeordnetes Medium schickt“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Gemeinsam mit seinem Team entwickelt Stefan Rotter mathematische Methoden, um solche Lichtstreuungseffekt zu beschreiben. Die Expertise zur Herstellung und Charakterisierung solch komplexer Lichtfelder wurde vom Team um Prof. Allard Mosk von der Universität Utrecht beigesteuert. „Als lichtstreuendes Medium verwendeten wir eine Schicht aus Zinkoxid – ein undurchsichtiges, weißes Pulver aus völlig zufällig angeordneten Nanopartikeln.“, erläutert Prof. Allard Mosk, der Leiter der experimentellen Forschungsgruppe.
Zunächst muss man diese Schicht genau charakterisieren. Man durchleuchtet das Zinkoxidpulver mit ganz bestimmten Lichtsignalen und misst, wie sie dahinter am Detektor ankommen. Daraus kann man dann schließen, wie beliebige andere Wellen von diesem Medium verändert werden – insbesondere kann man ganz gezielt berechnen, welche Wellenmuster von dieser Zinkoxidschicht genau so verändert werden, als wäre überhaupt keine Wellenstreuung in dieser Schicht vorhanden.
„Wie wir zeigen konnten, gibt es eine ganz spezielle Klasse von Lichtwellen, die sogenannten streuungsinvarianten Lichtmoden, die am Detektor genau dasselbe Wellenmuster erzeugen, egal ob die Lichtwelle nur durch Luft geschickt wurde oder ob sie die komplizierte Zinkoxidschicht durchdringen musste“, sagt Stefan Rotter. „Im Experiment sehen wir, dass durch das Zinkoxid die Form dieser Lichtwellen tatsächlich nicht verändert wird – sie werden nur insgesamt ein wenig schwächer.“, erläutert Allard Mosk.
Ein Sternbild am Lichtdetektor
Auch wenn diese streuungsinvarianten Lichtmoden angesichts der theoretisch unbegrenzten Zahl möglicher Lichtwellen sehr selten sind, kann man trotzdem viele von ihnen finden. Und wenn man verschiedene dieser streuungsinvarianten Lichtmoden richtig kombiniert, erhält man wieder eine streuungsinvariante Wellenform.
„Auf diese Weise kann man sich, zumindest innerhalb gewisser Grenzen, ziemlich frei aussuchen, welches Bild man störungsfrei durch das Objekt schicken möchte“, sagt Jeroen Bosch, der als Doktorand am Experiment arbeitete. „Wir haben uns im Experiment für das Beispiel eines Sternbilds entschieden – den großen Wagen. Und tatsächlich ließ sich eine streuungsinvariante Welle ermitteln, die ein Bild vom großen Wagen zum Detektor schickt – und zwar unabhängig davon, ob die Lichtwelle von der Zinkoxidschicht gestreut wird oder nicht. Für den Detektor sieht der Lichtstrahl in beiden Fällen fast gleich aus.“
Der Blick in die Zelle
Diese Methode, Lichtmuster zu finden, die ein Objekt weitgehend ungestört durchdringen, könnte man auch für bildgebende Verfahren einsetzen. „Im Krankenhaus verwendet man Röntgenstrahlen um in den Körper hineinzusehen – sie haben eine kürzere Wellenlänge und können daher unsere Haut durchdringen. Aber die Art, wie eine Lichtwelle ein Objekt durchdringt, hängt eben nicht nur von der Wellenlänge ab, sondern auch von der Wellenform“, sagt Matthias Kühmayer, der sich im Rahmen seiner Dissertation an der TU Wien mit Computer-Simulationen von Wellenphänomenen beschäftigt. „Wenn man Licht im Inneren eines Objekts an bestimmten Punkten fokussieren will, dann eröffnet unsere Methode ganz neue Möglichkeiten. Wir konnten zeigen, dass sich auch die Lichtverteilung im Inneren der Zinkoxidschicht gezielt steuern lässt.“ Interessant könnte das etwa für biologische Experimente sein, bei denen man Licht an ganz bestimmten Punkten einbringen möchte, um tief in das Innere von Zellen zu blicken.
Die gemeinsame Publikation des Teams aus den Niederlanden und Österreich zeigt jedenfalls schon jetzt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit zwischen Theorie und Experiment ist, um in diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen.
Originalpublikation:
P. Pai, J. Bosch, M. Kühmayer, S. Rotter, A.P. Mosk; Scattering invariant modes of light in complex media, Nature Photonics (2021):
https://www.nature.com/articles/s41566-021-00789-9
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
TU Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Myon-Magnetismus: Hinweise auf „neue Physik“?
Die Spannung bleibt groß: Am 7. April um 17:00 Uhr wurden lang erwartete Messergebnisse über das magnetische Moment von Myonen bekanntgegeben. Eines vorweg, es bleibt spannend. Auch an der TU Wien wird daran intensiv geforscht.
© CERN
Atmosphärische Myonen kann man in sogenannten Funkenkammern sichtbar machen – wie hier im Besucherzentrum des CERN.
Es klingt paradox: Das große Problem der modernen Teilchenphysik ist ihr eigener großer Erfolg. Messungen und theoretische Berechnungen stimmen mit ungeheurer Präzision überein – teilweise auf 12 Dezimalstellen genau. Doch weitere Fortschritte in der Teilchenphysik sind nur dann möglich, wenn man Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment entdeckt. Daher ist das weltweite Interesse immer besonders groß, wenn neue Experimente dem bisher bekannten „Standardmodell der Teilchenphysik“ zu widersprechen scheinen.
Eines der Ergebnisse, die seit Jahren im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, ist das magnetische Moment der Myonen. Myonen sind Elementarteilchen, die durch die kosmische Strahlung in der Erdatmosphäre erzeugt werden und uns ständig durchdringen. Gelegentlich (aber sehr selten) können sie auch unsere Zellen schädigen, denn im Gegensatz zu den ebenfalls allgegenwärtigen Neutrinos sind die Myonen elektrisch geladen. Dadurch haben sie auch magnetische Eigenschaften. Lange herbeigesehnte neue Daten über das magnetische Moment der Myonen werden am Abend des 7. April (mitteleuropäischer Zeit) in den USA bekanntgegeben. Wichtige theoretische Arbeiten dazu kommen auch von der Forschungsgruppe von Prof. Anton Rebhan an der TU Wien.
© BNL-Experiment, Fermilab
Theorie und Experiment: Extreme Präzision ist nötig
Das bisher präziseste Experiment zum Myon-Magnetismus wurde am Brookhaven National Lab im Bundesstaat New York vor 20 Jahren durchgeführt. „Es ergab eine Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment in der neunten Dezimalstelle“, sagt Anton Rebhan. „Das ist immer noch eine extrem präzise Übereinstimmung, aber in diesem Fall ist das bereits eine Abweichung, die groß genug ist, um die Hoffnung auf völlig neuartige, spannende Physik zu wecken.“
Es ist der bisher vielleicht hartnäckigste Hinweis auf Physik jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Um diesen Hinweis zu erhärten, ist es aber nötig, dass er von einem unabhängigen weiteren Experiment bestätigt wird. Daran wurde mit großem Aufwand seit 8 Jahren am Fermilab bei Chicago gearbeitet. Man verwendet nicht Myonen der kosmischen Strahlung, stattdessen werden die instabilen Teilchen eigens für das Experiment erzeugt. In einem Speicherring werden sie in einem extrem starken und gleichförmigen Magnetfeld festgehalten.
Parallel zu diesen experimentellen Anstrengungen arbeiteten während der letzten Jahrzehnte zahlreiche theoretische Forschungsgruppen an einer Präzisierung der theoretischen Vorhersage. Auch das Forschungsteam von Prof. Anton Rebhan am Institut für Theoretische Physik der TU Wien steuerte bedeutsame Ergebnisse bei.
© Anton Rebhan, TU Wien
Lösung durch höhere Dimensionen
„Man muss viele einzelne Beiträge aufsummieren, um ein exaktes Ergebnis zu erhalten. Einer davon, in dem die Streuung von Licht an Licht eine Rolle spielt, bereitete dabei zuletzt größeres Kopfzerbrechen und führte zu teils heftigen Kontroversen“, sagt Anton Rebhan.
Seit längerer Zeit war bekannt, dass bisherige Modelle gravierende Probleme hatten. Sie waren mathematisch in sich widersprüchlich. „Wir konnten zeigen, dass sich diese Widersprüche auflösen lassen, wenn unendlich viele Beiträge von speziellen Elementarteilchen, den Axialvektor-Mesonen, aufsummiert werden“, erklärt Anton Rebhan. Im Dezember 2019 veröffentlichte er zusammen mit seinem Doktoranden Josef Leutgeb die erste Rechnung, bei der das gelang.
Dafür wurden nicht nur die Methoden der Quantenfeldtheorie verwendet, sondern man griff auch auf die Prinzipien der Stringtheorie zurück. „Dabei kommt ein höherdimensionaler gekrümmter Raum ins Spiel, und daraus ergeben sich technische Tricks, mit denen man die unendlich vielen Teilchenanregungen aufsummieren kann“, sagt Rebhan.
Nur wenige Tage nach Leutgeb und Rebhan veröffentlichte eine Forschungsgruppe aus Italien, Deutschland und Frankreich unabhängig davon ein gleichlautendes Ergebnis. Diese Berechnungen bestätigen, dass die theoretische Vorhersage für das magnetische Moment von Myonen statistisch extrem signifikant vom bisher besten experimentellen Ergebnis am Brookhaven National Laboratory abweicht.
Mit der Enthüllung des Resultats des neuen Experiments am Fermilab in Chicago, bei dem eine viermal höhere Genauigkeit angestrebt wird, wird sich zeigen, ob die Diskrepanz zwischen Theorie und experimentellen Daten vielleicht doch geringer ausfällt – oder ob sie sogar noch größer ist, als bisher gedacht. Die neuen Ergebnisse werden auf der ganzen Welt mit Spannung erwartet, in jedem Fall werden sie den weiteren Lauf der Forschung in der Teilchenphysik maßgeblich beeinflussen.
Ausführlichere Informationen:
http://www.itp.tuwien.ac.at/Myon_g-2
Zum Stream der offiziellen Verlautbarung der neuen Ergebnisse am 7. April:
https://theory.fnal.gov/events/event/first-results-from-the-muon-g-2-experiment-at-fermilab/
UPDATE (vom 7. April 2021)
Am 7. April 2021, 10 Uhr Chicago-Zeit, 17 Uhr MEST, wurden bei einem speziellen Seminar am Fermilab die ersten Resultate des neuen Muon g-2 Experiment enthüllt:
Das neue Muon-g-2-Experiment am Fermilab hat also die Genauigkeit des alten BNL-Experiments erreicht und ein klein wenig übertroffen. Die Abweichung von der Standardmodell-Vorhersage ist zwar leicht reduziert, bleibt aber bestehen, bei nun 3,3 Standardabweichungen. Beide Experimente sind durch statistische Fehler dominiert. Kombiniert man die Datensätze, erhöht sich sogar die Signifikanz der Abweichung vom Standardmodell auf 4,2 Standardabweichungen.
Das Fermilab-Experiment hat allerdings bereits sehr viel mehr Daten genommen, als für dieses erste Ergebnis verwendet wurden. In 1½-2 Jahren soll das Ziel erreicht werden, die Genauigkeit um den angestrebten Faktor 4 zu erreichen. Bleiben Theorie und Experiment weiterhin innerhalb ihrer jeweiligen Fehlerbalken, sollte der kritische Pegel von 5 Standardabweichungen, der für eine definitive Entdeckung traditionell gefordert wird, dann erreicht sein.
PS: Zwei Theorie-Updates, auch am 7. April 2021 lanciert
Das Datum der Enthüllung der Fermilab-Ergebnisse haben auch zwei Gruppen von theoretischen Physikern genützt, um neue Resultate öffentlichkeitswirksam zu publizieren:
- Auf Nature wurden die schon vor einem Jahr als Preprint erschienen Ergebnisse der sogenannten BMW-Kollaboration (Budapest-Marseille-Wuppertal) publiziert, die in numerischen Simulationen einen vom Theorie-Konsens abweichenden höheren Beitrag der oben kurz erwähnten hadronischen Vakuumpolarisation erhielten. Dieser würde die Diskrepanz zwischen Standardmodell und den g-2-Experimenten fast komplett eliminieren.
- Allerdings wurde bereits letztes Jahr in dieser Publikation (und auch hier) darauf hingewiesen, dass es damit an einer anderen Stelle zu Diskrepanzen zwischen Theorie und Experiment kommen würde, nämlich bei den Präzisionsexperimenten zur elektroschwachen Wechselwirkung.
- Es bleibt abzuwarten, ob andere Gruppen die Ergebnisse der BMW-Gruppe mit der von letzterer behaupteten Genauigkeit reproduzieren können, wie auch die Nature News Meldung dazu hervorhebt und stattdessen die Hinweise auf Neue Physik betont.
- Zur oben hauptsächlich besprochenen hadronischen Licht-an-Lichtstreuung und ihrem Beitrag zum Myon-Magnetismus erschienen ebenfalls neue Resultate von numerischen Simulationen als Preprint. Diese bestätigen aber die bisherigen theoretischen Ergebnisse innerhalb der abgeschätzten Fehler. Numerisch sind die neuen Ergebnisse allerdings etwas größer und passen damit perfekt zu den Ergebnissen von Leutgeb und Rebhan, denen zufolge der Beitrag von Axialvektormesonen zuvor unterschätzt wurde.
Kontakt:
Prof. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
anton.rebhan@tuwien.ac.at
Moiré-Effekt: Wie man Materialeigenschaften verdrehen kann
2D-Materialien haben einen Boom in der Materialforschung ausgelöst. Nun zeigt sich: Spannende Effekte treten auf, wenn man zwei solche Schichtmaterialien aufeinander stapelt und leicht verdreht.
© Erik Zumalt, Lukas Linhart
Die Entdeckung des Materials Graphen, das nur aus einer einzigen Lage von Kohlenstoffatomen besteht, war der Startschuss für ein weltweites Forschungswettrennen: Aus unterschiedlichen Atomsorten stellt man heute sogenannte „2D-Materialien“ her – atomar dünne Schichten, die oft ganz besondere Materialeigenschaften aufweisen, wie man sie in herkömmlichen, dickeren Materialien nicht findet.
Nun wird diesem Forschungsbereich ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Wenn man nämlich zwei solche 2D-Schichten im richtigen Winkel stapelt, ergeben sich nochmals neue Möglichkeiten. Durch die Art, in der die Atome der beiden Schichten interagieren, entstehen komplizierte geometrische Muster, und diese Muster haben entscheidende Auswirkungen auf die Materialeigenschaften, wie ein Forschungsteam der TU Wien und der Universität von Texas (Austin) nun zeigen konnte. Phononen – die Gitterschwingungen der Atome – werden ganz wesentlich durch den Winkel beeinflusst, in dem man die beiden Materialschichten aufeinander legt. Somit kann man mit winzigen Drehungen einer solchen Schicht die Materialeigenschaften maßgeblich verändern.
Der Moiré-Effekt
Die entscheidende Grundidee kann man zu Hause mit zwei Stück Fliegengitter ausprobieren – oder mit anderen regelmäßigen Strukturen, die man übereinanderlegen kann: Wenn beide Gitter perfekt deckungsgleich aufeinanderliegen, kann man von oben betrachtet kaum erkennen, ob es sich um ein oder zwei Gitter handelt. An der Regelmäßigkeit der Struktur hat sich nichts geändert.
Wenn man nun aber eines der Gitter um einen kleinen Winkel dreht, dann gibt es Stellen, an denen die beiden Gitter ungefähr zueinanderpassen, und andere Stellen, an denen sie ungefähr gegengleich zu liegen kommen. So kann man interessante Muster erzeugen – das ist der bekannte Moiré-Effekt.
„Genau dasselbe kann man auch mit den Atomgittern zweier Materialschichten machen“, sagt Dr. Lukas Linhart vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Das Bemerkenswerte daran ist, dass sich dadurch bestimmte Materialeigenschaften dramatisch ändern können – so wird etwa Graphen, wenn man zwei Schichten davon auf die richtige Weise kombiniert, zum Supraleiter.
„Wir untersuchten Schichten von Molybdändisulfid, das ist neben Graphen wohl eines der wichtigsten 2D-Materialien“, sagt Prof. Florian Libisch, der das Forschungsprojekt an der TU Wien leitete. „Wenn man zwei Schichten dieses Materials aufeinanderlegt, treten sogenannte Van-der-Waals-Kräfte zwischen den Atomen dieser beiden Schichten auf. Das sind relativ schwache Kräfte, aber sie reichen aus, um das Verhalten des Gesamtsystems völlig zu verändern.“
In aufwändigen Computersimulationen analysierte das Forschungsteam, welchen Zustand die neue Zweischicht-Struktur aufgrund dieser schwachen Zusatzkräfte annimmt, und wie das die Schwingungen der Atome in den beiden Schichten beeinflusst.
Auf den Drehwinkel kommt es an
„Wenn man die beiden Schichten ein bisschen gegeneinander verdreht, dann führen die Van-der-Waals-Kräfte dazu, dass die Atome beider Schichten ihre Positionen ein kleines bisschen verändern“, so auch Dr. Jiamin Quan, von der UT Texas in Austin. In von ihm geleiteten Experimenten, die in Texas durchgeführt wurden, konnten die Rechenergebnisse bestätigt werden: Durch den Drehwinkel lässt sich einstellen, welche Atomschwingungen in dem Material physikalisch überhaupt möglich sind.
„Materialwissenschaftlich ist es eine wichtige Sache, auf diese Weise Kontrolle über die Phononen-Schwingungen zu haben“, sagt Lukas Linhart „Dass elektronische Eigenschaften eines 2D-Materials verändert werden können, indem man zwei Schichten miteinander verbindet, war schon vorher bekannt. Aber dass auch die mechanischen Schwingungen im Material dadurch gesteuert werden können, eröffnet uns nun neue Möglichkeiten: Phononen und elektromagnetische Eigenschaften hängen eng miteinander zusammen. Über die Schwingungen im Material kann man daher in wichtige Vielteilchen-Effekte steuernd eingreifen.“ Nach dieser ersten Beschreibung des Effekts für Phononen, versucht das Team nun Phononen und Elektronen kombiniert zu beschreiben und hoffen so, mehr über wichtige Phänomene wie Supraleitung zu erfahren.
Der materialphysikalische Moiré-Effekt macht also das ohnehin bereits reichhaltige Forschungsfeld der 2D-Materialien noch reichhaltiger – und erhöht die Chancen, weiterhin neue Schichtmaterialien mit bisher unerreichten Eigenschaften zu finden und ermöglicht den Einsatz von 2D-Materialien als Versuchsplattform für ganz fundamentale Eigenschaften von Festkörpern.
Originalpublikation:
J. Quan et al., Phonon renormalization in reconstructed MoS2 moiré superlattices, Nature Materials, 2021.:
https://www.nature.com/articles/s41563-021-00960-1
Kontakt:
Prof. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
florian.libisch@tuwien.ac.at
Dr. Lukas Linhart
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
lukas.linhart@tuwien.ac.at
Zwei neue Doktoratsprogramme für die TU Wien
Im Rahmen des Förderprogramms „Marie Skłodowska-Curie Actions“ (MSCA) finanziert die EU gemeinsam mit der TU Wien zwei neue große Doktoratsprogramme.
Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) wurden von der Europäischen Kommission eingerichtet, um die länder- und sektorübergreifende Mobilität und die Karriereentwicklung von Forschenden sowie F&I-Personal aus Technik und Management zu fördern und die Attraktivität von wissenschaftlichen Laufbahnen zu steigern. Davon profitiert die TU Wien nun gleich doppelt: Zwei neue Doktoratsprogramme können nun im Rahmen der COFUND-Förderschiene gestartet werden – gemeinsam finanziert von der TU Wien und der EU. Insgesamt werden die Doktoratsprogramme mit 9,3 Millionen Euro gefördert.
ENROL
Stark interdisziplinär angelegt ist das Doktoratsprogramm „ENROL – the Engineering for Life Sciences Doctoral Programme“. 20 junge Forscher_innen, die exzellente Leistungen erbracht haben, werden als Doktorand_innen im Rahmen des Programms an funktionalen Schnittstellen zwischen anorganischen und bio-organischen Systemen forschen. Koordiniert wird das Programm von der Nanobiotechnologin Dr. Ioanna Giouroudi gemeinsam mit einem Management Team, welchem Prof. Gerhard Schütz (Biophysik), Prof. Philipp Thurner (Biomechanik) sowie Prof. Gerhard Kahl (Soft Matter Theorie) angehören. Die beteiligten Principal Investigators kommen aus den Fakultäten für Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenwesen und Betriebswissenschaften, Mathematik und Geoinformation, Physik, sowie technische Chemie.
logics@tuwien
Um die Anwendung von mathematischer Logik auf konkrete Aufgaben in der Informatik geht es im Doktoratskolleg „Logics for Computer Science“, das Prof. Stefan Szeider leiten wird. Ein Konsortium von Top-Informatiker_innen wird 20 besonders talentierte junge Forscher_innen betreuen und mit ihnen an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten. Inhaltlich wird das Doktoratsprogramm ein breites Feld aktueller Forschungsfragen abdecken – von künstlicher Intelligenz und Datenbanken über Algorithmen und Verifikation bis hin zu Sicherheitsfragen und Cyber-Physical Systems.
Kontakt:
Prof. Gerhard Kahl
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Optimale Information über das Unsichtbare
Wie vermisst man Objekte, die man unter gewöhnlichen Umständen gar nicht sehen kann? Universität Utrecht und TU Wien eröffnen mit speziellen Lichtwellen neue Möglichkeiten.
Wenn Licht durch eine ungeordnete Struktur abgelenkt wird, ist es schwierig abzuschätzen, wo sich das Ziel genau befindet. In der neuen Studie wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem man in solch schwierigen Szenarien eine optimale Messgenauigkeit erreichen kann.
Mit Laserstrahlen kann man präzise messen, wo sich ein Objekt befindet, oder ob es seine Position verändert. Normalerweise braucht man dafür allerdings freie, ungetrübte Sicht auf dieses Objekt – und diese Voraussetzung ist nicht immer gegeben. So möchte man etwa in der Biomedizin oft Strukturen untersuchen, die in eine unregelmäßige, komplizierte Umgebung eingebettet sind. Dort wird der Laserstrahl dann abgelenkt, gestreut und gebrochen, wodurch oft kein sinnvolles Messergebnis mehr möglich ist.
Die Universität Utrecht (Niederlande) und die TU Wien konnten nun aber gemeinsam zeigen: Aus dieser Not lässt sich eine Tugend machen. Der neue Ansatz beruht auf der Möglichkeit, den Laserstrahl gezielt so zu verändern, dass er in der komplexen, ungeordneten Umgebung trotzdem genau die gewünschte Information liefert – und zwar nicht nur ungefähr, sondern auf physikalisch optimale Weise: Mehr Präzision lässt die Natur bei kohärentem Laserlicht gar nicht zu. Die neue Technologie ist in ganz unterschiedlichen Anwendungsgebieten einsetzbar – auch mit unterschiedlichen Arten von Wellen – und wurde nun im Fachjournal „Nature Physics“ präsentiert.
Das Vakuum und das Badezimmerfenster
„Man möchte immer die optimale Messgenauigkeit erreichen – das liegt im Wesen aller Naturwissenschaften“, sagt Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Denken wir zum Beispiel an die riesengroße LIGO-Anlage, mit der man Gravitationswellen nachweisen kann: Dort sendet man Laserstrahlen auf einen Spiegel, um Variationen im Abstand zwischen Laser und Spiegel mit extremer Präzision zu messen.“ Das gelingt allerdings nur deshalb so gut, weil sich dort der Laserstrahl durch ein Ultrahochvakuum ausbreitet. Jede noch so kleine Störung soll vermieden werden.
Doch was kann man tun, wenn man es mit Störungen zu tun hat, die sich nicht entfernen lassen? „Stellen wir uns eine Glasscheibe vor, die nicht perfekt transparent, sondern rau und unpoliert ist wie ein Badezimmerfenster“, sagt Allard Mosk von der Universität Utrecht. „Sie lässt zwar Licht durch, aber nicht auf einer geraden Linie. Die Lichtwellen werden verändert und gestreut, daher können wir ein Objekt auf der anderen Seite der Glasscheibe mit freiem Auge nicht genau erkennen.“ Ganz ähnlich ist die Situation, wenn man etwa winzige Objekte im Inneren von biologischem Gewebe untersuchen will: Die ungeordnete Umgebung stört den Lichtstrahl. Aus dem einfachen, regelmäßig-geraden Laserstrahl wird dann ein unübersichtliches Wellenmuster, das in alle Richtungen abgelenkt wird.
Die optimale Welle
Wenn man allerdings genau weiß, was die störende Umgebung mit dem Lichtstrahl macht, kann man die Situation umkehren: Dann nämlich ist es möglich, statt des einfachen, geraden Laserstrahls ein kompliziertes Wellenmuster zu erzeugen, das durch die Störungen genau die gewünschte Form erhält und genau dort auftrifft, wo es das beste Resultat liefern kann. „Um das zu erreichen, muss man die Störungen nicht einmal genau kennen“, erklärt Dorian Bouchet, der Erstautor der Studie. „Es genügt, zuerst passende Wellen durch das System zu schicken um damit zu untersuchen, wie sie durch das System verändert werden.“
Die an dieser Arbeit beteiligten Wissenschaftler entwickelten gemeinsam ein mathematisches Verfahren, mit dem man aus diesen Testdaten dann die optimale Welle berechnen kann: „Man kann zeigen, dass für verschiedene Fragestellungen bestimmte Wellen existieren, die ein Maximum an Information bringen: Etwa über die Raumkoordinaten, an denen sich ein bestimmtes Objekt befindet.“
Wenn man etwa weiß, dass sich hinter einer trüben Milchglasscheibe ein Objekt verbirgt, gibt es eine optimale Lichtwelle, mit der man das Maximum an Information darüber erhalten kann, ob sich das Objekt ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links bewegt hat. Diese Welle sieht kompliziert und ungeordnet aus, wird dann aber von der Milchglasscheibe exakt so verändert, dass sie beim Objekt genau auf die gewünschte Weise ankommt und das größtmögliche Maß an Information zum experimentellen Messapparat zurückliefert.
Laser-Experimente in Utrecht
Dass die Methode tatsächlich funktioniert, wurde an der Universität Utrecht experimentell bestätigt: Man lenkte Laserstrahlen durch ein ungeordnetes Medium – in Form einer trüben Platte. Das Streuverhalten des Mediums wurde dadurch charakterisiert, dann wurden die optimalen Wellen berechnet, um ein Objekt jenseits der Platte zu analysieren – und das gelang, mit einer Präzision im Nanometer-Bereich.
Dann führte das Team noch weitere Messungen durch, um die Grenzen der Methode auszuloten: Die Zahl der Photonen im Laserstrahl wurde deutlich reduziert, um zu sehen, ob man dann immer noch ein sinnvolles Ergebnis bekommt. Dadurch konnte man zeigen, dass die Methode nicht nur funktioniert, sondern sogar im physikalischen Sinne optimal ist: „Wir sehen, dass die Präzision unserer Methode nur durch das sogenannte Quantenrauschen limitiert wird“, erklärt Allard Mosk. „Dieses Rauschen ergibt sich aus der Tatsache, dass Licht aus Photonen besteht – daran kann man nichts ändern. Doch im Rahmen dessen, was uns die Quantenphysik für einen kohärenten Laserstrahl erlaubt, können wir tatsächlich die optimalen Wellen berechnen um unterschiedliche Dinge zu messen: Nicht nur die Position, sondern auch die Bewegung oder die Drehrichtung von Objekten.“
Diese Ergebnisse wurden im Rahmen eines Programms zur Vermessung von Halbleiterstrukturen im Nanometerbereich erzielt, bei dem Universitäten mit der Industrie zusammenarbeiten. Tatsächlich sieht das Team mögliche Einsatzbereiche für diese neue Technik in ganz unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise in der Mikrobiologie, aber auch in der Herstellung von Chips, wo extrem präzise Messungen ebenfalls unverzichtbar sind.
Originalpublikation:
D. Bouchet, S. Rotter, A.P. Mosk; Maximum information states for coherent scattering measurements, Nature Physics (2021):
https://www.nature.com/articles/s41567-020-01137-4
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Altes Rätsel um „neue Sorte von Elektronen“ gelöst
Warum emittieren bestimmte Materialien Elektronen mit einer ganz bestimmten Energie? An der TU Wien wurde das nun nach langer Zeit endlich geklärt.
Das Team im Labor
Florian Libisch, Philipp Ziegler, Wolfgang Werner und Alessandra Bellissimo (v.l.n.r.)
Elektronen verlassen ein bestimmtes Material, fliegen davon und werden gemessen – das ist in der Physik etwas ganz Alltägliches. Manche Materialien emittieren Elektronen, wenn man sie mit Licht bestrahlt, dann spricht man von „Photoelektronen“. In der Materialforschung spielen auch sogenannte „Auger-Elektronen“ eine wichtige Rolle – sie können von Atomen ausgesandt werden, wenn man ihnen zuvor ein Elektron aus einer der inneren Elektronenschalen entreißt. Doch nun gelang es an der TU Wien, eine ganz andere Art der Elektronenemission zu erklären, die beispielsweise bei Kohlenstoff-Materialien wie Graphit auftritt. Bekannt ist diese Elektronenemission schon seit etwa 50 Jahren, doch ihre Ursache war bisher unklar.
Merkwürdige Elektronen ohne Erklärung
„Viele Forschende haben sich darüber bereits gewundert“, sagt Prof. Wolfgang Werner vom Institut für Angewandte Physik. „Es gibt Materialien, die aus atomaren Schichten bestehen, die nur von schwachen Van-der-Waals-Kräften zusammengehalten werden, zum Beispiel Graphit. Und man stellte fest, dass diese Sorte von Graphit ganz bestimmte Elektronen aussendet, die alle exakt dieselbe Energie haben, nämlich 3,7 Elektronenvolt.“
Kein bekannter physikalischer Mechanismus konnte diese Elektronenemission erklären. Doch die gemessene Energie gab einen Hinweis darauf, wo man suchen muss: „Wenn diese atomar dünnen Schichten aufeinanderliegen, dann kann sich dazwischen ein bestimmter Elektronenzustand ausbilden“, sagt Wolfgang Werner. „Man kann sich das vorstellen wie ein Elektron, das laufend zwischen den beiden Schichten hin und her reflektiert wird, bis es irgendwann die Schicht durchdringt und nach außen entkommt.“
Man wusste, dass die Energie dieser Zustände eigentlich gut zu den beobachteten Daten passt, doch das alleine war auch keine Erklärung. „Die Elektronen in diesen Zuständen sollten eigentlich nicht zum Detektor gelangen“, sagt Dr. Alessandra Bellissimo, eine der Autorinnen der aktuellen Publikation. „In der Sprache der Quantenphysik sagt man: Die Übergangswahrscheinlichkeit ist zu gering.“
Springschnüre und Symmetrie
Um das zu ändern, muss die innere Symmetrie der Elektronenzustände gebrochen werden. „Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Springschnurspringen“, erklärt Wolfgang Werner. „Zwei Kinder halten ein langes Seil und bewegen die Endpunkte. Eigentlich erzeugen sie damit beide eine Welle, die sich normalerweise von einer Seite des Seils bis zur anderen ausbreiten würde. Doch wenn das System symmetrisch ist und beide genau dasselbe tun, bewegt sich das Seil rauf und runter. Das Schwingungsmaximum bleibt immer an derselben Stelle. Wir sehen keine Wellenbewegung nach links oder rechts, man spricht von einer stehenden Welle.“ Wird die Symmetrie aber gebrochen, weil sich etwa eines der Kinder nach hinten bewegt, ist die Situation anders – dann bekommt das Seil plötzlich eine völlig andere Dynamik und das Schwingungsmaximum wandert.
Solche Symmetriebrechungen können sich auch im Material ergeben. Elektronen verlassen ihren Platz und bewegen sich. An der Stelle, an der sie vorher gesessen sind, bleibt ein „Loch“ zurück. Solche Elektron-Loch-Paare stören die Symmetrie, und dadurch haben die Elektronen plötzlich gleichzeitig die Eigenschaften zweier unterschiedlicher Zustände. So lassen sich zwei Vorteile miteinander verbinden: Einerseits gibt es eine große Zahl solcher Elektronen, und andererseits ist auch ihre Wahrscheinlichkeit ausreichend hoch, zum Detektor zu gelangen. In einem perfekt symmetrischen System wäre nur das eine oder das andere möglich. Laut Quantenmechanik können sie beides gleichzeitig, weil durch die Symmetriebrechung die zwei Zustände „verschmelzen“ (hybridisieren).
„Es ist gewissermaßen eine Teamarbeit zwischen den Elektronen, die zwischen zwei Schichten des Materials hin und her reflektiert werden und den symmetriebrechenden Elektronen“, sagt Prof. Florian Libisch vom Institut für Theoretische Physik. „Nur wenn man sie gemeinsam betrachtet, lässt sich erklären, dass das Material Elektronen von genau dieser Energie von 3,7 Elektronenvolt aussendet.“
Kohlenstoffmaterialien wie die Graphit-Sorte, die in dieser Forschungsarbeit analysiert wurde, spielen heute eine große Rolle – etwa das 2D-Material Graphen, aber auch Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit winzigem Durchmesser, die ebenfalls bemerkenswerte Eigenschaften aufweisen. „Der Effekt sollte in ganz unterschiedlichen Materialien auftreten – überall dort, wo dünne Schichten durch schwache Van-der-Waals-Kräfte zusammengehalten werden“, sagt Wolfgang Werner. „In all diesen Materialien dürfte diese ganz spezielle Art der Elektronenemission, die wir nun erstmals erklären können, eine wichtige Rolle spielen.“
Originalpublikation:
W. Werner et al., Secondary Electron Emission by Plasmon-Induced Symmetry Breaking in Highly Oriented Pyrolytic Graphite, Phys. Rev. Lett. 125, 196603 (2020).:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.196603
Die Arbeit wurde in der Novemberausgabe von „Physical Review Letters“ veröffentlicht (PRL 125, 196603) und im Rahmen eines von der EU geförderten Marie-Sklodowska-Curie Projektes SIMDALEE2 (Sources, Interaction with Matter, Detection and Analysis of Low Energy Electrons) in Zusammenarbeit mit der Universita Roma Trè (Supervisor Prof. Giovanni Stefani) durchgeführt. Zwei der Autor_innen, Dr. Alessandra Bellissimo und Dr. Vytautas Astasauskas, haben ihre Dissertationen im Rahmen dieses Projektes abgeschlossen.
Kontakt:
Prof. Wolfgang Werner
Institut für Angewandte Physik
wolfgang.werner@tuwien.ac.at
Ass.Prof. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
florian.libisch@tuwien.ac.at
Awards of Excellence: Vier Preise für die TU Wien
Die 40 besten Dissertationen des Jahres werden mit einem Staatspreis ausgezeichnet – vier davon entstanden an der TU Wien.
Vier Preisträger an der TU Wien
Oben: Mario Nikowitz (links) und Michael Josef Taubländer (rechts). Unten: Theodoros Tsatsoulis (links) und Alexander Kirnbauer (rechts - Foto: Dagmar Fischer).
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung vergibt einen mit 3.000 Euro dotierten Staatspreis an die 40 besten Dissertationen des abgelaufenen Studienjahres. Die Vorschläge dafür kommen von den Universitäten. Vier dieser Preise gingen im Jahr 2020 an die TU Wien: Theodoros Tsatsoulis, Alexander Kirnbauer, Mario Nikowitz und Michael Taubländer können sich jeweils über einen Award of Excellence freuen.
Vielteilcheneffekte
Theodoros Tsatsoulis untersuchte am Institut für Theoretische Physik, wie die Moleküle eines Gases mit einer Oberfläche wechselwirken – etwa wie sich Wassermoleküle auf einer regelmäßigen Oberfläche wie Graphen anlagert, oder wie Wasserstoffmoleküle an Siliziumoberflächen zerlegt und an der Oberfläche festgehalten werden können. Berechnen kann man das nur mit quantenphysikalischen Methoden und großem Rechenaufwand mit Hilfe von Supercomputern. Tsatsoulis gelang es, wichtige Vielteilchen-Effekte zu berücksichtigen und bestehende Rechenmethoden zu verbessern, um zu neuen Ergebnissen zu gelangen, die gut mit experimentellen Daten übereinstimmen.
Elektromotoren
Mario Nikowitz forscht am Institut für Energiesysteme und Elektrische Antriebe und beschäftigt sich dort mit einer speziellen Form des Elektromotors – der sogenannten Synchron-Reluktanzmaschine. Es gelang ihm, mathematische Werkzeuge zur Beschreibung dieser Maschinen zu erweitern, sodass sich berechnen lässt, wie man die Motoren mit optimalem Wirkungsgrad betreiben kann. Des weiteren hat Dr. Nikowitz Verfahren vorgestellt, die ohne mechanischer Sensorik auskommen: Drehzahl und Position des Rotors werden nicht durch eigens eingebaute Sensoren gemessen, diese Daten werden stattdessen aus dem elektrischen Verhalten der Maschine errechnet.
Hochleistungskunststoffe
Michael Josef Taubländer beschäftigte sich in der Forschungsgruppe von Prof. Miriam Unterlass am Institut für Materialchemie mit neuen, umweltfreundlichen Herstellungserfahren für spezielle Hochleistungskunststoffe. Dabei handelt es sich um Materialien, die wegen ihrer thermischen, mechanischen oder chemischen Stabilität für moderne Technologien eine wichtige Rolle spielen, bisher allerdings meist nur unter Einsatz von teuren und giftigen Lösungsmitteln hergestellt werden konnten. Bei hohem Druck und hoher Temperatur gelingt es allerdings, bei der Erzeugung von Hochleistungskunststoffen diese Lösungsmittel durch gewöhnliches Wasser zu ersetzen.
Spezialbeschichtungen
Alexander Kirnbauer vom Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie forschte an Beschichtungen für Hochleistungsbauteile. Mit speziellen keramischen Schutzschichten kann man Hochleistungswerkzeuge vor mechanischer, thermischer und korrosiver Belastung schützen, etwa beim Bohren oder Fräsen. In den letzten Jahren richtete man bei der Suche nach solchen Schutzschichten das Augenmerk ganz besonders auf sogenannte „Hoch-Entropie-Legierungen“, das sind Legierungen, die aus mindestens fünf unterschiedlichen Metallen bestehen. Kirnbauer konnte eine ganze Reihe solcher Schutzschichten entwickeln und charakterisieren und dadurch nachweisen, dass sie tatsächlich eine höhere Stabilität aufweisen.
Die Zähmung des Zufalls
Auf der ganzen Welt versucht man, neue Laser zu entwickeln. Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgt man nun an der TU Wien: Man nutzt die Macht des Zufalls.
Sebastian Schönhuber und Benedikt Limbacher im Labor an der TU Wien. Kleineres Bild: Nicolas Bachelard (Institut für Theoretische Physik)
Will man Moleküle identifizieren, sind Terahertz-(THz-)Laser extrem nützlich: Viele Moleküle können nämlich ganz bestimmte Lichtwellenlängen aus dem THz-Bereich absorbieren. Wenn man also Absorptionslinien bei bestimmten Wellenlängen misst, kann man genau sagen, um welche Moleküle es sich handelt. Seit Jahren wird daher intensiv an der Entwicklung von THz-Lasern gearbeitet. Eine vielversprechende Variante sind sogenannte Quantenkaskadenlaser, wie sie auch an der TU Wien mit großem Erfolg entwickelt werden. Sie liefern Laserlicht mit besonders hoher Leistung und Bandbreite.
Nun versuchte man an der TU Wien, die Entwicklung solcher Lichtquellen auf exotische Art voranzutreiben – mit sogenannten Zufallslasern. Während bei konventionellen Lasern die erzeugten Wellenlängen sorgfältig ausgewählt und durch die nanometergenau hergestellte Geometrie des Lasers festgelegt wird, liefert der Zufallslaser durch ein hohes Maß an innerer Unordnung viele völlig zufällige Wellenlängen gleichzeitig. Was wie ein Nachteil klingt, lässt sich technologisch nutzbar machen – das zeigt eine Studie, die nun im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht wurde.
Der Zufall als Verbündeter
„Zufallslaser – auch Random Laser genannt – basieren auf zufälliger Lichtstreuung“, erklärt Sebastian Schönhuber vom Institut für Photonik der TU Wien. „Man verwendet keinen sauberen Kristall, wie in einem gewöhnlichen Laserpointer, sondern ein Material voller Fehler, in dem das erzeugte THz-Licht zufällig gestreut wird.“ Dabei entstehen unzählige verschiedene Lichtfrequenzen, die sich durch puren Zufall ergeben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasern strahlt ein Zufallslaser also nicht bloß eine bestimmte Farbe ab, sondern ein kompliziertes, buntes Farbspektrum.
Was macht man aber mit einem Zufallslaser, wenn man eine ganz bestimmte Wellenlänge benötigt? Dafür fand das Team der TU Wien nun eine Lösung: einen speziellen Kontrollmechanismus. „Wir verwenden einen Optimierungsalgorithmus, um den Random Laser auf eine gewünschte Frequenz zu stimmen“, sagt Nicolas Bachelard vom Institut für Theoretische Physik. „Dazu bestrahlen wir den Laser mit Infrarotlicht, das uns erlaubt, das Laser-Material gezielt zu beeinflussen. Wenn wir das Infrarotlicht nun räumlich strukturieren, können wir dadurch die Zusammensetzung des ausgestrahlten Terahertz-Laserlichts gezielt kontrollieren. In mehreren Optimierungsschritten kommen wir so dem gewünschten Ergebnis immer näher.“
Dadurch kann im Gegensatz zu anderen Lasern praktisch jede beliebige Frequenz ausgewählt werden, ohne den Laser selbst beziehungsweise seine Geometrie anpassen zu müssen.
Ungewöhnlich, aber mit großem praktischen Nutzen
„Natürlich mag es auf den ersten Blick ein wenig umständlich klingen ein System zuerst in Unordnung zu bringen um es danach wieder zu kontrollieren”, sagt Benedikt Limbacher vom Institut für Photonik, „jedoch erlaubt dieser unkonventionelle Weg, extrem praktische und kompakte Laserquellen zu entwickeln, die für spektroskopische Anwendungen geeignet sind.“
Originalpublikation
S. Schönhuber et al., All-optical adaptive control of quantum cascade random lasers, Nature Communications 11, 5530 (2020):
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19305-8
Kontakt:
Dr. Sebastian Schönhuber
Institut für Photonik
Technische Universität Wien
sebastian.schoenhuber@tuwien.ac.at
Wie Moleküle Mosaike bilden
Wenn sich Moleküle auf Oberflächen anlagern, entstehen unterschiedliche Muster. Doch wie kann man sie beeinflussen? Ein internationales Team mit TUW-Beteiligung kann das nun erklären.
Benedikt Hartl
Im Hintergrund: Verschiedene mosaikartige Muster, die von den Molekülen gebildet werden können.
Hochkomplizierte Muster können sich ganz von selbst bilden, wenn sich komplexe Moleküle unter bestimmten elektrochemischen Bedingungen auf einer Gold-Oberfläche anlagern – das konnte Stijn Mertens (damals an der TU Wien, jetzt an der Lancaster University) bereits vor einigen Jahren mit Hilfe hochauflösender Rastertunnelmikroskopie zeigen.
Diese Muster wurden nicht gezielt vorgegeben, es handelt sich um komplexe Selbstorganisation. Aber wie kann man in diese Selbstorganisation steuernd eingreifen, indem man äußere Parameter gezielt verändert? Und ist es vielleicht sogar möglich, eine dieser Strukturen gezielt in eine andere überzuführen? Wenn ja, hätte man einen „Schalter“ zur Verfügung, der die Eigenschaften einer Oberfläche auf Knopfdruck ändert, das wäre technologisch höchst interessant.
Mit dieser Problemstellung haben sich nun Forschungsteams aus der Experimentalphysik und der theoretischen Physik intensiv beschäftigt – mit starker Beteiligung seitens der TU Wien. Die Ergebnisse wurden im „Journal of Chemical Theory and Computation“ publiziert.
Experiment und Theorie
„Konkret untersucht haben wir ein flaches, polyaromatisches Kation (PQP+) und ein anorganisches Anion (ClO4) in einer wässrigen Perchloratlösung, unter Einfluss eines externen elektrischen Feldes“, erklärt Stijn Mertens. „Man stellte fest, dass man die Strukturen, die sich ganz von selbst einstellen, durch Variation des äußeren Feldes reversibel ineinander überführen kann.“
Shubham Sharma, Michael Walter, Stijn Mertens (v.l.n.r.)
Allerdings ist es unmöglich, nur durch Experimente festzustellen, warum sich gerade diese komplexen Muster bilden. Schlüssige Antworten auf diese Frage konnten nun in Zusammenarbeit mit theoretischen Arbeitsgruppen gegeben werden, die diese experimentelle Situation in Kombination von ab initio Simulationen und komplexen Optimierungsalgorithmen am Computer nachgestellt haben.
Dieses Vorhaben stellte sich allerdings als wesentlich schwieriger heraus als ursprünglich gedacht: Benedikt Hartl (aus der Arbeitsgruppe Theorie der Weichen Materie – SMT – der TU Wien) musste im Rahmen seiner von der ÖAW geförderten Dissertation (DOC Stipendium) drei Jahre intensiv forschen, um diese knifflige Fragestellung zu lösen.
Die Energie-Nadel im Heuhaufen der Möglichkeiten
Michael Walter und sein Team an der Universität Freiburg ermittelten zunächst in aufwändigen Simulationen mit ab initio Methoden die Energien der Moleküle. Benedikt Hartl verwendete dann diese Ergebnisse, um klassische Kraftfelder zu berechnen, mit denen man die Kräfte zwischen den Molekülen beschreiben kann. Damit war das Problem aber noch lange nicht gelöst: Es gibt eine riesengroße Anzahl möglicher Molekül-Anordnungen. Und unter ihnen musste man jene mit der niedrigsten Energie finden – das ist jene, die unter natürlichen Bedingungen dann auch tatsächlich angenommen wird.
„In einem hochdimensionalen Parameterraum die energetisch günstigste Anordnung der Moleküle zu finden – das ist in Hinblick auf die riesigen Zahl der zu optimierenden Parameter wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen“, sagt Prof. Gerhard Kahl vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Benedikt Hartl zog alle Register seines Könnens. Es gelang ihm dabei, Optimierungsverfahren, die auf sogenannten evolutionären Algorithmen beruhen, deutlich effizienter und verlässlicher zu machen.“
Selbstorganisation korrekt vorhersagen
Am Ende haben sich die Mühen des internationalen Teams und der massive Computereinsatz gelohnt: Tatsächlich gelang es, die experimentell gefundenen Strukturen mit Hilfe des theoretischen Modells zu reproduzieren und zu erklären. „Ein komplexes Wechselspiel zwischen der Form des Moleküls und der Verteilung der elektrischen Ladungen im Molekül ist der entscheidende Faktor“, erklärt Benedikt Hartl. „Dadurch lässt sich die reiche Vielfalt an unterschiedlichen Molekülmosaiken erklären, die im Experiment gefunden wurden.“
„Das gemeinsam entwickelte Verfahren ist eine sehr erfolgreiche Methode, die Selbst-Organisationsmuster zu erklären“, sagt Gerhard Kahl. „Diese Methode lässt sich auch auf wesentlich komplexere Moleküle erweitern. Sie hat dadurch ein großes Potenzial, uns in Zukunft dabei zu helfen, kontrollierte Selbstorganisation besser zu verstehen und sogar vorherzusagen.“
Kontakt:
Dipl.-Ing. Benedikt Hartl
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
benedikt.hartl@tuwien.ac.at
Text: Florian Aigner
Die Wissenschaft der schwarzen Löcher
Der Physiknobelpreis 2020 wurde für wissenschaftliche Entdeckungen rund um schwarze Löcher vergeben – eine Einordnung des TU-Physikers Herbert Balasin.
Sir Roger Penrose
© Ill. Niklas Elmehed. © Nobel Media.
Der diesjährige Nobelpreis für Physik steht ganz im Zeichen schwarzer Löcher: Eine Hälfte geht an den berühmten britischen Physiker Sir Roger Penrose, die andere Hälfte an Reinhard Genzel und Andrea Ghez für die Entdeckung eines supermassiven schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie.
Auch an der TU Wien wird an schwarzen Löchern geforscht – unter anderem vom Gravitationsphysiker Herbert Balasin vom Institut für Theoretische Physik. Er verfolgt die Arbeit von Roger Penrose bereits seit vielen Jahren und ordnet sie hier kurz ein:
Theorie, die mit dem Experiment zusammenspielt
„Roger Penrose hat sich um die mathematische Struktur der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie besonders verdient gemacht: Die Vergabe des Nobelpreises ist ein wunderschönes Beispiel für das Zusammenspiel von Experiment und Theorie.
Penrose gelang es, ganz im Gegensatz zur damalig vorherrschenden Meinung, welche schwarze Löcher als Artefakt hoher Symmetrie der Raumzeit ansah, deren Generizität nachzuweisen. Die sein ganzes Schaffen prägende Innovativität ließ ihn topologische Methoden auf die allgemeine Relativitätstheorie anwenden. Der dabei geprägte Begriff der “gefangenen Fläche” (im Englischen “trapped surface”) gestattete es ohne Verwendung von Symmetrieannahmen die Existenz von Singularitäten nachzuweisen. Damit wurden schwarze Löcher von mathematischen Ausnahmefällen zu durchaus häufig vorkommenden Lösungen “befördert”.
Roger Penrose ist einer der innovativsten Relativisten. So gelang es ihm, durch Analyse von Lichtstrahlen, die von einem Punkt emanieren, die vierdimensionale Raum-Zeit mit der Hermann Minkowski 1908 Einsteins Relativitätstheorie geometrisierte auf einen einfacheren, zweidimensionalen Raum rückzuführen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in einer zweibändigen Monographie „Spinoren und Raumzeit“, welche er mit dem jüngst verstorbenen, österreichischen Relativisten Wolgang Rindler herausgab, niedergelegt. Durch Einführung asymptotischer Ränder für Raumzeiten wurden einfache Einblicke in die Kausalstruktur von Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie ermöglicht. Um nur einige der auf ihn zurückgehenden Konzepte zu nennen.
Den quasi spielerischen Zugang mit dem Roger Penrose seine Konzepte findet, kann man an dem Begriff der Penrose-tilings erahnen – das sind sich nichtperiodisch, aber dennoch die Ebene lückenlos überdeckende „Kachelungen“, die in der Festkörperphysik eine Rolle spielen. In dieser Hinsicht wurde wohl einer der genialsten und intuivsten Physiker verdienterweise mit dem prestigeträchtigsten Wissenschftspreis ausgezeichnet. Congratulations Roger!
Abschließend möchte ich noch eine kleine Verbindung zur TU-Wien anmerken. Am Institut für Theoretische Physik werden Konzepte wie 2-Spinoren und Schwarze Löcher in Vorlesungen von Kollegen Grumiller und meiner Wenigkeit behandelt, was die ungemeine Fruchtbarkeit und Kreativität von Penroses Schaffens unter Beweis stellen soll.“
Herbert Balasin,
Institut für Theoretische Physik,
TU Wien
Das Quantenecho kommt gleich mehrfach
Ein Forschungsteam aus Garching und Wien entdeckte einen bemerkenswerten Echoeffekt – er bietet spannende neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Quanteninformation.
© Bild: C. Hohmann / MCQST
Neuer Spin-Echo-Effekt
Regt man die Spins von in Silizium eingebetteten Phosphor-Atomen geschickt mit Mikrowellen-Pulsen an, so kann man nach einer bestimmten Zeit ein so genanntes Spin-Echosignal detektieren. Erstaunlicherweise lässt sich eine ganze Serie von Echos...
Kleine Teilchen können einen Drehimpuls haben, der in eine bestimmte Richtung zeigt – den sogenannten Spin. Durch ein Magnetfeld lässt sich dieser Spin manipulieren. Das nutzt man etwa für die Magnetresonanztomographie aus, wie sie in Krankenhäusern eingesetzt wird. Nun stieß ein internationales Forschungsteam auf einen überraschenden Effekt bei einem System, das sich besonders gut für die Verarbeitung von Quanteninformation eignet: die Spins von Phosphor-Atomen in einem Stück Silizium, die an einen Mikrowellen-Resonator gekoppelt werden können. Regt man diese Spins geschickt mit Mikrowellen-Pulsen an, so kann man nach einer bestimmten Zeit ein so genanntes Spin-Echosignal detektieren – das eingespeiste Pulssignal wird als Quantenecho wieder ausgesendet. Erstaunlicherweise stellt sich dieses Quantenecho nicht nur einmal ein, sondern es lässt sich eine ganze Serie von Echos detektieren. Das eröffnet neue Möglichkeiten, wie mit solchen Quantensystemen Information verarbeitet werden kann.
Die Experimente wurden am Walther-Meißner-Institut in Garching an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Technischen Universität München durchgeführt, die theoretische Erklärung dazu entstand an der Technischen Universität Wien. Nun wurde die gemeinsame Arbeit im Fachjournal „Physical Review Letters“ publiziert.
Das Echo der Quantenspins
„Spin-Echos kennt man schon lange, das ist nichts Ungewöhnliches“, sagt Prof. Stefan Rotter von der TU Wien. Zunächst erreicht man durch ein Magnetfeld, dass die Spins vieler Teilchen in dieselbe magnetische Richtung zeigen. Dann bestrahlt man die Teilchen mit einem elektromagnetischen Puls, und plötzlich beginnen ihre Spins ihre Richtung zu ändern.
Allerdings sind die Teilchen jeweils in geringfügig unterschiedliche Umgebungen eingebettet. Es kann daher sein, dass auf unterschiedliche Teilchen leicht unterschiedliche Kräfte wirken. „Dadurch verändert sich der Spin nicht bei allen Teilchen gleich schnell“, erklärt Dr. Hans Hübl von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. „Manche Teilchen ändern ihre Spin-Richtung schneller als andere, und bald hat man ein wildes Durcheinander von Spins mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen.“
In dieses scheinbare Chaos kann man allerdings neue Ordnung bringen – mit Hilfe eines weiteren elektromagnetischen Pulses. Ein geeigneter Puls kann nämlich die vorherige Spin-Drehung wieder umkehren, sodass die Spins alle wieder zueinanderstreben. „Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei einem Marathon“, sagt Stefan Rotter. „Beim Startsignal sind alle Läufer noch gemeinsam am Start; dadurch, dass manche Läufer schneller unterwegs sind als andere, wird das Feld der Läufer im Laufe der Zeit immer weiter auseinandergezogen. Wenn man nun jedoch allen Läufern das Signal gibt, wieder zum Start zurückzukehren, würden alle Läufer wieder ungefähr zum gleichen Zeitpunkt an den Start zurückkommen, obwohl schnellere Läufer einen längeren Rückweg zurücklegen müssen als langsamere.“
Bei den Spins bedeutet das, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Teilchen wieder genau dieselbe Spin-Richtung haben – und das bezeichnet man als „Spin-Echo“. „Dass wir bei unseren Experimenten ein Spin-Echo messen konnten, hatten wir auf Basis unserer Erfahrung in diesem Gebiet bereits erwartet“, sagt Hans Hübl. „Das Bemerkenswerte ist nun allerdings, dass wir nicht nur ein einziges, sondern gleich mehrere Echos messen konnten.“
Der Spin, der sich selbst beeinflusst
Zunächst war unklar, wie dieser neuartige Effekt zustande kommt. Doch genauere theoretische Analysen ermöglichten nun, das Phänomen zu verstehen: Es liegt an der starken Kopplung zwischen den beiden Bestandteilen des Experiments – den Spins und den Photonen in einem Mikrowellen-Resonator, einem elektrischen Schaltkreis, in dem Mikrowellen nur mit bestimmten Wellenlängen existieren können. „Diese Kopplung ist das Wesentliche an unserem Experiment: In den Spins kann man Information speichern, und mit Hilfe der Mikrowellenphotonen im Resonator kann man sie verändern und auslesen“, sagt Hans Hübl.
Die starke Kopplung zwischen den Atomspins und dem Mikrowellen-Resonator sorgt zusätzlich aber auch für das Mehrfach-Echo: Wenn die Spins der Atome nämlich beim ersten Echo alle wieder in dieselbe Richtung zeigen, entsteht genau dadurch ein elektromagnetisches Signal. „Dank der Kopplung an den Mikrowellen-Resonator wirkt dieses Signal wieder auf die Spins zurück, und das führt zu einem weiteren Echo – und immer so weiter“, erklärt Stefan Rotter. „Die Spins verursachen von selbst den elektromagnetischen Puls, der für das nächste Echo verantwortlich ist.“
Die Physik des Spin-Echos hat eine große Bedeutung für technische Anwendungen – sie ist ein wichtiges Grundprinzip, das hinter der Magnetresonanztomographie steckt. Welche neuen Möglichkeiten nun in dem Mehrfach-Echo stecken, etwa für die Verarbeitung von Quanteninformation, soll nun genauer untersucht werden. „Fest steht, dass sich dadurch völlig neue Möglichkeiten ergeben“, sagt Rudolf Gross, Co-Autor der Studie und Direktor des Walther-Meißner Instituts in Garching, sowie Professor für Technische Physik an der TU München. „Eine regelmäßige Serie quantenphysikalischer Signale ist für uns ein aufregendes neues Werkzeug.“
Originalpublikation
S. Weichselbaumer et al., Echo Trains in Pulsed Electron Spin Resonance of a Strongly Coupled Spin Ensemble, Phys. Rev. Lett. 125, 137701 (2020):
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.137701
Kontakt
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Matthias Zens und Stefan Rotter
Molekulare Kräfte: Das überraschende Dehnverhalten der DNA
Was passiert, wenn man an einem DNA-Molekül zieht? Es verhält sich dabei ganz anders als wir es von makroskopischen Objekten gewohnt sind – an der TU Wien konnte man das nun erklären.
Johannes Kalliauer
Wenn große Kräfte auf einen Balken einwirken, etwa im Brückenbau, dann wird sich der Balken ein bisschen verformen. Die Zusammenhänge zwischen Kräften, inneren Spannungen und Verformungen zu berechnen, gehört zu den Standardaufgaben im Bauingenieurwesen. Aber was passiert, wenn man diese Überlegungen auf winzige Objekte anwendet – etwa auf eine einzelne DNA-Doppelhelix?
Experimente mit DNA-Molekülen zeigen, dass sie völlig andere mechanische Eigenschaften haben als makroskopische Objekte – und das hat wichtige Konsequenzen für die Biologie und die Medizin. An der TU Wien gelang es nun, diese Eigenschaften genau zu erklären, durch eine Kombination von Ideen aus dem Bauingenieurwesen und der Physik.
Unerwartetes Verhalten auf Molekül-Ebene
Auf den ersten Blick könnte man die DNA-Doppelhelix für eine winzig kleine Feder halten, die man einfach dehnen und stauchen kann, wie man das auch von gewöhnlichen Sprungfedern kennt. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht: „Wenn man ein DNA-Stück langzieht, würde man eigentlich erwarten, dass dabei die Zahl der Windungen abnimmt. Doch in bestimmten Fällen ist das Gegenteil der Fall: Wenn die Helix länger wird, dreht sie sich manchmal noch mehr ein“, sagt der Bauingenieur Johannes Kalliauer vom Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen der TU Wien. „Außerdem sind DNA-Moleküle viel dehnbarer als die Materialien, mit denen wir im Bauingenieurwesen sonst zu tun haben: Sie können unter Zugspannung um 70 % länger werden.“
Für Biologie und Medizin sind diese seltsamen mechanischen Eigenschaften der DNA von großer Bedeutung: „Wenn die Erbinformation vom DNA-Molekül abgelesen wird, kann es von den Details der Geometrie abhängen, ob es zu einem Lesefehler kommt, der im schlimmsten Fall sogar Krebs auslösen kann“, sagt Johannes Kalliauer. „Bisher musste man sich in der Molekularbiologie mit empirischen Methoden zufriedengeben, um den Zusammenhang zwischen Kräften und Geometrie der DNA zu erklären.“
In seiner Dissertation ging Johannes Kalliauer dieser Sache auf den Grund – und zwar in Form einer eher ungewöhnlichen Fächerkombination: Seine Arbeit wurde einerseits vom Bauingenieur Prof. Christian Hellmich betreut, andererseits auch von Prof. Gerhard Kahl vom Institut für Theoretische Physik.
„Wir verwendeten Methoden der Molekulardynamik, um das DNA-Molekül am Computer auf atomarer Skala nachzubilden“, erklärt Kalliauer. „Man legt fest, wie die DNA-Helices gestaucht, gedehnt oder verdreht werden – und dann ermittelt man, welche Kräfte auftreten, und in welche Endposition die Atome schließlich gelangen.“ Solche Rechnungen sind sehr aufwändig und nur mit Hilfe großer Supercomputer möglich – Johannes Kalliauer verwendete dafür den Vienna Scientific Cluster (VSC).
So konnte man die merkwürdigen experimentellen Befunde erklären – etwa das kontraintuitive Ergebnis, dass sich die DNA in bestimmten Fällen bei Dehnung noch mehr eindreht. „Auf großer Skala kann man sich das schwer vorstellen, aber auf Ebene der Atome ergibt das plötzlich Sinn“, sagt Johannes Kalliauer.
Seltsame Zwischenwelt
Im Rahmen der atomaren Modelle der theoretischen Physik kann man interatomare Kräfte und Abstände ermitteln. Mit bestimmten Regeln, die das Team basierend auf Prinzipien aus dem Bauingenieurwesen entwickelte, kann man daraus dann die relevanten Kraftgrößen ermitteln, die man benötigt, um den DNA-Strang als Ganzes zu beschreiben – ähnlich wie man die Statik eines Balkens im Bauingenieurwesen mithilfe einiger wichtiger Querschnittseigenschaften beschreiben kann.
„Wir bewegen uns hier in einer interessante Zwischenwelt, zwischen dem Mikroskopischen und dem Makroskopischen“, sagt Johannes Kalliauer. „Das Besondere an diesem Forschungsprojekt ist, dass man wirklich beide Sichtweisen benötigt und sie miteinander verbinden muss.“
Diese Kombination deutlich unterschiedlicher Größenskalen spielt am Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen immer wieder eine zentrale Rolle. Schließlich werden die Materialeigenschaften, die wir täglich im großen Maßstab spüren, immer vom Verhalten auf der Mikroebene bestimmt. Die aktuelle Arbeit, die nun im „Journal of the Mechanics and Physics of Solids“ publiziert wurde, soll einerseits zeigen, wie man das Große und das Kleine auf wissenschaftlich exakte Weise miteinander verbinden kann, und andererseits helfen, das Verhalten der DNA besser zu verstehen – bis hin zur Erklärung von Erbkrankheiten.
Originalpublikation:
J. Kalliauer et al., A new approach to the mechanics of DNA: Atoms-to-beam homogenization; Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 143, 104040 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jmps.2020.104040
Kontakt:
Dr. Johannes Kalliauer
Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen
Technische Unviersität Wien
johannes.kalliauer@tuwien.ac.at
Prof. Dr. Gerhard Kahl
Institut für Theoretische Physik
Technische Unviersität Wien
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
TU Wien Chor gewinnt Online-Chorwettbewerb
Nicht nur musikalisch sondern auch videotechnisch überzeugte der TU Wien Chor und gewann einen internationalen Wettbewerb – mit einem "Deepfake-Video".
© TU Wien Chor
Von der Pandemie ließ sich der TU Wien Chor nicht vom Singen abhalten. Mit einigem technischen Aufwand gelang es, den ganzen Frühling hindurch weiter zu proben – und sogar das traditionelle Frühlingskonzert fand als "Wohnzimmerkonzert" am 2. Juli statt. Die Chormitglieder nahmen ihre Stimmen getrennt voneinander zu Hause auf, dann wurden sie digital zu einem virtuellen Chor zusammengefügt und auf YouTube präsentiert.
Mit einem seiner Musikvideos konnte der TU Wien Chor nun einen großen internationalen Chorwettbewerb gewinnen: Beim INTERKULTUR Video Award wurden insgesamt 128 virtuelle Chorvideos aus der ganzen Welt eingereicht. Eine Fachjury wählte in drei Kategorien jeweils einen Sieger aus – und der Chor der TU Wien konnte sich in der Kategorie "Chöre A Capella" durchsetzen.
“Ich war beeindruckt und überrascht von der hohen Qualität und Kreativität, die die Chöre in ihren Einsendungen vorgelegt haben. Man sieht in vielen Beiträgen, dass sie all ihr Herzblut in die Produktion ihres virtuellen Chorvideos gelegt haben und damit ein hervorragendes Ergebnis erzielen konnten“, sagt Jurymitglied Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß.
Deepfake bringt Bewegung ins Foto
Für das Video von "Some Nights" (Nate Ruess, arr. Andy Black) ließ sich der TU Wien Chor etwas Besonderes einfallen: Um ein lebendiges, bewegtes Chorvideo zu erhalten, griff man auf "Deepfake"-Technologie zurück. Gewöhnliche unbewegte Fotos wurden verwendet, um daraus bewegte Gesichter zu erstellen – mit Lippenbewegungen, die perfekt zum Gesang passen. Eine Person wird beim Singen gefilmt, und die Gesichts- und Mundbewegungen werden digital auf die unbewegten Fotos übertragen. Sogar Zeichnungen oder Stofftiere kann man damit virtuell zum Singen bringen, wie das Video beweist.
"Für uns als Chor der TU Wien ist es natürlich besonders passend, wenn wir Kunst und Technologie zusammenführen", sagt Chorleiter Andreas Ipp. Er selbst verwendet am Institut für Theoretische Physik der TU Wien maschinelles Lernen, um die Geheimnisse des Quark-Gluon-Plasmas zu entschlüsseln – dabei handelt es sich um einen exotischen Materiezustand, der kurz nach dem Urknall das Universum dominierte. "Und maschinelles Lernen steckt auch hinter der Deepfake-Technologie, die wir für unser Video verwendet haben", erklärt Ipp.
Das Sieger-Video und ein Video zur Preisvergabe finden Sie auf der TU-Website:
https://www.tuwien.at/tu-wien/aktuelles/news/news/tu-wien-chor-gewinnt-online-chorwettbewerb/
Christiana Hörbiger Preis für Kevin Pichler
Kevin Pichler, Doktorand am Institut für Theoretische Physik, gewinnt eine Förderung seiner Forschungsreisen durch den Christiana Hörbiger Preis.
Kevin Pichler
Kevin Pichler forscht im Rahmen seiner Dissertation im Gebiet der nicht-Hermiteschen Physik; konkret arbeitet er momentan theoretisch und experimentell an der ersten Realisierung eines Random Anti-Lasers in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Nizza (F).
Zur Unterstützung seiner Forschungsreisen darf er sich bereits zum zweiten Mal über den Christiana Hörbiger Preis freuen. Sie ist hochwillkommen, um seinen Besuch am Forschungsinstitut RIKEN in Saitama (Japan) sowie den Besuch der Konferenz WOMA 2020 in Hongkong zu ermöglichen.
Der Christiana Hörbiger Preis reiht sich in eine beachtliche Zahl von Preisen und Auszeichnungen für Kevin Pichlers bisherige Leistungen ein (mehrere Leistungsstipendien, Würdigungspreis des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, …).
Eine Fernsteuerung für alles Kleine
Atome, Moleküle oder sogar lebende Zellen lassen sich mit Lichtstrahlen manipulieren. An der TU Wien entwickelte man eine Methode, die solche „optischen Pinzetten“ revolutionieren soll.
Maßgeschneiderte Welle
Intensitätsverteilung eines elektrischen Wellenfeldes, das ein wohldefiniertes Drehmoment auf das quadratische Target ausübt.
(Download und Verwendung honorarfrei / free to download and reprint © TU Wien)
Sie erinnern ein bisschen an den „Traktorstrahl“ aus Star Trek: Spezielle Lichtstrahlen werden heute dafür verwendet, Moleküle oder kleine biologische Partikel zu manipulieren. Sogar Viren oder Zellen können damit festgehalten oder gezielt bewegt werden. Allerdings funktionieren diese Lichtpinzetten nur, wenn sich das festgehaltene Objekt im leeren Raum befindet. Jede störende Umgebung würde die Lichtwellen ablenken und den Effekt kaputtmachen. Gerade bei biologischen Proben ist das ein Problem, denn sie sind meistens in eine räumlich sehr komplexe Umgebung eingebettet.
An der TU Wien wurde nun gezeigt, wie man aus dieser Not eine Tugend machen kann: Eine spezielle Rechenmethode wurde entwickelt, um die optimale Lichtwellenform zu ermitteln, mit der man die kleinen Teilchen in Anwesenheit einer störenden Umgebung manipulieren kann. So wird es möglich, einzelne biologische Teilchen im Inneren einer Probe festzuhalten, sie zu bewegen oder zu drehen – auch wenn man sie nicht direkt berühren kann. Der maßgeschneiderte Lichtstrahl wird zur Universal-Fernbedienung für alles Kleine. Mit Mikrowellen-Experimenten wurde bereits demonstriert, dass die Methode funktioniert. Die neue Lichtpinzetten-Technik wurde nun im Fachjournal „Nature Photonics“ vorgestellt.
Optische Pinzetten in schmutziger Umgebung
„Laserstrahlen zur Manipulation von Materie einzusetzen ist längst nichts Ungewöhnliches mehr“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. 1997 wurde der Physik-Nobelpreis für Laserstrahlen vergeben, mit denen sich Atome abbremsen und damit abkühlen ließen, 2018 gab es einen Physik-Nobelpreis für die Entwicklung von optischen Pinzetten.
Doch Lichtwellen sind empfindlich: In einer ungeordneten, unregelmäßigen Umgebung können sie auf hochkomplizierte Weise abgelenkt und in alle Richtungen gestreut werden. Aus einer völlig regelmäßigen Lichtwelle wird dann ein wirres, ungeordnetes Wellenmuster. Die Wirkung auf ein bestimmtes Partikel, das man manipulieren möchte, kann sich dadurch völlig verändern.
„Diesen Streu-Effekt kann man jedoch kompensieren“, erklärt Michael Horodynski, Erstautor der Studie. „Im Speziellen berechnen wir, wie man die Welle anfangs formen muss, damit sie von den Unregelmäßigkeiten einer ungeordneten Umgebung genau in die Form gebracht wird, die wir wollen.“ Die Lichtwelle sieht in diesem Fall zunächst also recht ungeordnet und chaotisch aus, wird durch die ungeordnete Umgebung aber zu etwas Geordnetem. Die vielen kleinen Störungen, die normalerweise das Experiment unmöglich machen, nützt man hier aus, um genau die gewünschte Wellenform zu erzeugen, die dann an einem bestimmten Partikel ihre Wirkung entfaltet.
Die optimale Welle berechnen
Damit das gelingt, wird das Partikel samt seiner ungeordneten Umgebung zunächst mit verschiedenen Wellen beleuchtet. Dabei misst man, auf welche Weise die Wellen reflektiert werden. Diese Messung führt man zweimal kurz hintereinander durch. „Angenommen, in der kurzen Zeit zwischen den beiden Messungen bleibt die ungeordnete Umgebung ziemlich gleich, während sich das Partikel, das wir manipulieren wollen, ein kleines bisschen verändert“, sagt Stefan Rotter. „Denken wir etwa an eine Zelle die sich bewegt, oder einfach nur ein winziges Stück nach unten sinkt. Dann wird die Lichtwelle, die wir hineinschicken bei der zweiten Messung ein kleines bisschen anders reflektiert als beim ersten Mal.“ Und genau dieser winzige Unterschied ist entscheidend: Mit der neuen Rechenmethode des Forschungsteams an der TU Wien kann man daraus berechnen, welche Welle man verwenden muss, um diese Partikelbewegung zu verstärken oder abzuschwächen.
„Wenn das Partikel langsam nach unten sinkt, können wir eine Welle berechnen, die dieses Absinken verhindert, oder das Partikel noch schneller absinken lässt“, sagt Stefan Rotter. „Wenn sich das Partikel ein kleines bisschen dreht, dann können wir eine Welle berechnen, die den maximalen Drehimpuls überträgt – wir bringen somit das Partikel dann mit einer speziell geformten Lichtwelle zum Rotieren, ohne es direkt zu berühren.“
Erfolgreiche Experimente mit Mikrowellen
Kevin Pichler, ebenfalls Teil des Forschungsteams an der TU Wien, konnte bei Projektpartnern an der Universität Nizza (Frankreich) die Rechenmethode in der Praxis umsetzen: Er verwendete zufällig angeordnete Teflon-Objekte, die er mit Mikrowellen bestrahlte – und tatsächlich gelang es auf diese Weise, genau jene Wellenformen zu erzeugen, die durch die Unordnung des Systems am Ende genau die gewünschte Wirkung zeigten.
„Das Mikrowellenexperiment zeigt, dass unsere Methode funktioniert“, berichtet Stefan Rotter. „Aber das eigentliche Ziel ist, sie nicht mit Mikrowellen sondern mit sichtbarem Licht einzusetzen. Das könnte für optische Pinzetten völlig neue Anwendungsgebiete erschließen und speziell in der biologischen Forschung erlauben, kleine Partikel auf eine Weise zu kontrollieren, die bisher völlig unmöglich war.“
Originalpublikation:
M. Horodynski et al., Optimal wave fields for micromanipulation in complex scattering environments, Nature Photonics (2019):
https://www.nature.com/articles/s41566-019-0550-z
Frei zugängliche Version: https://arxiv.org/abs/1907.09956
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Rätsel gelöst: Das Quantenleuchten dünner Schichten
Eine ganz spezielle Art von Licht wird von Wolfram-Diselenid-Schichten ausgesandt. Warum das so ist, war bisher unklar. An der TU Wien wurde nun eine Erklärung gefunden.
Lukas Linhart (l) und Florian Libisch (r)
(Download und Verwendung honorarfrei © TU Wien)
Es ist ein merkwürdiges Phänomen, das jahrelang niemand erklären konnte: Wenn man einer dünnen Schicht des Materials Wolfram-Diselenid Energie zuführt, dann beginnt es auf sehr merkwürdige Weise zu leuchten. Zusätzlich zu ganz gewöhnlichem Licht, wie man es auch von anderen Halbleitermaterialien kennt, misst man bei Wolfram-Diselenid auch noch eine ganz spezielle Sorte von extrem hellem Quantenlicht, das nur von ganz bestimmten Punkten des Materials abgestrahlt wird. Es besteht aus einer Serie von Photonen, die regelmäßig wie am Fließband immer einzeln ausgesandt werden – niemals zu zweit oder in größeren Gruppen. Für Experimente im Bereich von Quanteninformation und Quantenkryptographie, bei denen man mit einzelnen Photonen arbeiten möchte, ist das perfekt. Allerdings wusste bisher niemand, wie dieser Effekt zustande kommt.
An der TU Wien fand man nun die Lösung: Ein subtiles Zusammenspiel aus einzelnen atomaren Fehlstellen im Material und mechanischen Dehnungen ist für das Entstehen des Lichteffekts verantwortlich. Durch Computersimulationen konnte man zeigen, wie die Elektronen an ganz bestimmte Stellen des Materials getrieben werden, wo wie eingefangen werden, Energie verlieren und ein Photon aussenden. Die Lösung des Quantenlicht-Rätsels wurde nun im Fachjournal „Physical Review Letters“ veröffentlicht.
Nur drei Atome dick
Wolfram-Diselenid ist ein sogenanntes 2D-Material, das extrem dünne Schichten bildet. Solche Schichten sind nur drei Atomlagen dick: In der Mitte befinden sich die Wolfram-Atome, darüber und darunter sind die Selen-Atome angekoppelt. „Wenn man der Schicht Energie zuführt, etwa indem man eine elektrische Spannung anlegt oder indem man es mit Licht der richtigen Wellenlänge bestrahlt, dann beginnt sie zu leuchten“, erklärt Lukas Linhart vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das ist noch nicht ungewöhnlich, das können viele Materialien. Doch als man das Licht von Wolfram-Diselenid im Experiment genau analysierte, stellte man fest, dass man hier zusätzlich zum gewöhnlichen Licht auch noch eine weitere, quantenphysikalisch ganz besondere Art von Licht nachweisen kann, und dass diese Sorte Licht ganz ungewöhnliche Eigenschaften aufweist.“
Dieses spezielle Quantenlicht besteht aus Photonen ganz bestimmter Wellenlängen – und niemals misst man zwei Photonen derselben Wellenlänge gleichzeitig, sie werden immer einzeln ausgesandt. „Das sagt uns, dass diese Photonen nicht kollektiv vom ganzen Material erzeugt werden können, sondern dass es bestimmte Punkte in der Wolfram-Diselenid-Probe geben muss, die sehr viele dieser Photonen produzieren, eins nach dem anderen“, erklärt Prof. Florian Libisch, Sprecher des Graduiertenkollegs TU-D an der TU Wien, mit Schwerpunkt zweidimensionale Materialien.
Um das zu verstehen, muss man das Verhalten der Elektronen im Material auf quantenphysikalischer Ebene genau analysieren: Elektronen können sich im Wolfram-Diselenid in unterschiedlichen Energiezuständen befinden. Wechselt ein Elektron von einem Zustand hoher Energie in einen Zustand niedrigerer Energie, wird ein Photon ausgesandt. Allerdings ist dieser Sprung zu einer niedrigeren Energie nicht immer und überall erlaubt: Das Elektron muss sich dabei an bestimmte Gesetze halten – an Impuls- und Drehimpulserhaltung.
Materialfehler und Dehnungen
Wenn sich ein Elektron in einem Zustand hoher Energie befindet, muss es zunächst dort bleiben. Durch bestimmte Störungen im Material können sich die Energiezustände aber deutlich verändern. „Eine Wolfram-Diselenid-Schicht ist niemals perfekt. An manchen Stellen fehlt ein Selen-Atom, oder auch mehrere“, erklärt Lukas Linhart. „Dadurch ändert sich auch die Energie der Elektronen-Zustände in diesem Bereich.“
Außerdem ist die Materialschicht in der Praxis keine perfekte Ebene. Wie bei einer Bettdecke, die Falten wirft, wenn man sie über einen Kopfpolster breitet, dehnt sich Wolfram-Diselenid lokal, wenn die Materialschicht auf kleinen Trägerstrukturen aufgehängt ist. Diese mechanischen Spannungen haben ebenfalls eine Auswirkung auf die Energiezustände der Elektronen.
„Das Zusammenspiel von Materialfehlern und lokalen Dehnungen ist kompliziert. Uns ist es nun allerdings gelungen, beides gemeinsam am Computer zu simulieren“, sagt Lukas Linhart. „Und dabei zeigte sich, dass nur die Kombination dieser Effekte die merkwürdigen Lichteffekte erklären kann.“ Dort, wo Materialfehler und Oberflächen-Dehnungen zusammentreffen, ändern sich die Energieniveaus der Elektronen, sodass es den Elektronen genau an diesen Stellen physikalisch erlaubt ist, von einem hohen in einen niedrigen Energiezustand zu wechseln und ein Photon auszusenden. Weil quantenphysikalisch niemals zwei Elektronen genau im selben Zustand sein können, müssen die Elektronen diesen Prozess einzeln und nacheinander durchlaufen, und das führt auch zu einzeln nacheinander ausgesendeten Photonen. Gleichzeitig sorgt die Dehnung des Materials dafür, dass sich weitere Elektronen in der Nähe sammeln, und somit nach Aussenden eines Photons gleich wieder ein weiteres passendes Elektron nachrückt, das dann für das nächste Photon sorgt.
Das Ergebnis ist ein weiterer Beleg dafür, dass 2D-Materialien, die nur aus einer atomar dünnen Schicht bestehen, hochinteressante neue Effekte ermöglichen. Spätestens seit dem Physik-Nobelpreis im Jahr 2010 für die Entdeckung des 2D-Materials Graphen gilt diese Forschung weltweit als wichtiges Zukunftsthema.
Originalpublikation:
L. Linhart et al, Localized Intervalley Defect Excitons as Single-Photon Emitters in WSe2, Phys. Rev. Lett. 123, 146401 (2019):
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.123.146401
Kontakt:
Prof. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
florian.libisch@tuwien.ac.at
Dipl.-Ing. Lukas Linhart
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
lukas.linhart@tuwien.ac.at
Quanten-Vakuum: Weniger Energie als null
Kann man sich aus dem leeren Raum Energie ausleihen, und muss man sie wieder zurückgeben? Energien kleiner als null sind erlaubt – zumindest innerhalb bestimmter Grenzen.
Das Vakuum ist in der Quantenphysik eine komplizierte Sache.
(Download und Verwendung honorarfrei © TU Wien)
Energie ist eine Größe, die immer positiv sein muss – das sagt uns zumindest unsere Intuition. Wenn man aus einem bestimmten Volumen jedes einzelne Teilchen entfernt, bis es dort nichts mehr gibt, das Energie tragen könnte, dann muss doch Schluss sein. Oder lässt sich dann immer noch Energie herausholen?
Die Quantenphysik hat immer wieder gezeigt, dass sie unserer Intuition widerspricht, und so ist es auch in diesem Fall: Unter bestimmten Bedingungen sind negative Energien erlaubt, zumindest in einem gewissen Bereich von Raum und Zeit. In welchem Rahmen das möglich ist, hat nun ein internationales Forschungsteam der TU Wien, der Université libre de Bruxelles (Belgien) und dem IIT Kanpur (Indien) untersucht. Dabei zeigt sich: Egal, welche Quantentheorien betrachtet, egal, welche Symmetrien man im Universum als gegeben voraussetzt – es gibt immer gewisse Grenzen, an die man sich beim „ausleihen“ von Energie halten muss. Lokal kann die Energie kleiner als null sein, aber wie beim Geldausleihen von der Bank muss man den Betrag am Ende zurückzahlen.
Abstoßende Gravitation
„In der Relativitätstheorie geht man normalerweise davon aus, dass die Energie immer und überall größer als null sein muss“, sagt Prof. Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Das hat eine ganz wichtige Konsequenz für die Gravitation: Über die Formel E=mc² ist Energie mit Masse verknüpft. Negative Energie würde somit auch negative Masse bedeuten. Positive Massen ziehen einander an, aber mit einer negativen Masse könnte die Gravitation plötzlich zu einer abstoßenden Kraft werden.
Die Quantentheorie allerdings erlaubt so etwas. „Nach der Quantenphysik ist es möglich, sich Energie an einem bestimmten Ort gewissermaßen aus dem Vakuum auszuleihen, wie Geld bei der Bank“, sagt Daniel Grumiller. „Offen blieb lange Zeit die Frage, wie hoch dieser Kredit maximal sein darf, und mit welchen Zinsen man ihn zurückzahlen muss.“ Über diese „Zinsen“ (in der Literatur als „Quantum Interest“ bekannt) gab es verschiedene Vermutungen, aber kein umfassendes Resultat.
Die sogenannte „Quantum Null Energy Condition“ (QNEC), die im Jahr 2017 bewiesen wurde, schreibt bestimmte Grenzen für das „Ausleihen“ von Energie vor, indem sie Relativitätstheorie und Quantenphysik miteinander verknüpft: Eine Energie kleiner als null ist demnach erlaubt, aber nur in einem bestimmten Gebiet und nur für bestimmte Zeit. Wie viel Energie sich man vom Vakuum ausborgen kann, bevor der energetische Kreditrahmen ausgeschöpft ist, hängt mit einer quantenphysikalischen Größe zusammen, der sogenannten Verschränkungsentropie.
„Diese Verschränkungsentropie ist in gewissem Sinn ein Maß dafür, wie quantenphysikalisch sich ein System verhält“, sagt Daniel Grumiller. „Wenn sich irgendwo im Universum ein Objekt befindet, bei dem quantenphysikalische Verschränkungen eine sehr große Rolle spielen, zum Beispiel der Rand eines schwarzen Lochs, dann kann dort für gewisse Zeit ein negativer Energiefluss entstehen, sodass negative Energien möglich werden.
Grumiller konnte diese speziellen Berechnungen nun gemeinsam mit Max Riegler und Pulastya Parekh verallgemeinern. Max Riegler hat seine Dissertation in der Forschungsgruppe von Daniel Grumiller an der TU Wien abgeschlossen und arbeitet ab Oktober als Postdoc in Harvard, Pulastya Parekh vom IIT in Kanpur (Indien) war am Erwin-Schrödinger-Institut und an der TU Wien zu Gast.
„Alle bisherigen Betrachtungen bezogen sich auf Quantentheorien, die den Symmetrien der speziellen Relativitätstheorie folgen. Wir konnten nun aber zeigen, dass diese Verbindung zwischen negativer erlaubter Energie und Quantenverschränkungen ein viel allgemeineres Phänomen ist“, erklärt Grumiller. Die Energiebedingungen, die ein Absaugen unendlicher Energiemengen aus dem Vakuum eindeutig verbieten, gelten unabhängig der speziellen Symmetrien für ganz unterschiedliche Quantentheorien.
Der Energieerhaltungssatz lässt sich nicht überlisten
Mit mystischen „Over-Unity-Maschinen“, die angeblich aus dem Nichts Energie erzeugen, wie sie in esoterischen Kreisen immer wieder präsentiert werden, hat das freilich nichts zu tun. „Dass die Natur für gewisse Zeit an einem bestimmten Ort eine Energie kleiner als null erlaubt, bedeutet nicht, dass der Energieerhaltungssatz verletzt wird“, betont Daniel Grumiller. „Um an einem bestimmten Ort negative Energieflüsse zu ermöglichen, muss es in der näheren Umgebung kompensierende positive Energieflüsse geben.“
Auch wenn die Sache etwas komplizierter ist als man früher dachte: Energie lässt sich nicht aus dem Nichts gewinnen. Durch die neuen Forschungsergebnisse lässt sich nun aber besser verstehen, wie Relativitätstheorie und Quantentheorien bei dieser Frage subtil miteinander zusammenhängen.
Originalpublikation:
D. Grumiller, P. Parekh and M. Riegler, Phys.Rev.Lett. 123 (2019) 121602, DOI: 10.1103/PhysRevLett.123.121602
Frei zugängliche Version: https://arxiv.org/abs/1907.06650
Kontakt:
Prof. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
daniel.grumiller@tuwien.ac.at
Ein Metronom für Quantenteilchen
Ein neues Messprotokoll, entwickelt an der TU Wien, macht es möglich, die quantenphysikalische Phase von Elektronen zu messen – ein wichtiger Schritt für die Attosekundenphysik.
Joachim Burgdörfer, Stefan Donsa und Iva Brezinova
Download und Abdruck honorarfrei, (c) TU Wien
Ähnlich wie man mit der Elektronenmikroskopie winzige räumliche Strukturen sichtbar machen kann, gelingt es der Attosekundenphysik, extrem kurze Zeiträume zu vermessen: Mit Hilfe von kurzen Laserpulsen können heute physikalische Prozesse erforscht werden, die auf einer Zeitskala von Attosekunden ablaufen – das sind Milliardstel einer Milliardstelsekunde.
So kann man zum Beispiel genau untersuchen, wie ein einzelnes Atom ionisiert wird und ein Elektron das Atom verlässt. Das Elektron verhält sich dabei nicht einfach wie ein punktförmiges Teilchen, sondern seine quantenphysikalischen Welleneigenschaften treten zu Tage: Das Elektron ist in Wahrheit eine Elektronenwelle, die auf extrem kurzer Zeitskala und winziger Längenskala oszilliert. Die exakte Periodendauer dieser Oszillation zu messen, ist bereits eine Herausforderung. Noch viel schwieriger ist es, die exakte Phase der Elektronen-Oszillation zu ermitteln: Welchem Taktschlag folgt diese Oszillation? Wenn ein Elektron auf zwei verschiedene Weisen ionisiert werden kann, oszillieren dann beide exakt synchron, oder leicht zeitversetzt, also phasenverschoben? Ein Team der TU Wien und des CREOL College an der University of Central Florida entwickelte nun eine Methode, die Phase solcher Elektronen zu vermessen. Das ermöglicht einen neuen, besseren Blick auf wichtige Phänomene, wie man sie etwa für Photosensoren oder für Photovoltaik benötigt.
Im Takt oder gegeneinander?
„Die Phase einer Quantenwelle gibt Auskunft darüber, wann und wo Wellenberge und Wellentäler zu finden sind“, erklärt Stefan Donsa, der im Rahmen seiner Dissertation in der Forschungsgruppe von Prof. Joachim Burgdörfer (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) die neue Messmethode entwickelt hat. „Wenn sich zwei Wellen so überlagern, dass jeder Wellenberg der einen Welle auf einen Wellenberg der anderen Welle trifft, dann addieren sie sich. Aber wenn man eine der Wellen ein bisschen verschiebt, sodass sich der Wellenberg der einen mit dem Wellental der anderen Welle überlagert, können sie einander auch auslöschen.“ Daher hat diese Phasenverschiebung in der Quantenphysik eine ganz wichtige Bedeutung.
Es ist ähnlich wie in der Musik: Es genügt nicht, wenn zwei Musiker im gleichen Tempo spielen. Ihre Taktschläge müssen auch noch zeitlich genau zusammenfallen, ohne Phasenverschiebung dazwischen. Dafür braucht man einen Referenz-Taktgeber, etwa den Dirigenten oder ein Metronom. Etwas Ähnliches setzte das Team von der TU Wien auch im neuen Quanten-Messprotokoll ein: Ein atomarer Prozess dient als Takt-Referenz für den anderen.
Ein oder zwei Photonen
„Wir haben in Computersimulationen Helium-Atome untersucht, die von Laserpulsen unterschiedlicher Energie ionisiert werden“, sagt Iva Brezinova (ebenfalls TU Wien). „Das Helium-Atom kann ein Photon aus dem Laserpuls absorbieren und dabei ein Elektron abgeben. Dieses Elektron hat danach eine ganz bestimmte Phase, die zu messen allerdings extrem schwierig ist.“
Der Kunstgriff des neu entwickelten Verfahrens besteht nun darin, einen zweiten quantenphysikalischen Effekt als Taktgeber mit dazu zu nehmen – gewissermaßen als Quanten-Metronom: Das Atom kann nämlich bei passender Versuchsanordnung auch zwei Photonen absorbieren. Diese Doppel-Absorption führt zum selben Effekt – einem davonfliegenden Elektron mit ganz bestimmter Energie. Dieses Elektron hat diesmal aber eine andere Phase, und diesen Unterschied kann man messen.
Komplizierte Messprotokolle
In der Attosekundenphysik ist es nicht möglich, ein quantenphysikalisches Phänomen einfach zu filmen, wie mit einer Kamera. Stattdessen muss man komplizierte experimentelle Protokolle einsetzen. Eine ganze Reihe solcher Protokolle wird derzeit verwendet, doch keines erlaubte bislang die direkte Messung der Elektronenphase.
Mit dem neuen Protokoll, das nun vom Team der TU Wien entwickelt wurde, soll das nun möglich werden. „Unser neues Messprotokoll erlaubt es durch eine Kombination ganz spezieller Laserpulse, die Information über die Phase des Elektrons in seine räumliche Verteilung zu übersetzen“, erklärt Stefan Donsa. „Durch das Verwenden der richtigen Art von Laserpulsen kann man am Ende aus der Winkelverteilung der Elektronen die Phasenlage direkt auslesen.“
Das neu vorgeschlagene Versuchsprotokoll wurde nun im Fachjournal „Physical Review Letters“ publiziert. Nun sollen Experimente zeigen, welche quantenphysikalischen Informationen sich mit dem neuen Messprotokoll in der Praxis messen lassen.
Originalpublikation:
S. Donsa et al., "Circular Holographic Ionization-Phase Meter", Phys. Rev. Lett. 123, 133203, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.133203:
Kontakt:
Dipl.-Ing. Stefan Donsa
Institut für Theoretische Physik
stefan.donsa@tuwien.ac.at
Meilensteine auf dem Weg zur Atomkern-Uhr
Zwei Forschungsteams gelang es gleichzeitig, den lang gesuchten Kern-Übergang von Thorium zu messen, der extrem präzise Atomkern-Uhren ermöglicht. Die TU Wien ist an beiden beteiligt.
Mit Hilfe von Thorium soll eine neue Generation extrem präziser Uhren möglich werden.
(Download und Verwendung honorarfrei © TU Wien)
Wenn man die exakteste Uhr der Welt bauen möchte, braucht man einen Taktgeber, der sehr oft und extrem präzise tickt. In einer Atomuhr nutzt man dafür die Elektronen in einem Atom, die auf sehr exakt definierte Weise zwischen zwei verschiedenen Zuständen hin und her wechseln können. Noch deutlich exakter allerdings wären Atomkern-Uhren, die nicht Zustände der Elektronen, sondern Zustände des Atomkerns als Taktgeber nutzen.
Seit Jahrzehnten suchte man nach passenden Atomkernen für diesen Zweck, und schon lange vermutete man, dass Thorium-Kerne einen geeigneten Kernzustand haben müssten, der zum Bau einer neuen Generation von Hochpräzisions-Uhren taugt. Dieser langgesuchte Kernzustand von Thorium konnte nun erstmals experimentell nachgewiesen werden – und zwar gleich zweimal, von zwei unterschiedlichen internationalen Forschungsteams. Die TU Wien war an beiden Experimenten maßgeblich beteiligt. Die Resultate der beiden Experimente wurden nun gleichzeitig im Fachjournal „Nature“ publiziert.
Zwei benachbarte Energiezustände
„In der Kernphysik hat man es meist mit sehr hohen Energien zu tun“, erklärt Prof. Thorsten Schumm vom Atominstitut der TU Wien. „Die Energien der Elektronen, die den Atomkern umkreisen, sind normalerweise viel niedriger, daher kann man diese Elektronen etwa mit Laserstrahlen relativ leicht manipulieren. Bei Atomkernen ist dies üblicherweise nicht möglich.“
Thoriumkerne des Isotops 229 allerdings sind eine bemerkenswerte Ausnahme: „Knapp über dem Grundzustand – also dem Zustand mit der kleinstmöglichen Energie – gibt es erstaunlicherweise einen weiteren Kernzustand, den wir Isomer nennen“, sagt Thorsten Schumm. Der Energieunterschied zwischen diesen beiden Kernzuständen – dem Grundzustand und dem Isomer – ist um viele Größenordnungen geringer als in anderen Atomkernen. Er ist vergleichbar mit den Energien der Elektronen. Thorium-229 ist nach derzeitigem Wissen der einzige Kern, der einen solch nieder-energetischen Isomerzustand aufweist.
Der Übergang zwischen den beiden Thorium-Kernzuständen eignet sich ausgezeichnet für den Bau einer neuartigen Präzisions-Uhr. Kernzustände lassen sich noch präziser messen als Elektronenhüllen-Zustände, wie man sie in Atomuhren nutzt. Außerdem ist der Atomkern viel besser gegen Störungen geschützt, etwa gegen äußere elektromagnetische Felder. Das große Problem war bisher, dass man den exakten Energiewert des merkwürdigen Thorium-Isomerzustandes nicht kannte.
Komplizierte Messmethode
Weil die Suche nach diesem Kernzustand kompliziert und aufwändig ist, schlossen sich mehrere Teams zusammen: Forschungsgruppen aus Deutschland und Österreich (LMU München, MPI Heidelberg und TU Wien) entwickelten eine Methode, den gesuchten Kernzustand aufzuspüren: Wenn radioaktive Urankerne des Isotops 233 zerfallen, entstehen elektrisch geladene Thoriumionen – etwa 2 % von ihnen im gesuchten angeregten Kernzustand. Um diese Thoriumionen wieder elektrisch zu neutralisieren, lenkt man sie durch eine dünne Graphen-Schicht, aus der sich die Thoriumionen die fehlenden Elektronen holen. Danach können die neutralen Thoriumatome spontan vom angeregten Kernzustand in den tiefsten Kernzustand wechseln. Dabei wird Energie frei, und zwar in Form eines Elektrons, das fortgeschleudert wird. Die Energie dieses Elektrons wird gemessen – und wenn es gelingt, alle Details des komplizierten Experiments exakt zu kontrollieren und zu berechnen, kann man daraus auf die Energie des gesuchten Thorium-Kernzustandes schließen. Thorsten Schumm und Simon Stellmer vom Atominstitut halfen mit, das Experiment zu entwickeln, Florian Libisch und Christoph Lemell vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien führten Computersimulationen durch, die zu einer quantitativen Messung der Isomerenergie führten.
In Japan wurde gleichzeitig ein ganz anderes Experiment durchgeführt, und auch bei dieser Arbeit wirkte Thorsten Schumm von der TU Wien mit. Dort wurde ein Synchrotron verwendet, das extrem intensive Röntgenstrahlen produziert. Wenn man Thoriumkerne damit bestrahlt, kann man sie dadurch in den zweiten angeregten Kernzustand mit 1000-fach höherer Energie versetzen. Von diesem Zustand wechseln die Thoriumkerne dann vorwiegend in den gesuchten ersten angeregten Zustand, nahe beim Grundzustand – die Atome werden aktiv in den Isomerzustand „gepumpt“ und können dort vermessen werden.
Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten
„Das ist ein extrem wichtiger Schritt für uns: Wir wissen nicht nur, dass es den angeregten Zustand knapp über dem Grundzustand tatsächlich gibt, wir kennen nun auch seine Energie recht genau“, sagt Thorsten Schumm. In weiteren Messungen soll der Zustand nun noch besser vermessen werden, dann sollte es möglich sein, ihn für kompakte, hochpräzise Atomkern-Uhren zu nutzen – und solche Uhren würden ganz neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen: Sie wären ein großartiges Werkzeug für die Grundlagenforschung, etwa um dunkle Materie zu untersuchen oder um zu messen, ob unsere Naturkonstanten tatsächlich exakt konstant sind. Aber zusätzlich würde eine Atomkernuhr viele Messungen präziser machen, die vielleicht nur indirekt mit Zeitmessung in Verbindung stehen. Dazu zählt etwa die Vermessung winziger Unregelmäßigkeiten im Schwerefeld der Erde oder die genauere Positionierung von Objekten mittels Satelliten-basierter Navigation.
Originalpublikation:
Benedict Seiferle, Lars von der Wense, Pavlo V. Bilous, Ines Amersdorffer, Christoph Lemell, Florian Libisch, Simon Stellmer, Thorsten Schumm, Christoph E. Düllmann, Adriana Pálffy & Peter G. Thirolf, Energy of the 229Th nuclear clock transition, Nature (2019), DOI: 10.1038/s41586-019-1533-4:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1533-4
Christoph Lemell
christoph.lemell@tuwien.ac.at
Florian Libisch
florian.libisch@tuwien.ac.at
TU Wien
Institut für Theoretische Physik
Die Formel, die Bakterien stromaufwärts schwimmen lässt
Wie Bakterien es schaffen, gegen den Strom zu schwimmen, war bisher nicht klar. Ein Forschungsteam mit Beteiligung der TU Wien fand dafür eine physikalische Erklärung.
Ein Escherichia coli Bakterium - mit Flagellen
Bakterien können gegen den Strom schwimmen – und das ist oft ein ernstes Problem, etwa wenn sie sich in Wasserrohren oder in medizinischen Kathetern ausbreiten. Wie ihnen das gelingt, war bisher nicht klar. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung von Andreas Zöttl von der TU Wien, konnte diese Frage nun beantworten: Mit Hilfe von Experimenten und mathematischen Berechnungen konnte eine Formel gefunden werden, die alle wesentlichen Aspekte dieser erstaunlichen Bakterien-Bewegung beschreibt. Damit könnte es möglich werden, durch passendes Design von Röhrenoberflächen die Ausbreitung von Bakterien zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Communications“ publiziert.
Zwischen Physik und Biologie
Viele Bakterienarten, etwa die E. coli Bakterien, die im Wasser oft zur Gesundheitsgefahr werden können, bewegen sich mit Hilfe kleiner Geißelschwänzchen fort – den sogenannten Flagellen. „Man kann sich das allerdings nicht so vorstellen wie die Fortbewegung eines Fisches“, sagt Andreas Zöttl vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Fische spüren die Richtung der Strömung und können sich gezielt dafür entscheiden, in eine bestimmte Richtung zu schwimmen. Bakterien sind viel einfacher gebaut. Ihr Verhalten lässt sich durch ganz grundlegende physikalische Gesetzmäßigkeiten erklären.“
Oft lagern sich Bakterien an Oberflächen an, die von Flüssigkeiten überströmt werden – das kann die schlecht geputzte Duschkabine sein, ein Abwasserrohr oder auch ein Katheterschlauch. „An solchen Oberflächen ist das Verhalten der Bakterien besonders interessant“, sagt Andreas Zöttl. „Es zeigt sich nämlich, dass die Bakterien genau dort, direkt an den Oberflächen, oft gegen den Strom wandern.“ Sie werden also nicht mit dem Abwasser fortgespült, sondern schwimmen dem Fluss entgegen. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Stanford, der Universität Oxford und dem ESPCI in Paris machte sich Andreas Zöttl auf die Suche nach einer physikalischen Erklärung für diesen Effekt.
Theorie und Experiment
Andreas Zöttl arbeitete mit theoretisch-mathematischen Methoden: Er berechnete, wie ein Bakterium in einer strömenden Flüssigkeit ausgerichtet und gedreht werden kann, wie die Strömung mit der Bewegung der Flagellen zusammenwirkt und welche Bewegungsmöglichkeiten sich dadurch rein mathematisch ergeben. „Dabei gelangt man zu dem bemerkenswerten Ergebnis, dass es unterschiedliche, klar voneinander unterscheidbare Bewegungsarten gibt, je nach Stärke der Strömung“, erklärt Andreas Zöttl.
In leichten Strömungen drehen sich die Bakterien einfach im Kreis, ab einem bestimmten Punkt beginnen sie, sich gegen die Strömungsrichtung zu bewegen. In noch stärkeren Strömungen oszillieren sie an der Oberfläche hin und her, oder sie trennen sich in zwei unterschiedliche Gruppen, die in unterschiedliche Richtungen wandern. Mit einer einzigen mathematischen Formel kann eine ganze Palette an bakteriellen Bewegungsmustern erklärt werden.
Gleichzeitig entwickelte man in Paris technische Methoden, um die Bewegungen einzelner Bakterien mit speziell gesteuerten Mikroskopen zu messen – und bei diesen Messungen fand man genau dieselben klar unterscheidbaren Bewegungstypen, die auch die theoretischen Berechnungen ergeben hatten. „Das zeigt uns, dass unsere Theorie richtig ist“, sagt Andreas Zöttl. „Besonders schön daran ist, dass die Ergebnisse sehr robust sind: Sie hängen nicht empfindlich von irgendwelchen Details ab, daher lässt sich unsere Formel auf viele unterschiedliche Arten von Bakterien anwenden.“ Sogar DNA-Stränge, die im Zellplasma herumschwimmen, lassen sich mit der neuen Theorie korrekt beschreiben.
Das Team hofft, mit dem neugewonnenen Verständnis der Bewegungsmöglichkeiten von Bakterien nun Methoden finden zu können, die Bakterien an der Fortbewegung zu hindern. „Vielleicht kann man in Zukunft Katheter im Inneren mit einer bestimmten geometrischen Oberflächenstruktur ausstatten, die Bakterien an der Wanderungsbewegung gegen den Strom hindert“, hofft Andreas Zöttl.
Originalpublikation:
A. Mathijssen et al., Oscillatory surface rheotaxis of swimming E. coli bacteria, Nature Communicationsvolume 10, 3434 (2019):
https://www.nature.com/articles/s41467-019-11360-0
Kontakt:
Dr. Andreas Zöttl
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
andreas.zoettl@tuwien.ac.at
Wie man Wellen an die richtige Stelle biegt
Wellen breiten sich nicht immer regelmäßig aus – manchmal kommt es zum Phänomen der "Wellen-Verästelung". An der TU Wien fand man eine Methode, diesen Effekt zu kontrollieren.
Die Kontrolle der Wellen-Verästelung
Oben: Eine Lichtwelle wird in eine ungeordnete, unregelmäßige Umgebung eingestrahlt und teilt sich in mehrere verästelte Pfade auf. Unten: Durch gezieltes Formen der Welle am Einschuss (links), bewegt sich die Welle nur auf einer einzelnen vorher ausgewählten Bahn, anstatt sich zu verästeln.
Im freien Raum breitet sich die Lichtwelle eines Laserstrahls auf einer exakt geraden Linie aus. Unter bestimmten Umständen tritt jedoch ein deutlich komplizierteres Verhalten auf. Wenn die Bewegung der Welle durch eine ungeordnete, unregelmäßige Umgebung beeinflusst wird, kann es zu einem merkwürdigen Phänomen kommen: Die Welle teilt sich in mehrere Pfade auf, sie verästelt sich auf komplizierte Weise, manche Orte erreicht sie mit hoher Intensität, andere fast gar nicht.
Eine solche "Wellen-Verästelung" wurde 2001 erstmals beobachtet; jetzt hat man an der TU Wien eine Methode entwickelt, diesen Effekt gezielt zu nutzen. Kernidee dieser neuen Methode ist es, ein Wellensignal ausschließlich entlang eines einzelnen ausgewählten Astes zu senden, wodurch die Welle überall sonst kaum bemerkbar ist. Im Fachjournal PNAS wurden die Ergebnisse nun veröffentlicht.
Vom Quantenteilchen bis zum Tsunami
"Ursprünglich hat man diesen Effekt entdeckt, indem man Elektronen untersuchte, die sich als Quanten-Wellen durch winzige Mikrostrukturen bewegen", erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. "Solche Strukturen, durch die man die Elektronen schickt, sind niemals perfekt, es gibt immer gewisse Unregelmäßigkeiten; und die führen erstaunlicherweise dazu, dass sich die Elektronenwelle aufspaltet und verästelt, weshalb sich der Begriff 'Branched Flow' für dieses Phänomen etabliert hat."
Bald erkannte man, dass dieses Wellenphänomen nicht nur in der Quantenphysik vorkommt, sondern prinzipiell bei allen Arten von Wellen auf ganz unterschiedlichen Größenskalen möglich ist. Wenn man etwa Laserstrahlen in die Oberfläche einer Seifenblase einlaufen lässt, teilen sie sich ebenso in mehrere Teilstrahlen auf wie auch Tsunami-Wellen im Meer: Auch letztere breiten sich nicht regelmäßig quer über den Ozean aus, sondern in einem komplizierten, verästelten Muster, das von der zufälligen Form des Ozeanbodens abhängt. Somit kann es passieren, dass eine weit entfernte Insel sehr heftig von einem Tsunami getroffen wird, während die Nachbarinsel nur von viel schwächeren Wellenfronten erreicht wird.
"Wir wollten nun wissen, ob man diese Wellen so beeinflussen kann, dass sie sich nicht mehr entlang eines verzweigten Geflechts an Pfaden in ganz unterschiedliche Richtungen ausbreiten, sondern auf einer einzelnen vorher ausgewählten Bahn bleiben", erklärt Andre Brandstötter (TU Wien), Erstautor der Publikation. "Und wie sich zeigt, ist es tatsächlich möglich, einzelne Äste gezielt anzusteuern."
Erst messen, dann anpassen
Man benötigt dafür zwei Schritte: Zunächst lässt man die Welle sich wie gewohnt auf allen Bahnen verästeln. An einem der Orte, die mit hoher Intensität erreicht werden, wird die Welle nun genau vermessen. Mit der Methode, die an der TU Wien nun entwickelt wurde, kann man daraus dann berechnen, wie die Welle beim Einschuss geformt werden muss, damit sie sich danach im zweiten Schritt nur noch entlang der ausgewählten Bahn bewegt und alle anderen Bahnen meidet.
"Wir haben mithilfe von numerischen Simulationen gezeigt, wie man eine Welle finden kann, die sich genau auf die gewünschte Weise verhält. Kennt man dieses Ergebnis, kann man es mit unterschiedlichen Methoden umsetzen", sagt Stefan Rotter. "Man kann es mit Lichtwellen machen, die mit speziellen Spiegelsystemen angepasst werden, oder mit Schallwellen, die man mit einem System gekoppelter Lautsprecher erzeugt. Auch Sonar-Wellen im Meer wären ein mögliches Anwendungsgebiet. Die nötigen Technologien dafür gibt es jedenfalls bereits."
All diese Wellen könnte man mit der neuen Methode entlang einer ausgewählten Bahn auf die Reise schicken. Vom verästelten Netzwerk der Pfade, auf denen sich die Welle vorher bewegte, bleibt nur noch ein einzelner Weg übrig. "Dieser Pfad muss nicht einmal gerade sein", erklärt Andre Brandstötter. "Viele der möglichen Wege sind gekrümmt – die Unregelmäßigkeiten der Umgebung wirken wie mehrere Linsen, von denen die Welle immer wieder fokussiert und abgelenkt wird."
Sogar gepulste Signale lassen sich auf diesen speziellen Pfaden übertragen, sodass man darüber gezielt Information übermitteln kann. Damit kommt ein Wellensignal garantiert dort an, wo es empfangen werden soll, an anderen Orten kann es kaum detektiert und somit auch nicht abgehört werden.
Originalpublikation:
A. Brandstötter et al., Shaping the branched flow of light through disordered media, PNAS (2019):
https://www.pnas.org/content/early/2019/06/17/1905217116
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Die Physik der Bakterien
Mit einem Lise-Meitner-Stipendium kam Andreas Zöttl an die TU Wien. Nun untersucht er die Bewegung von Bakterien durch komplexe Flüssigkeiten.
Andreas Zöttl forscht am Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Wenn ein Farbtropfen ins Schwimmbecken fällt, dann breiten sich die Farbpartikel langsam aus. Die Gesetze, mit denen man berechnen kann, wie rasch sich die Farbe im Wasser bewegt, sind schon lange bekannt. Viel komplizierter ist es allerdings, die Bewegung von Bakterien durch biologische Flüssigkeiten zu berechnen. Dem Physiker Andreas Zöttl gelangen auf diesem Gebiet wichtige Erfolge. Mit einem Lise Meitner Stipendium des FWF wechselte er nun von der Universität Oxford an die TU Wien.
Zu kompliziert für reine Strömungslehre
"Viele Flüssigkeiten, die in der Biologie oder in der Medizin eine wichtige Rolle spielen, sind sehr kompliziert", sagt Andreas Zöttl. Durch den Schleim in unserer Nase bewegen sich Bakterien ganz anders als durch gewöhnliches Wasser. Auch die Ausbreitung von Krebszellen im Körper gehorcht eigenen Gesetzen. Oft enthalten biologische Flüssigkeiten viele große Moleküle oder Partikelcluster, oder sogar dicht gewobene Netze molekularer Strukturen, die sich ständig neu verbinden und wieder auflösen. Die gewöhnlichen Gesetze der Strömungsmechanik lassen sich dann kaum noch sinnvoll anwenden.
In Oxford untersuchte Andreas Zöttl die Bewegung eines Bakteriums mit spiralförmig gewundener Geißel. Die Geißel dreht sich im Kreis und treibt damit das Bakterium nach vorne. Nun könnte man annehmen, dass sich das Bakterium in einer zähflüssigen Substanz nur langsam und mühevoll fortbewegen kann - doch Messungen ergeben das Gegenteil: Unter bestimmten Bedingungen ist es in Flüssigkeiten mit hoher Viskosität sogar schneller.
"Das lässt sich mit einfachen Formeln nicht erklären. Um das zu verstehen, braucht man aufwändige Computersimulationen", sagt Andreas Zöttl. Er baut Bakterien am Computer virtuell nach und lässt sie durch eine ebenso computergenerierte Umgebung schwimmen, deren Eigenschaften man nach Belieben anpassen kann. Mit solchen Computerexperimenten kann man viele Effekte viel genauer und umfassender untersuchen als mit gewöhnlichen Experimenten in der Petrischale.
Allerdings hat man bei den Computersimulationen mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen: Die Bewegung von Bakterien findet auf einer unangenehmen Größenskala statt. Die relevanten Objekte sind zu klein, um sie problemlos als Kontinuum beschreiben zu können, weil sich Effekte auf molekularer Ebene bereits auswirken. Andererseits sind sie aber immer noch sehr groß im Vergleich zu einzelnen Atomen. Es ist völlig unmöglich, alle beteiligten Atome in die Computerberechnung einzubeziehen - das wären viel zu viele.
Man braucht daher kluge Näherungsmethoden und Vereinfachungen um dem Problem auf den Grund zu gehen – und selbst dann kann eine einzige Rechnung, durchgeführt von zahlreichen Prozessoren auf einem Großrechner, immer noch mehrere Wochen dauern. "Das gehört dazu in diesem Forschungsgebiet", sagt Andreas Zöttl. "Zum Glück steht an der TU Wien mit dem VSC3 ein ausgezeichneter Computercluster zur Verfügung."
Von Wien in die Welt und wieder zurück
Mit einem Lise Meitner Stipendium des österreichischen FWF kehrte Andreas Zöttl nun an seine Alma Mater zurück - er hatte 2009 sein Physik-Studium a der TU Wien abgeschlossen. Danach ging er nach Berlin, wo er 2014 promovierte. Die Computermethoden und Programmcodes, die er dabei entwickelte, verwendet er in überarbeiteter Form bis heute. Nach seiner Promotion arbeitete er als Postdoc an der Universität Oxford und für ein halbes Jahr auch in Paris, nun forscht er am Institut für Theoretische Physik in der Forschungsgruppe von Prof. Gerhard Kahl.
Dr. Andreas Zöttl
andreas.zoettl@tuwien.ac.at
Der Anti-Laser mit dem Zufallsprinzip
Das Konzept des Lasers lässt sich umkehren: Aus der perfekten Lichtquelle wird dann der perfekte Licht-Absorber. An der TU Wien konnte man nun zeigen, wie die Konstruktion dieses Anti-Lasers auf praxistaugliche Weise gelingt.
Experimenteller Aufbau des Anti-Lasers nach dem Zufallsprinzip: Im Inneren eines Wellenleiters befindet sich ein ungeordnetes Medium bestehend aus zufällig positionierten Teflon-Zylindern, an denen einlaufende Mikrowellensignale auf komplexe Art und Weise gestreut werden. In der Deckelplatte des Wellenleiters (am Foto zur Veranschaulichung geöffnet) ist eine zentrale Antenne eingebaut, welche die Mikrowellen absorbiert.
Das Team von der TU Wien: Kevin Pichler, Andre Brandstötter, Stefan Rotter und Matthias Kühmayer (v.l.n.r.)
Um perfekte Absorption zu erreichen, müssen sowohl die Frequenz des einlaufenden Signals als auch die Absorptionsstärke der zentralen Antenne genau eingestellt werden. Darüberhinaus ist es erforderlich, dass die Wellenform des eingespeisten Signals (sh. Antennen mit blauen Kabeln) präzise eingestellt wird.
Der Laser ist die perfekte Lichtquelle: Man muss ihm lediglich Energie zuführen und er erzeugt Licht einer ganz bestimmten, exakt definierten Farbe. Es ist allerdings auch möglich das Gegenteil herzustellen – nämlich Objekte, die Licht einer ganz bestimmten Farbe perfekt verschlucken und die Energie praktisch vollständig absorbieren.
An der TU Wien wurde nun eine Methode entwickelt, diesen Effekt nutzbar zu machen, und zwar sogar in extrem komplizierten Systemen, in denen Lichtwellen unregelmäßig und zufällig in alle Richtungen gestreut werden. Die Methode hat das Team der TU Wien mit Hilfe von Computersimulationen entwickelt und in Zusammenarbeit mit der Universität Nizza auch im Experiment bestätigt. Das eröffnet neue Möglichkeiten für alle technischen Disziplinen, die mit Wellenphänomenen zu tun haben. Die neue Methode wurde nun im Fachjournal „Nature“ publiziert.
Zufällige Strukturen, die Wellen verschlucken
„Im täglichen Leben haben wir es überall mit Wellen zu tun, die auf komplizierte Weise gestreut werden – denken Sie etwa an ein Mobilfunksignal, das mehrfach reflektiert wird, bevor es an Ihrem Handy ankommt“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Diese Vielfach-Streuung macht man sich in sogenannten Zufalls-Lasern zunutze. Solche exotischen Laser haben einen komplizierten, zufälligen inneren Aufbau und strahlen ein ganz bestimmtes, individuelles Lichtmuster aus, wenn man sie mit Energie versorgt.“
In mathematischen Analysen und Computersimulationen konnte Rotters Team zeigen, dass sich dieser Vorgang auch zeitlich umkehren lässt. Anstatt einer Lichtquelle, die abhängig von ihrem zufälligen Innenleben eine bestimmte Welle aussendet, kann man den perfekten Absorber bauen, der spezifisch für seine innere Struktur eine bestimmte Welle völlig verschluckt, ohne auch nur einen Teil davon wieder nach außen abzugeben. Vorstellen kann man sich dies so, als würde man einen Laser, der Licht aussendet, mit einer Filmkamera aufnehmen und diesen Film dann rückwärts abspielen.
„Wegen dieser Zeitumkehr-Analogie zu einem Laser bezeichnet man diese Art von Absorber als Anti-Laser“, sagt Stefan Rotter. „Bisher wurden solche Anti-Laser nur in eindimensionalen Strukturen realisiert, auf die man Licht aus gegenüberliegenden Richtungen lenkte. Unser Zugang ist viel allgemeiner. Wir konnten zeigen, dass selbst beliebig komplizierte Strukturen in mehreren Dimensionen eine maßgeschneiderte Welle perfekt absorbieren können. Damit öffnen wir dieses Konzept für breite Anwendungsmöglichkeiten.“
Der perfekte Wellen-Absorber
Die These der Wiener Forschungsgruppe: Für jedes Objekt, das Wellen ausreichend stark absorbiert, lässt sich eine bestimmte Wellenform finden, die von diesem Objekt perfekt verschluckt wird. „Es wäre allerdings falsch sich vorzustellen, dass der Absorber einfach nur stark genug gemacht werden muss, sodass er einfach jede einfallende Welle aufnimmt“, sagt Stefan Rotter. „Vielmehr handelt es sich um einen komplexen Streuprozess, bei dem sich die einfallende Welle in viele Teilwellen aufspaltet, die sich dann derart miteinander überlagern, dass keine der Teilwellen am Ende nach außen dringen kann.“ Der Absorber, der in einen solchen Antilaser eingebaut ist, muss gar nicht besonders stark absorbieren, es kann sich zum Beispiel um eine einfache kleine Antenne handeln, die von elektromagnetischen Wellen angeregt wird.
Um die Berechnungen zu testen, arbeitete das Team mit der Universität Nizza zusammen. Kevin Pichler, der Erstautor der Nature-Publikation, der derzeit im Team von Stefan Rotter an seiner Dissertation arbeitet, verbrachte mehrere Wochen bei Prof. Ulrich Kuhl an der Universität Nizza, um die Theorie anhand eines Mikrowellen-Experiments direkt in die Praxis umzusetzen. „Eigentlich ist es etwas ungewöhnlich, dass man als Theoretiker auch das Experiment selbst durchführt“, sagt Kevin Pichler. „Für mich war es jedoch besonders spannend, dieses Projekt vom theoretischen Konzept bis hin zur Umsetzung im Labor aktiv mitgestalten zu können.“
Der im Labor gebaute „Zufalls-Anti-Laser“ („Random Anti-Laser“) besteht aus einer Mikrowellenkammer mit einer zentralen Absorber-Antenne, umgeben von zufällig angeordneten Zylindern aus Teflon. Ähnlich wie Steine in einer Wasserpfütze, an denen Wasserwellen abgelenkt und reflektiert werden, können diese Zylinder Mikrowellen streuen und ein kompliziertes Wellenmuster erzeugen. „Zuerst sendet man von außen Mikrowellen auf dieses System und misst wie diese wieder zurückkommen“, erklärt Kevin Pichler. „Mit diesem Wissen lässt sich die Struktur vollständig charakterisieren. Daraus lässt sich dann eindeutig jene Welle berechnen, die von der zentralen Antenne bei der richtigen Absorptionsstärke vollständig verschluckt wird. Bei der Umsetzung dieses Protokolls im Experiment finden wir tatsächlich eine Absorption von ca. 99,8 % des einfallenden Signals.“
Die Anti-Laser-Technologie steht erst am Anfang, aber Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich überall, wo man es mit komplizierter Wellenstreuung zu tun hat. „Stellen wir uns zum Beispiel vor, man könnte ein Handy-Signal genau so anpassen, dass es perfekt von der Antenne in einem bestimmten Handy absorbiert wird “, sagt Stefan Rotter. „Auch in der Medizin hat man es oft mit der Aufgabe zu tun, Wellenenergie möglichst perfekt an einen ganz bestimmten Punkt zu transportieren – etwa Stoßwellen, die einen Nierenstein zertrümmern.“
Originalpublikation:
K. Pichler et al., Random anti-lasing through coherent perfect absorption in a disordered medium, Nature (2019), DOI: 10.1038/s41586-019-0971-3:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-0971-3
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Dipl.-Ing. Kevin Pichler
Institut für Theoretische Physik
kevin.pichler@tuwien.ac.at
ÖAW-Auszeichnungen: Sechsfacher TU-Erfolg, zweifach vom Institut für Theoretische Physik
Sechs junge Forscherinnen und Forscher der TU Wien wurden von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit Stipendien ausgezeichnet. Drei davon gehören der Fakultät für Physik an, zwei sind am Institut für Theoretische Physik beheimatet.
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und die Max Kade Foundation vergaben auch dieses Jahr wieder Stipendien. Insgesamt 99 junge Forscherinnen und Forscher, die mit ihren Projekten überzeugen konnten, werden nun bis zu drei Jahre lang in ihrer Forschungstätigkeit unterstützt.
Unter den Ausgezeichneten waren diesmal sechs Preisträger_innen der TU Wien, zwei davon vom Institut für Theoretische Physik:
Andre Brandstötter (Institut für Theoretische Physik) erhält ein DOC-Stipendium für sein Projekt „Photonik in absorbierenden und ungeordneten Medien“. Er forscht an der Frage, wie man Licht in stark ungeordneten und absorbierenden Medien kontrollieren kann.
Raphaela Wutte (Institut für Theoretische Physik) erhielt ein DOC-Stipendium für ihr Projekt “Soft Heisenberg Hair on Astrophysical Black Holes“. Dabei geht es um schwarze Löcher und die Frage, wie sich erklären lässt, dass ihre Entropie so groß ist.
Schwarze Löcher und das Informationsparadoxon
Malcolm J. Perry von der Universität Cambridge, Co-Autor von Stephen Hawkings letzter Publikation, hält am 30. November einen Vortrag in Wien.
Malcolm J. Perry
Professor Malcolm J. Perry beschäftigt sich mit den ganz großen Fragen der modernen Physik: Wie kann man die Quantenfeldtheorie, die das Verhalten kleiner Teilchen beschreibt, mit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie in Einklang bringen?
Nun wurde er im Rahmen des Doktoratskollegs „Particles and Interactions“ (TU Wien, Universität Wien und Akademie der Wissenschaften) nach Wien eingeladen.
Öffentlicher Vortrag: Malcolm J. Perry
Der langjährige Mitarbeiter von Stephen Hawking, Professor Malcolm J. Perry von der Universität Cambridge, wird zu "Black Holes, Fundamental Physics and the Information Paradox" am 30. November 2018 um 18 Uhr im Festsaal der Akademie eine öffentliche Vorlesung im Rahmen der kombiniert stattfindenden Konferenzen DISCRETE18 und Vienna Central European Seminar 2018 abhalten.
"Black Holes, Fundamental Physics and the Information Paradox"
30. November 2018 um 18 Uhr
im Festsaal der Akademie der Wissenschaften
Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien
Um unverbindliche Anmeldung an <anmeldung@hephy.at> wird gebeten.
Das Informationsparadoxon
Steven Hawking konnte zeigen, dass Quantenfeldtheorie und Relativitätstheorie nur kompatibel sind, wenn Schwarze Löcher eine thermische Strahlung abgeben, die letztlich (wenn auch auf unvorstellbar großen Zeitskalen) dazu führt, dass sie verdampfen.
Damit verbunden ist das sogenannte Informationsparadoxon: den Grundprinzipien der Quantentheorie zufolge kann Information nicht verschwinden, aber Schwarze Löcher scheinen in der Lage zu sein, diese doch zu vernichten – denn alles, was in ein Schwarzes Loch fällt, würde am Ende in gleichförmige Hawkingstrahlung verwandelt werden. Diese rein theoretische Frage ist einer der wenigen, aber stärksten Fingerzeige auf die noch ausstehende Verbindung von fundamentaler Quanten- und Teilchenphysik mit Einsteins Gravitationstheorie.
Nanokäfige im Labor und am Computer: Wie DNA-basierte Dendrimere Nanoteilchen transportieren
Nanokäfige sind hochinteressante molekulare Strukturen mit Hohlräumen, die z.B. in der Medizin als Träger kleinerer Moleküle genutzt werden können. Kurze Abschnitte des DNA-Moleküls sind perfekte Kandidaten für das kontrollierbare Design neuartiger Nanokäfige, der DNA-basierten Dendrimere. Wie man diese robusten und stabilen Objekte mit kontrollierbaren Eigenschaften erzeugen kann, haben PhysikerInnen von der Universität Wien in Zusammenarbeit mit KollegInnen von der TU Wien, vom Forschungszentrum Jülich sowie von der Cornell University im Labor und mittels detaillierter Computersimulationen untersucht. Ihre Ergebnisse werden in der renommierten Zeitschrift "Nanoscale" veröffentlicht.
DNA-basiertes Dendrimer der fünften Generation, eingetaucht in eine Gegenionenlösung. Regelmäßige Hohlräume im Inneren dieses neuartigen Makromoleküls können als Nanoteilchen-Träger eingesetzt werden.
Nanokäfige sind hochinteressante molekulare Strukturen, sowohl aus der Sicht der Grundlagenforschung als auch in Hinblick auf mögliche Anwendungen. Die Hohlräume dieser nanometergroßen Objekte können als Träger kleinerer Moleküle genutzt werden, was in der Medizin für den Medikamenten- oder Gentransport in lebenden Organismen entscheidend ist. Diese Idee brachte ForscherInnen aus verschiedenen interdisziplinären Bereichen zusammen, die Dendrime – besondere chemische Verbindungen – als vielversprechende Kandidaten für die Herstellung solcher Nanoteilchen-Träger untersuchen. Die baumartige Architektur der Dendrimere und ihr schrittweises Wachstum mit sich wiederholenden, selbstähnlichen Einheiten erlauben die Ausformung von Hohlräumen mit kontrollierbarem Design. Jahrzehntelange Forschungen haben jedoch gezeigt, dass eine Vielzahl von verschiedenen Dendrimer-Arten mit zunehmenden Dendrimergenerationen eine Rückfaltung der äußeren Äste erfahren, was zu einer höheren Dichte der Bestandteile im Inneren des Moleküls führt. Die Wirkung des Rückfaltens wird durch Zugabe von Salz in die Lösung verstärkt, wodurch flexible Dendrimere stark schrumpfen und zu kompakten Objekten ohne Hohlräume in deren Innerem werden.
Das Team um Nataša Adžić und Christos Likos von der Universität Wien, Clemens Jochum und Gerhard Kahl (TU Wien), Emmanuel Stiakakis (Forschungszentrum Jülich, Deutschland) und Thomas Derrien und Dan Luo (Cornell University, USA) fand einen Weg, Dendrimere zu erzeugen, die so starr sind, dass eine Rückfaltung der äußeren Arme auch bei hohen Verzweigungsgenerationen verhindert wird. Somit bleiben regelmäßige Hohlräume in ihrem Inneren erhalten. Darüber hinaus zeichnen sich die neuartigen Makromoleküle durch eine bemerkenswerte Resistenz gegen Salzzusatz aus: Die WissenschafterInnen zeigten, dass die Morphologie und Konformationseigenschaften dieser Systeme auch bei Zugabe von Salz selbst in hoher Konzentration unbeeinflusst bleiben.
Die Nanokäfige, die sie im Labor und am Computer erzeugten, sind DNA-basierte Dendrimere, sogenannte Dendrimer-ähnliche DNAs (DL-DNA). Der Baustein, aus dem sie bestehen, ist eine Y-förmige doppelsträngige DNA-Einheit, eine dreiarmige Struktur aus doppelsträngiger DNA (ds-DNA). Diese wird durch Hybridisierung von drei einzelsträngigen DNA-Ketten (ss-DNA), die jeweils teilweise komplementäre Sequenzen zu den beiden anderen aufweisen, gebildet. Jeder Arm besteht aus 13 Basenpaaren und einem einzelsträngigen Klebeende mit vier Nukleinbasen, welches als Klebstoff fungiert. Während eine einzelne Y-DNA der ersten Dendrimer-Generation entspricht, ergibt das Anhängen weiterer Y-DNA-Elemente DL-DNA höherer Generationen. Das resultierende Dendrimer ist eine geladene makromolekulare Anordnung mit Hohlräumen und baumartiger Architektur. Aufgrund der Steifigkeit der dsDNA sind die Zweige der DL-DNA ziemlich starr, so dass das gesamte Molekül starr ist. Da DNA geladen ist, erhöht die elektrostatische Abstoßung zusätzlich die Steifigkeit des Moleküls.
DL-DNA-Moleküle wurden im Labor von den PartnerInnen in Jülich und Cornell mit bemerkenswerter Kontrolle und Sub-Nanometer-Präzision durch programmierbare Klebeende-Kohäsionen zusammengesetzt. Ihr schrittweises Wachstum ist in hohem Maß kontrollierbar, unidirektional und nicht umkehrbar. Diese Eigenschaft ist von großer Bedeutung, da gezeigt werden konnte, dass DNA-basierte Dendrimere eine vielversprechende Rolle bei der Entwicklung von nanogroßen Barcodes, DNA-basierten Impfstofftechnologien sowie von strukturellen Proben mit multiplexierten molekularen Sensorprozessen spielen sollen. Größen, Formen sowie weitere für die ExperimentalphysikerInnen unsichtbare konformative Details wie die Größe der Hohlräume und der Grad der Rückfaltung der Äste wurden in Wien durch Computersimulationen analysiert. Um die komplexe Struktur von DNA-Einheiten zu beschreiben, verwendete die Gruppe ein Monomer-aufgelöstes Modell mit sorgfältig ausgewählten Wechselwirkungen, um die Gleichgewichtseigenschaften der DNA in physiologischer Lösung nachzuahmen. Die ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen Experimenten und Simulationen für die Dendrimer-Eigenschaften bestätigt die verwendeten theoretischen Modelle und ebnet den Weg für die weitere Untersuchung der Eigenschaften von Nanokäfigen und ihrer Anwendungen als Nanoteilchen-Träger und als Bausteine für die Entwicklung biokompatibler künstlicher Materialien.
Die Forschung wird vom Österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) unter der Projektnummer I 2866-N36 und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unter der Projektnummer STI 664/3-1 gefördert.
Originalpublikation in "Nanoscale":
Clemens Jochum, Nataša Adžić, Emmanuel Stiakakis, Thomas L. Derrien, Dan Luo, Gerhard Kahl, and Christos N. Likos: Structure and stimuli-responsiveness of all-DNA dendrimers: theory and experiment, Nanoscale (2018). DOI: 10.1039/C8NR05814H:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c8nr05814h/unauth#!divAbstract
Wissenschaftlicher Kontakte:
Ao.Univ.Prof. Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Kahl
Technische Universität Wien
Institut für Theoretische Physik
T +43-1-58801-13632
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Bild: © Nataša Adžić
Stringtheorie: Ist Dunkle Energie überhaupt erlaubt?
Eine neue Vermutung scheint die Stringtheorie aus den Angeln zu heben. Timm Wrase von der TU Wien veröffentlichte dazu nun vieldiskutierte Ergebnisse.
Die ESA-Mission Euclid könnte neue Einblicke in fundamentale Fragen der Stringtheorie liefern. [1]
Timm Wrase
In der Stringtheorie könnte ein Umbruch bevorstehen. Im Juni veröffentlichte ein Team von Stringtheoretikern aus Harvard und Caltech eine revolutionär klingende Vermutung: Die Stringtheorie soll mit der Existenz von „Dunkler Energie“ wie sie bisher verstanden wurde grundsätzlich unvereinbar sein – doch nur mit „Dunkler Energie“ kann man heute die beschleunigte Expansion des Universums erklären.
Timm Wrase von der TU Wien erkannte rasch, dass an dieser Vermutung etwas nicht stimmen kann: Es dürfte sonst nämlich auch kein Higgs-Teilchen geben. Seine Berechnungen, die er zusammen mit Theoretikern von der Columbia University in New York und der Universität Heidelberg durchführte, wurden nun in „Physical Review“ publiziert. Die plötzlich entfachte Diskussion über Strings und Dunkle Energie soll nun der Forschung einen neuen Ruck verleihen, hofft Wrase.
Die Theorie für alles?
In die Stringtheorie werden große Hoffnungen gesetzt: Sie soll erklären, wie Gravitation mit Quantenphysik zusammenhängt, und wie die Naturgesetze zu verstehen sind, mit denen man die gesamte physikalische Welt beschreiben kann, von den kleinsten Teilchen bis zur größten Struktur des Kosmos.
Oft wird der Stringtheorie vorgeworfen, bloß mathematisch-abstrakte Ergebnisse zu liefern und zu wenige Vorhersagen zu treffen, die sich im Experiment tatsächlich untersuchen lassen. Nun allerdings diskutiert die Stringtheorie-Community auf der ganzen Welt eine heiße Frage, die mit kosmischen Experimenten eng zusammenhängt: Es geht dabei um nichts Geringeres als die Expansion des Universums. 2011 wurde der Physik-Nobelpreis für die Entdeckung vergeben, dass das Universum nicht nur ständig größer wird, sondern dass sich diese Expansion auch noch ständig beschleunigt.
Dieses Phänomen lässt sich nur erklären, wenn man eine zusätzliche, bisher unbekannte „Dunkle Energie“ annimmt. Diese Idee stammt ursprünglich von Albert Einstein, der sie in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie als „kosmologische Konstante“ zu seinen Gleichungen hinzufügte. Einstein wollte damit eigentlich ein nichtexpandierendes Universum konstruieren. Als Hubble 1929 dann feststellte, dass sich das Universum ausdehnt, bezeichnete Einstein diese Modifikation seiner Gleichungen als „größte Eselei“ seines Lebens. Doch mit der Entdeckung, dass sich die Expansion beschleunigt, wurde die kosmologische Konstante als Dunkle Energie wieder in das gegenwärtige Standardmodell der Kosmologie aufgenommen.
Wie ein Apfel in der Obstschüssel
„Man dachte lange, dass sich eine solche Dunkle Energie gut in das Konzept der Stringtheorie einbauen lässt“, sagt Timm Wrase vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Die Stringtheorie geht davon aus, dass es zusätzliche, bisher unbekannte Teilchensorten gibt, die sich in Form von Feldern beschreiben lassen.
Diese Felder haben einen Zustand minimaler Energie – ähnlich wie ein Apfel, der in einer Schüssel liegt. Er wird immer ganz unten, am tiefsten Punkt der Schüssel liegen. Überall sonst wäre seine Energie höher, man muss Energie aufwenden, um ihn vom tiefsten Punkt zu entfernen. Das heißt aber nicht, dass der Apfel am tiefsten Punkt gar keine Energie hat: Man kann die Schüssel mit dem Apfel auf den Boden stellen, oder oben auf den Tisch – dort hat der Apfel zwar mehr Energie, kann sich aber trotzdem nicht bewegen, weil er sich in seiner Schüssel immer noch lokal im Zustand minimaler Energie befindet.
„So ähnlich lassen sich in der Stringtheorie auch Felder beschreiben, mit denen sich die dunkle Energie erklären ließe – sie befinden sich in einem lokalen Energie-Minimum, aber die Energie hat trotzdem einen Wert, der größer als null ist“, erklärt Timm Wrase. „So würden diese Felder die sogenannte dunkle Energie liefern, mit der man die beschleunigte Expansion des Universums erklären kann.“
Doch Cumrun Vafa von der Harvard University, einer der renommiertesten Stringtheoretiker der Welt, veröffentlichte am 25. Juni einen Artikel mit großer Sprengkraft: Er stellte darin die Vermutung auf, dass solche „schüsselförmigen“ Felder mit positiver Energie in der Stringtheorie gar nicht möglich sind.
Das Higgs-Feld – ein Widerspruch
Timm Wrase von der TU Wien erkannte rasch die Tragweite dieser Behauptung: „Wenn das stimmt, kann es die beschleunigte Expansion, wie wir sie uns bisher vorgestellt haben, nicht geben“, sagt er. „Es müsste dann ein Feld mit ganz anderen Eigenschaften geben, vergleichbar mit einer leicht abschüssigen Ebene, auf der eine Kugel nach unten rollt und dabei potenzielle Energie verliert.“ Dann würde sich der Betrag der „dunklen Energie“ im Lauf der Zeit ändern und die beschleunigte Expansion des Universums käme möglicherweise eines Tages zum Stillstand. Die Gravitation könnte dann die gesamte Materie wieder zusammenziehen und an einem Punkt versammeln, ähnlich wie zum Zeitpunkt des Urknalls.
Doch Timm Wrase, der sich schon in seiner Doktorarbeit mit ähnlichen Fragen beschäftigt hatte, stellte fest, dass dieser Einwand auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. „Die Vermutung von Cumrun Vafa, die bestimmte Arten von Feldern verbietet, würde nämlich auch Dinge verbieten, von denen wir wissen, dass es sie gibt“, erklärt er.
Wrase konnte zeigen, dass auch das Higgs-Feld Eigenschaften hat, die durch Vafas Vermutung eigentlich verboten sein sollten – und das Higgs-Feld gilt als experimentell gesicherte Tatsache, für seinen Nachweis wurde 2013 der Physik-Nobelpreis vergeben. Wrase stellte seine Ergebnisse auf der Online-Plattform Arxiv zur Verfügung, seither wird in der Stringtheorie-Community heftig darüber diskutiert. Nun wurde die Arbeit geprüft und im Journal „Physical Review“ publiziert.
„Diese Kontroverse ist eine gute Sache für die Stringtheorie“, ist Timm Wrase überzeugt. „Plötzlich haben viele Leute ganz neue Ideen, über die bisher einfach noch niemand nachgedacht hatte.“ Wrase untersucht nun mit seinem Team, welche Felder die Stringtheorie zulässt und an welchen Punkten sie gegen Vafas Vermutung verstoßen. „Vielleicht führt uns das zu spannenden neuen Erkenntnissen über die Natur der dunklen Energie – das wäre ein großer Erfolg“, hofft Wrase.
Die Hypothesen, die dabei entstehen, werden sich (zumindest teilweise) schon bald experimentell überprüfen lassen: Die beschleunigte Expansion des Universums wird in den nächsten Jahren nämlich genauer untersucht als je zuvor.
Originalpublikation:
F. Denef, A. Hebecker, T. Wrase; de Sitter swampland conjecture and the Higgs potential, Phys. Rev. D 98, 086004. /PhysRevD.98.086004(Freie Arxiv-Version):
https://arxiv.org/abs/1807.06581
[1] Bild: ESA/C. Carreau and CERN/J. Ellis, CC BY-SA 3.0
Kontakt:
Priv.Doz. Timm Wrase, PhD
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
timm.wrase@tuwien.ac.at
Erstmals gemessen: Wie lange dauert ein Quantensprung?
Mit Hilfe ausgeklügelter Experimente und Berechnungen der TU Wien ist es erstmals gelungen, die Dauer des berühmten photoelektrischen Effekts zu messen.
Ein Laserpuls trifft die Wolfram-Oberfäche, auf der Iod-Atome aufgebracht sind. Sowohl Wolfram- als auch Jod-Atome verlieren Elektronen, die dann gemessen werden.
Es war eines der entscheidenden Experimente für die Quantenphysik: Wenn Licht auf bestimmte Materialien fällt, werden Elektronen aus der Oberfläche herausgelöst. Albert Einstein konnte dieses Phänomen 1905 erstmals erklären, indem er von „Lichtquanten“ sprach – den kleinsten Einheiten des Lichts, die wir heute Photonen nennen.
In winzigen Sekundenbruchteilen absorbiert das Elektron ein Photon und „springt“ dabei in einen anderen Zustand, in dem es die Oberfläche des Materials verlassen kann. Dieser „photoelektrische Effekt“ läuft so schnell ab, dass man ihn bisher meist als instantan betrachtete – als plötzliche Zustandsänderung, von einem Augenblick zum nächsten. Neue Messmethoden sind allerdings so präzise, dass es nun möglich wurde, den Ablauf eines solchen Prozesses zu beobachten und seine Dauer genau zu vermessen. Ein Team der TU Wien ermittelte gemeinsam mit einem Team des ehemaligen TU Wien-Forschers Reinhard Kienberger von der TU München, sowie Forschungsgruppen aus Garching und Berlin die Dauer der Quantensprünge von Elektronen einer Wolfram-Oberfläche. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse nun im Fachjournal „Nature“.
Messen auf Attosekundenskala
Der photoelektrische Effekt spielt in vielen technischen Bereichen eine wichtige Rolle, etwa in Solarzellen oder bei der Umwandlung von Daten aus dem Glasfaserkabel in elektrische Signale. Er ereignet sich auf eine Zeitskala im Attosekundenbereich, das sind Milliardstel einer Milliardstelsekunde.
„Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse gelang es in den letzten Jahren, einen Einblick in den zeitlichen Ablauf solcher Effekte zu bekommen“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Wir konnten etwa gemeinsam mit unseren Kollegen aus Deutschland den Zeitabstand zwischen verschiedenen Quantensprüngen bestimmen und zeigen, dass unterschiedliche Quantensprünge unterschiedlich lange dauern.“ Allerdings konnte man bisher nur Zeitdifferenzen, nicht aber die absolute Zeitdauer ermitteln, weil es sehr schwer ist, eine „Uhr“ zu finden, die exakt zu Beginn des Quantensprungs zu ticken beginnt. Genau das ist nun durch die Kombination von mehreren Experimenten, Computersimulationen und theoretischen Berechnungen möglich geworden.
Drei atomare Uhren
Man musste daher Schritt für Schritt vorgehen: Um eine absolute, fest geeichte Vergleichsskala zu haben untersuchte man zunächst Elektronen, die mit Hilfe von Lasern aus Helium-Atomen herausgerissen werden. „Das Helium-Atom ist sehr einfach gebaut, daher kann man den zeitlichen Ablauf der Photoemission bei Helium-Atomen exakt berechnen. Für kompliziertere Objekte, etwa Metalloberflächen, wäre das selbst mit den besten Supercomputern der Welt nicht möglich“, erklärt Prof. Christoph Lemell.
Die Helium-Atome verwendete man daraufhin als Referenz-Uhr: In einem zweiten Experiment verglich man die Photoemission von Helium und Iod und eichte so die „Iod-Uhr“. Im dritten und letzten Schritt konnte man dann schließlich die Iod-Atome verwenden, um den tatsächlich gesuchten Effekt zu studieren – nämlich die Photoemission von Elektronen aus einer Wolfram-Oberfläche. Man brachte die Iod-Atome auf Wolfram auf und beschoss die Oberfläche mit ultrakurzen Laserpulsen – nun dienten die Iod-Atome als Referenz, mit der man die Photoemission aus der Wolfram-Oberfläche messen konnte.
Man arbeitet dabei mit einem extrem kurzen Laserpuls mit hoher Energie. Er ist der Startschuss, mit dem der Prozess beginnt. Daraufhin lösen sich die Elektronen von ihren Atomen und springen in einen frei beweglichen Quantenzustand In dem sie die Materialoberfläche erreichen und aus dem Wolfram austreten können. „Bei Wolfram lässt sich die Dauer dieses Vorgangs besonders gut untersuchen, weil sich dort die Grenzfläche des Materials besonders genau definiert lässt“, erklärt Prof. Florian Libisch. „Die Wolfram-Oberfläche ist eine ausgezeichnete Ziellinie für die Elektronen-Zeitmessung.“
Die Dauer des Photoemissions-Prozesses hängt vom Anfangszustand der Elektronen ab. Sie reichen von 100 Attosekunden für Elektronen aus den inneren Schalen der Wolfram-Atome bis zu 45 Attosekunden für Leitungselektronen, die im Mittel die Ziellinie schneller passieren. Die Messungen wurden vom Team der TU München in Garching durchgeführt. Florian Libisch, Christoph Lemell und Joachim Burgdörfer von der TU Wien waren für den theoretische Arbeiten und Computersimulationen zuständig.
Aber natürlich liegt das Ziel des Forschungsprojekts nicht alleine im Vermessen der Dauer eines Quanteneffekts. „Es ist ein spannendes Forschungsgebiet, das ungeheuer viele neue Einblicke liefert – in die Oberflächenphysik, aber auch in Elektronen-Transportvorgänge im Inneren von Materialien“, betont Joachim Burgdörfer. Es gibt uns heute die Möglichkeit, wichtige physikalische Vorgänge mit einer Genauigkeit zu studieren, die vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre.“
Originalpublikation:
M. Ossiander et al., Absolute timing of the photoelectric effect, Nature (2018): https://www.nature.com/articles/s41586-018-0503-6
Kontakt:
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at
Prof. Christoph Lemell
Institut für Theoretische Physik
christoph.lemell@tuwien.ac.at
Prof. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
florian.libisch@tuwien.ac.at
Der TU Chor erhielt bei den renommierten World Choirs Games in Südafrika eine Goldmedaille.
TU Wien Chor nach der Verleihung des Goldenen Diploms bei den World Choir Games 2018 Bild © TU Wien Chor
Künstlerische Leitung des TU Wien Chors bei der Preisverleihung: Jonathan Meyns (links mit TU Wien Chor-Schal), Andreas Ipp (rechts) Bild © TU Wien Chor
TU Wien Chor beim Wettbewerbsauftritt Bild © TU Wien Chor
Niemand ahnte bei der ersten Chorprobe am 11. Oktober 2012, dass sich der Chor der TU Wien einmal soweit entwickeln würde, dass er sich für einen internationalen Chorwettbewerb qualifiziert. Doch die Zeichen standen gut – mit Andreas Ipp, dem ehrgeizigen Chorleiter, vielen motivierten Sänger_innen sowie der Unterstützung der TU Wien waren die Bedingungen für einen steilen Anstieg erfüllt.
Im Fokus stand primär der Spaß an der Musik, aber der Chor wollte mehr erreichen: Die Lieder wurden anspruchsvoller, die Auftritte professioneller. Sie wollten beweisen, dass sie nicht nur der Partychor sind, sondern auch ernstzunehmende anspruchsvolle Popmusik singen können. Und dieser Beweis gelang: 2015 zeigte der TU Chor sein Können beim Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz, wo er das silberne Diplom erhielt. Das Jahr darauf ersang er sich den Sieg in der Kategorie "Pop – Jazz – Gospel – Spiritual" beim Internationalen Chorwettbewerb und beim Festival Bad Ischl und gewann das goldene Diplom. Dadurch qualifizierte sich unser Universitätschor für die World Choir Games 2018 in Südafrika.
Afrika, Afrika
Einer der schwierigsten Aufgaben für den Chor war es, die Teilnahme finanzieren zu können. So wurden zum Beispiel Straßenensembles gegründet oder kleinere und größere Auftritte angenommen. Letztendlich war es auch Dank der großzügigen Sponsoren Gebauer und Griller, Kapsch Group, Longstay Austria und der TU Wien möglich, das Abenteuer zu wagen und an diesem weltweiten Wettbewerb teilnehmen zu können.
Am 6. Juli 2018 traten 41 Sänger_innen und Chorleiter Andreas Ipp die Reise nach Tshwane, Südafrika, an. Vor Ort wurde noch intensiv an den Wettbewerbsstücken gefeilt und ein Coaching mit Johan Rooze, dem international anerkannten Dirigenten, Komponisten und Arrangeur aus den Niederlanden, in Anspruch genommen.
Dennoch blieb Zeit für die Entdeckung dieses wunderschönen Landes: Johannesburg und Soweto wurden beispielsweise besucht und eine Foto-Safari im Nationalpark durfte auch nicht fehlen.
Mission accomplished
Am 12. Juli 2018 war es soweit: Nach 10 Monaten intensiver Vorbereitung konnte der TU Chor auf der Bühne sein Können unter Beweis stellen. Mit "Engel" (Rammstein), "Ain't No Mountain High Enough" (Nickolas Ashford, Valerie Simpson), "Say Something" (A Great Big World) und als Abschluss "Uptown Funk" (Bruno Mars, Mark Ronson) konnte er nicht nur das Publikum begeistern, sondern auch die international besetzte Jury überzeugen.
Das Ergebnis wurde am 14. Juli 2018 bei der Preisverleihung bekanntgegeben: Mit 81,63 von 100 von der Jury vergebenen Punkten holte der TU Chor eine Goldmedaille in der Kategorie "Pop Choirs". Champion dieser Kategorie wurde der bereits dreifache Gewinner "Dekoor Close Harmony" aus den Niederlanden.
Das Chor-Abenteuer zum Nachlesen & Ansehen:
Die Vorbereitungen auf die "Olympischen Spiele der Chöre" und die Teilnahme an den World Choir Games können Sie im Blog mit zahlreichen Fotos nachlesen:
https://afrika.tuwienchor.at
Mehr zu TU-Chor:
https://chor.tuwien.ac.at
https://www.instagram.com/tuwienchor
https://www.facebook.com/tuwienchor
https://www.youtube.com/tuwienchor
Abhiram Mamandur Kidambi erreicht Marshall-Plan Stipendium
Abhiram Mamandur Kidambi vom Institut für Theoretische Physik und andere begabte und vielversprechende Nachwuchstalente der TU Wien forschen in den USA und ergreifen Ihre Chance, dort internationale Forschungserfahrungen zu gewinnen!
Die Stipendiant_innen des Studienjahres 2017/18 erhielten die Fellowships mittels einer Urkunde von Wolfgang Petritsch (Präsident, Austrian Marshall Plan Foundation) und dem Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich, Trevor D. Traina (beide in der Mitte der zweiten Reihe) überreicht. (Foto © U.S. Embassy/ A. Slabihoud)
Im Studienjahr 2017/18 erhielten insgesamt 8 Studierende der TU Wien sehr gut dotierte Förderstipendien der Marshallplan-Jubiläumsstiftung, um im Rahmen ihrer Diplomarbeit oder Dissertation an US-amerikanischen Universitäten oder Forschungseinrichtungen zu forschen.
Überreichung der Marshallplan-Fellowships im Rahmen des Marshall Plan Symposiums 2018
Am 6. Juni 2018 wurden allen angemeldeten Stipendiat_innen der beiden Calls des Studienjahres 17/18 im Rahmen eines Symposiums die „Marshallplan-Fellowships“ feierlich von Dr. Wolfgang Petritsch, Präsident der Marshallplan-Jubiläumsstiftung und S.E. Trevor D. Traina, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Österreich, urkundlich überreicht.
Von der TU Wien waren nachfolgende 6 Studierende bei der Verleihung anwesend:
Abhiram Mamandur Kidambi, Dissertation TPH
Gastuniversität: Stanford University
Titel des Proposals: String theoretic realizations of higher dimensional Siegel modular forms
Stefan Kronister, Dissertation TCH
Gastuniversität: Harvard Medical School, Center for Systems Biology
Titel des Fo-Proposals: Development of Bioorthogonal Reactions and their Application in Targeted Cancer Therapy
Andreas Grabos, Diplomarbeit MWBW
Gastuniversität: Indiana University School of Medicine and Purdue University
Titel des Proposals: Effect of anti-resorptive treatments on material properties and damage behaviour of individual trabeculae of bone
Doris Roth, Diplomarbeit Biomedical Engineering (TCH)
Gastuniversität: Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Titel des Fo-Proposals: Development of a Human in vitro Model for Pseudomonas aeruginosa Infection in Cystic Fibrosis
Emanuel Höckner, Diplomarbeit WIMB
Gastuniversität: University of California San Diego
Titel des Fo-Proposals: Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels and Alternative Fuels
Sowie ein weiterer Diplomand der TCH, Gastuniversität: MIT, Department of Chemical Engineering
TU Wien – Teilnahme am Marshallplan Scholarship Programm
Durch die Zusammenarbeit der TU Wien mit der Austrian Marshallplan Foundation kann der wissenschaftliche Austausch mit den USA mittels Stipendien für Diplomand_innen und Doktorand_innen gezielt gefördert werden. Das Marshallplan-Stipendium ist auf die Förderung des akademischen Austauschs von Technischen Universitäten und Fachhochschulen sowohl für amerikanische als auch für österreichische Studierende fokussiert.
Rückfragehinweis:
Mag. Rosmarie Nigg
International Office
Technische Universität Wien
rosmarie.nigg@tuwien.ac.at
Wie man Schallwellen durchs Labyrinth lenkt
Eine Wellen-Manipulationstechnik der TU Wien wurde nun erstmal im Experiment getestet: Schallwellen lassen sich damit mühelos durch komplizierte Strukturen leiten.
Durch dieses Röhrensystem werden die Schallwellen geleitet. [1]
Andre Brandstötter (l) und Stefan Rotter
Ständig haben wir es mit Wellen zu tun, die auf komplizierte Weise abgelenkt werden: Ein Lichtstrahl fällt durch ein Glas Milch und wird in alle Richtungen gestreut. Elektromagnetische Wellen vom Handymasten werden gestreut oder absorbiert, sodass wir uns in Innenräumen über schlechten Empfang ärgern.
An der TU Wien entwickelt man Methoden, Wellen gezielt so zu manipulieren, dass sie sich praktisch ungestört fortbewegen können. In einer Kooperation mit einer Forschungsgruppe der École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) und der Universität Kreta wurde diese Methode nun im Experiment umgesetzt. Mit präzise gesteuerten Lautsprechern gelang es, eine Schallwelle durch ein Rohr mit diversen Hindernissen zu schicken. Langfristig könnten solche Technologien dazu führen, Lichtwellen zu manipulieren und Objekte unsichtbar zu machen.
Licht oder Schall – auf die Welle kommt es an
Um das Konzept für verlustfreien Wellentransport zu testen, entschied man sich für Schallwellen. „Unsere Technik lässt sich grundsätzlich auf jede Art von Welle anwenden“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Mathematisch gesehen spielt es keine Rolle, ob es sich um Lichtwellen, Schallwellen oder quantenphysikalische Materiewellen handelt – aber in der Akustik sind die Experimente besonders anschaulich durchzuführen.“
Um die Welle auf genau die richtige Weise zu manipulieren, muss man an bestimmten Orten Energie zuführen oder abziehen. Das gelingt mit speziellen Lautsprechern, die entlang eines meterlangen Schallrohrs angebracht sind. „Die Lautsprecher sind allerdings nicht dazu da, um die ursprüngliche Schallwelle auf der anderen Seite des Rohres einfach zu reproduzieren - das wäre zu einfach“, erklärt Andre Brandstötter, ein Ko-Autor der Studie und Doktorand in der Gruppe von Stefan Rotter. „Es geht darum, die Schallwelle Punkt für Punkt zu manipulieren und sie gewissermaßen durch das Rohr hindurch zu lotsen, sodass sie an bestimmten Stellen im Rohr immer genau dieselbe Stärke hat.“
Die Lautsprecher werden so gesteuert, dass die Welle lokal verstärkt oder abgeschwächt wird. „Dadurch können wir der komplizierten Streuung entgegenwirken, die sonst unvermeidlich wäre, wenn die Welle auf ein Hindernis trifft“, sagt Rotter.
Das Röhren-Labyrinth
Das Experiment wurde mit einer luftgefüllten Röhre durchgeführt, in der unregelmäßige Hindernisse eingebaut wurden. Schickt man eine Schallwelle durch dieses Rohr, kommt am Ende praktisch kein Schall an. Wenn man allerdings die in die Röhre eingebrachten Lautsprecher nach den mathematischen Regeln steuert, die das Team der TU Wien entwickelt hat, dann verlässt die Schallwelle das Rohr so, als wäre sie unterwegs auf kein einziges Hindernis gestoßen.
Das Experiment in Lausanne zeigt, dass die Wellen-Manipulationstechnologien der TU Wien tatsächlich praxistauglich sind. Das Ziel ist nun, die Möglichkeiten dieser Technologie weiter auszubauen. „Wenn dasselbe im dreidimensionalen Raum mit Lichtwellen gelingt, könnte man im Prinzip Objekte unsichtbar machen“, sagt Stefan Rotter. Während für eine mögliche „Tarnkappe“ freilich noch einige weitere Entwicklungsschritte nötig sind, könnte die neue Technik heute schon für verschiedene Anwendungen in der Nachrichtenübertragung höchst interessant sein.
Originalpublikation: E. Rivet et al., Constant-pressure sound waves in non-Hermitian disordered media, Nature Physics, 2018. DOI: 10.1038/s41567-018-0188-7:
https://www.nature.com/articles/s41567-018-0188-7
Zum Nachlesen:
Der Strahl, der unsichtbar macht https://www.tuwien.ac.at/de/aktuelles/news_detail/article/125132/
Fotonachweis: [1] Foto: Etienne Rivet, EPF Lausanne
Kontakt:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Start-Preis für Emanuela Bianchi - Drei Start-Preise für die TU Wien
Riesenerfolg bei der Vergabe der diesjährigen Start-Preise: Emanuela Bianchi, Josef Füssl und Philipp Haslinger holen drei der sechs hochdotierten Auszeichnungen an die TU Wien.
Emanuela Bianchi, Josef Füssl und Philipp Haslinger
Der Start-Preis gilt als die wichtigste österreichische Auszeichnung für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der österreichische Wissenschaftsfonds FWF gab am 13. Juni das Ergebnis der diesjährigen Preisvergabe bekannt, die TU Wien hat dreifachen Grund zur Freude.
Die Physikerin Emanuela Bianchi erhält den Start-Preis für ihre Forschung zu kleinen Partikeln, die sich ganz von selbst zu komplexen Strukturen zusammenfinden. Der Bauingenieur Josef Füssl beschäftigt sich damit, komplizierte Materialien wie Holz, Asphalt oder Ziegel am Computer zu simulieren. Der Physiker Philipp Haslinger entwickelt Methoden, Kräfte extrem präzise zu messen, um neuen, bisher unbekannten physikalischen Phänomenen auf die Spur zu kommen. Alle drei wurden nun mit einem Start-Preis ausgezeichnet, damit ging die Hälfte der Preise an die TU Wien.
Auch die diesjährigen Wittgenstein-Preise wurden bekanntgegeben: Sie gehen an Ursula Hemetek (Universität für Musik und darstellende Kunst) und Herbert Edelsbrunner (IST Austria).
Emanuela Bianchi: Neue Materialien, die sich selbst zusammenbauen
Es gibt viele Möglichkeiten, neuartige Materialien herzustellen. Eine der interessantesten und vielversprechendsten ist die Variante, mikroskopisch kleine Partikel dazu zu bringen, sich von selbst gezielt zu komplexen Strukturen zusammenzufügen. Man spricht in diesem Fall von „Selbstorganisation“. Emanuela Bianchi vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien entwickelt Computersimulationen, mit denen man dieses Selbstorganisations-Verhalten der kleinen Partikel berechnen und vorhersagen kann.
Emanuela Bianchi studierte an der Universität La Sapienza in Rom, wo sie sich schon in ihrer Dissertation mit sogenannten „Patchy Particles“ beschäftigte – kleinen Partikeln, die an manchen Stellen besondere Oberflächeneigenschaften aufweisen, und sich dadurch miteinander verbinden können. Nach ihrer Promotion 2009 ging sie dann nach Wien, wo sie - unterbrochen durchweitere Auslandsaufenthalte in Deutschland und den Niederlanden - seither forscht.
Josef Füssl: Materialien im Kleinen und im Großen betrachtet
Im Bauingenieurwesen hat man es oft mit recht komplizierten Materialien zu tun. Holz etwa besteht aus kleinen Strukturen, die aus noch kleineren Strukturen zusammengesetzt sind, bis hinunter auf die Ebene einzelner Zellen. Um das Verhalten eines großen Holzbalkens richtig berechnen zu können, muss man das Material daher auf unterschiedlichen Größenskalen gleichzeitig beschreiben – eine schwierige Aufgabe, die mit ganz speziellen Computermethoden zu lösen ist. Josef Füssl vom Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen arbeitet an solchen Rechenmethoden. Er möchte damit den Werkstoff Holz berechenbar machen und seinen Einsatz im Bauwesen erleichtern.
Josef Füssl wuchs in Wien auf, er studierte Bauingenieurwesen an der TU Wien. Auch seine Dissertation schrieb er hier – über Computermodelle für Beton und Asphalt. Erfahrung sammelte Füssl auch immer wieder in der Wirtschaft als Zivilingenieur. Ein Auslandsaufenthalt an der University of Oxford brachte wichtige Kontakte, bis heute kooperiert Füssl eng mit dem Forschungsteam aus Oxford. Derzeit leitet er den Forschungsbereich für Werkstoff- und Struktursimulation an der TU Wien.
Philipp Haslinger: Auf der Suche nach neuen Naturgesetzen
Mit den bekannten Naturkräften lassen sich praktisch alle Phänomene beschreiben, die wir auf unserem Planeten beobachten. Doch irgendetwas fehlt: Gewisse Beobachtungen auf kosmischer Skala lassen sich mit den bekannten Gesetzen der Physik nicht erklären, etwa die beschleunigte Expansion des Universums. Es gibt verschiedene Theorien, welche zusätzliche Naturkraft da im Spiel sein könnte. Wenn es eine solche, bisher unbekannte Kraft tatsächlich gibt, dann müsste man sie auch auf der Erde nachweisen können – vorausgesetzt man schafft es, extrem präzise zu messen. Daher entwickelt Philipp Haslinger am Atominstitut der TU Wien spezielle, extrem sensitive Messmethoden, basierend auf Atominterferometrie.
Philipp Haslinger stammt aus Niederösterreich, er promovierte 2013 an der Universität Wien. Danach ging er mit einem FWF-Stipendium an die Universität Berkeley, bevor er nach Wien zurückkehrte, um seine Forschungsarbeiten am Atominstitut der TU Wien fortzusetzen.
Neuartige Quanten-Bits in zwei Dimensionen
Wenn man zwei ultradünne Materialschichten kombiniert, ergeben sich neue Möglichkeiten für die Quanten-Elektronik. Ein Forschungsteam mit TU-Beteiligung präsentiert flexibel steuerbare Quantensysteme.
Winzige Nanostrukturen erlauben ausgezeichnete Kontrolle über einzelne Elektronen.
Florian Libisch
Zwei neuartige Materialien, die jeweils nur aus einer einzigen Schicht von Atomen bestehen, und dazu die Spitze eines Rastertunnelmikroskops – das sind die Zutaten, mit denen es nun gelungen ist, eine neue Art sogenannter „Quantenpunkte“ herzustellen. Dabei handelt es sich um winzige Nanostrukturen, die eine ausgezeichnete Kontrolle über einzelne Elektronen erlauben, deren Energie gezielt verändert werden kann. Für moderne Quantentechnologien sind solche Strukturen ein wichtiges Werkzeug.
Die theoretische Arbeit und die Computersimulationen für die neue Technologie kamen vom Team um Prof. Florian Libisch und Prof. Joachim Burgdörfer an der TU Wien, das Experiment wurde an der RWTH Aachen von der Forschungsgruppe von Prof. Markus Morgenstern durchgeführt. Beteiligt daran war auch das Team der nobelpreisgekrönten Graphen-Entdecker Andre Geim und Kostya Novoselov aus Manchester, die die Materialproben beisteuerten. Publiziert wurden die Ergebnisse nun im Fachjournal „Nature Nanotechnology“.
Energieunterschiede nach Wunsch einstellen
„Für viele Anwendungen im Bereich der Quantentechnologie braucht man ein Quantensystem, in dem ein Elektron zwei verschiedene Zustände annehmen kann – ähnlich wie ein klassischer Lichtschalter, nur mit dem Unterschied, dass die Quantenphysik auch beliebige Überlagerungen der beiden möglichen Zustände erlaubt“, erklärt Prof. Florian Libisch vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Eine ganz wichtige Eigenschaft solcher Systeme ist die Energiedifferenz zwischen diesen beiden Quantenzuständen: „Man will in einem solchen System die Information, die in Form des Elektrons abgespeichert ist, möglichst gut kontrollieren, speichern und auslesen können. Dafür wünscht man sich ein System, in dem sich die Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen kontinuierlich einstellen lässt – von fast null bis möglichst groß“, erklärt Libisch.
Bei in der Natur vorkommenden Systemen – etwa in einem Atom – ist das schwierig. Dort sind die Energien und damit die Energiedifferenzen zwischen zwei erlaubten Zuständen fix vorgegeben. Möglich wird das gezielte Ändern des Energieabstands allerdings in synthetisierten Nanostrukturen, in denen Elektronen eingesperrt werden. Man bezeichnet solche Strukturen als „Quantenpunkte“ oder auch als „künstliche Atome“.
Zwei ultradünne Materialien: Graphen und Bornitrid
Dem internationalen Forschungsteam von TU Wien, RWTH Aachen und Universität Manchester gelang es nun, neuartige Quantenpunkte zu entwickeln, in dem sich die einzelnen Energieniveaus der Elektronen viel besser und in größerem Ausmaß steuern und kontrollieren lassen als bisher. Möglich wurde das durch eine Kombination von zwei ganz besonderen Materialien: Zum einen Graphen, das aus nur einer einzigen leitenden Schicht von Kohlenstoff-Atomen besteht, zum anderen hexagonales Bornitrid, einem Graphen stark ähnelnden atomar dünnen Material, das aber isolierend ist.
Genau wie Graphen bildet auch Bornitrid eine sechseckig-wabenartige Struktur aus einzelnen Atomlagen. „Die Sechsecke im Graphen und die Sechsecke im Bornitrid sind allerdings nicht exakt gleich groß“, sagt Florian Libisch. „Wenn man nun eine einzige Schicht Graphen sorgfältig auf hexagonales Bornitrid legt, dann passen die beiden Schichten nicht perfekt zusammen, dadurch entsteht eine Superstruktur mit einer Größe von einigen Nanometern, die sich verbiegt und extrem regelmäßige Wellen schlägt.“
Wie die aufwändigen Berechnungen zeigten, die an der TU Wien durchgeführt werden, sind genau diese Verbiegungen einer kombinierten Graphen-Bornitrid-Struktur der ideale Ort, um Elektronen zu kontrolieren. Die regelmäßigen Wellen in der dünnen Struktur bilden eine Potentiallandschaft, in die man mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops den Quantenpunkt punktgenau einpassen oder sogar kontinuierlich verschieben kann. Je nachdem, an welcher Stelle sich die Spitze des Mikroskops befindet, ändern sich die erlaubten Energieniveaus der Elektronen. „Durch eine Verschiebung um wenige Nanometer kann man den Unterschied zwischen zwei benachbarten Elektronen-Energien zwischen -5 und +10 Milli-Elektronenvolt punktgenau einstellen – das ist etwa das Fünfzigfache dessen, was bisher möglich war“, sagt Florian Libisch.
Auf dem Weg zu „Valleytronics“
Die Spitze des Rastertunnelmikroskops könnte in Zukunft durch eine Reihe nanoelektronischer Bauteile ersetzt werden. So sollen die nun entdeckten Möglichkeiten des Kombinationsmaterials aus Graphen und Bornitrid zu einer skalierbaren Quanten-Technologien führen – man spricht von „Valleytronics“.
„Das ist heute ein vieldiskutiertes Forschungsgebiet, das freilich noch am Anfang steht“, meint Florian Libisch. „Die potenziellen technischen Möglichkeiten dieser ultradünnen Materialien sind jedenfalls vielversprechend – weshalb die TU Wien 2017 auch ein Doktorandenkolleg zu diesem Thema ins Leben gerufen hat.“
Originalpublikation: Freitag et al., Large tunable valley splitting in edge-free graphene quantum dots on boron nitride, Nature Nanotechnology, 2018. DOI: 10.1038/s41565-018-0080-8:
https://www.nature.com/articles/s41565-018-0080-8
Das Doktoratskolleg TU-D: https://tu-d.tuwien.ac.at/home/
Rückfragehinweis:
Dr. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
florian.libisch@tuwien.ac.at
Exotischer Materiezustand: Wie ins Atom noch mehr Atome passen
Ein neuartiger Materiezustand wurde mit TU Wien-Beteiligung nachgewiesen: Ein Elektron umkreist seinen Atomkern in großem Abstand, innerhalb dieser Bahn werden viele weitere Atome gebunden.
Das Elektron (blau) kreist um den Atomkern (rot) und schließt auf seiner Bahn zahlreiche Atome des Bose-Einstein-Kondensats (grün) ein.
Was befindet sich zwischen einem Atomkern und dem Elektron, das ihn umkreist? Normalerweise nichts, doch das muss nicht so sein. Wenn der Abstand zwischen Elektron und Atomkern groß genug ist, haben dazwischen noch weitere Atome Platz. So kann ein „Riesenatom“ entstehen, das mit gewöhnlichen Atomen gefüllt ist. Gemeinsam gehen sie eine schwache Bindung ein und erzeugen damit einen neuen exotischen Materiezustand bei extrem kalten Temperaturen – man spricht von „Rydberg Polaronen“.
Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der TU Wien präsentierte diesen Materiezustand nun im Fachjournal „Physical Review Letters“. Die theoretischen Arbeiten kamen von der TU Wien und der Harvard University, das Experiment wurde an der Rice University in Houston (Texas) durchgeführt.
Ultrakalte Physik
Es sind zwei Extrembereiche der Atomphysik, die in diesem Forschungsprojekt vereint wurden: Bose-Einstein-Kondensate und Rydberg-Atome. Ein Bose-Einstein-Kondensat ist ein Materiezustand, den bestimmte Atome bei ultrakalten Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt annehmen können. Als Rydberg-Atome bezeichnet man Atome, bei denen sich ein einzelnes Elektron in einem energiereichen, hoch angeregten Zustand befindet und sehr weit vom Atomkern entfernt seine Bahn zieht.
„Der mittlere Abstand eines solchen Elektrons zu seinem Atomkern kann hunderte Nanometer betragen – das ist mehr als das Tausendfache vom Radius eines Wasserstoffatoms“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer. Gemeinsam mit Prof. Shuhei Yoshida (beide Institut für Theoretische Physik der TU Wien) beschäftigt er sich seit Jahren mit den Eigenschaften solcher Rydberg-Atome. Aus der langjährigen Kooperation der Wiener Forscher mit der Rice University in Houston entwickelte sich auch die Idee für das aktuelle Forschungsprojekt.
Erzeugt wurde zunächst ein Bose-Einstein-Kondensat aus Strontium-Atomen. Einem dieser Atome wurde dann mit einem Laser Energie zugeführt, um es zum Rydberg-Atom mit riesengroßem Atom-Radius zu machen. Das Verblüffende daran: Die Bahn, auf der sich das Rydberg-Elektron mit sehr geringer Geschwindigkeit bewegt, ist viel größer als der typische Abstand zwischen zwei benachbarten Atomen. Das Elektron umkreist also nicht nur den eigenen Atomkern, auch zahlreiche andere Atome liegen innerhalb seiner Bahn. Je nach Radius des Rydberg-Atoms und Dichte des Bose-Einstein-Kondensats befinden sich dort bis zu 160 weitere Strontium-Atome.
Kaum Störung durch Nachbaratome
Das Elektron des Rydberg-Atoms wird durch diese zusätzlichen Atome allerdings auf seiner großen Umlaufbahn kaum gestört. „Diese Atome sind schließlich elektrisch neutral, daher üben sie nur eine sehr geringe Kraft auf das Elektron aus“, sagt Shuhei Yoshida. In minimalem Ausmaß spürt das Elektron aber doch den Einfluss der neutralen Atome, denen es auf seiner Bahn begegnet. Es wird von ihnen ein bisschen gestreut – ohne dabei allerdings jemals seine Bahn zu verlassen. Die Quantenphysik langsamer Elektronen erlaubt solche Streuung, bei der sich am Zustand des Elektrons nichts ändert.
Wie man in Computersimulationen zeigen kann, wird durch diese verhältnismäßig schwache Wechselwirkung die Energie des Gesamtsystems verringert und so ein Bindungszustand zwischen dem Rydberg-Atom und den anderen Atomen im Inneren der Elektronen-Kreisbahn stellt sich ein. „Es ist eine sehr ungewöhnliche Situation“, sagt Shuhei Yoshida. „Normalerweise hat man es in der Atomphysik mit geladenen Atomkernen zu tun, die Elektronen an sich binden. Hier haben wir ein Elektron, das neutrale Atome bindet.“
Diese Bindung ist viel schwächer als etwa die Bindung zwischen den Atomen in einem Kristall. Daher ist dieser exotische Bindungszustand, den man als Rydberg-Polaron bezeichnet, auch nur bei extrem tiefen Temperaturen zu beobachten. Würden sich die Teilchen schneller bewegen, würde diese Bindung sofort aufbrechen. „Für uns ist dieser neue, schwach gebundene Materiezustand eine spannende Möglichkeit, die Physik ultrakalter Atome besser zu verstehen“, sagt Joachim Burgdörfer. „So kann man Eigenschaften eines Bose-Einstein-Kondensats auf sehr kleinen Skalen präzise bestimmen.“
Originalpublikation: F. Camargo et al., Phys. Rev. Lett. 120, 083401 (2018):
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.083401
Kontakt:
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-13610
burg@concord.itp.tuwien.ac.at
Fest und flüssig zugleich
Mikroskopisch kleine Partikel können sich spontan zu komplizierten Schichtstrukturen mit bemerkenswerten Eigenschaften zusammenfinden – das zeigen Berechnungen der TU Wien.
Ganz von alleine bilden die Teilchen regelmäßige Schichten aus
Das System erinnert an warme Schokowaffeln - mit abwechselnd festen und flüssigen Schichten
Emanuela Bianchi, Gerhard Kahl und Silvano Ferrari (v.l.n.r.)
Es gibt viele Möglichkeiten, neuartige Materialien herzustellen. Eine der interessantesten ist die Variante, mikroskopisch kleine Partikel dazu zu bringen, sich von selbst zu komplexen Strukturen zusammenzufügen. Man spricht in diesem Fall von „Selbstorganisation“. Welche bemerkenswerten Möglichkeiten das liefert, zeigen nun Computersimulationen an der TU Wien: Aus einfachen Bausteinen entstehen Schichtsysteme, die innerhalb eines großen Temperaturbereichs gleichzeitig fest und flüssig sein können.
Abstoßende und anziehende Ladungen
„Die Grundidee kommt aus der Natur“, erklärt Prof. Gerhard Kahl vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Viren und Bakterien weisen oft an ihrer Oberfläche elektrische Ladungen auf. Je nachdem, wie sie zueinander ausgerichtet sind, können sie sich also anziehen oder abstoßen. Und dadurch können sie selektive Bindungen eingehen und sich zu interessanten Strukturen zusammenfügen.“
Ähnliches gelingt auch mit künstlich hergestellten Partikeln – etwa mit kleinen Kügelchen, auf die man oben und unten eine positive elektrische Ladung aufbringt. Unter passenden äußeren Bedingungen können sich solche Partikel ganz von selbst zu einer zweidimensionalen Schicht zusammenfügen. In einem hexagonalen Muster sind die Teilchen dann dicht aneinander gepackt, die geladenen Seiten der Partikel sind jeweils so ausgerichtet, dass sie einander gegenseitig anziehen. Das verleiht der Schicht eine hohe Stabilität.
Wie Emanuela Bianchi und Silvano Ferrari aus Gerhard Kahls Arbeitsgruppe zeigen konnten, ermöglicht das ein interessantes Phänomen: Mehrere solche Schichten können sich parallel zueinander bilden. Dazwischen können sich weitere Partikel anlagern, die beide Schichten miteinander verbinden. Durch diese verbindenden Partikel werden die Schichten fixiert, sodass sie sich nicht mehr relativ zueinander verschieben können und somit eine stabile, vielschichtige Struktur entsteht – ganz von selbst, durch Selbstorganisation zufällig herumschwirrender Teilchen.
Fest und flüssig: Die Mini-Schokowaffel
Das Besondere an diesen Strukturen wird erkennbar, wenn man die Temperatur erhöht: „Die Bindungen innerhalb der einzelnen Schichten sind viel stärker als die Bindungen zwischen den Schichten“, erklärt Gerhard Kahl. „Bei erhöhter Temperatur werden zunächst die schwächeren Bindungen zwischen den Schichten aufgebrochen, dort können sich die Partikel als Flüssigkeit frei bewegen, während die Schichten selbst in sich noch stabil bleiben.“ Was dabei entsteht ähnelt einer Schokowaffel in der Sommerhitze: Zwischen festen, stabilen Waffelschichten bewegt sich flüssige Schokolade. „Das ist bemerkenswert: Wir haben es mit einem einheitlichen Material zu tun, das nur aus einer einziger Sorte von Teilchen besteht – aber es kann eine Struktur ausbilden, die gleichzeitig feste und flüssige Schichten aufweist.“
Das funktioniert über einen großen Temperaturbereich hinweg – erst wenn man die Temperatur so weit erhöht, dass auch die stabilen Verbindungen innerhalb der einzelnen Schichten aufgelöst werden, geht die Struktur kaputt. Bis dahin weist das System eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Selbstheilung auf: Auch wenn Schäden entstehen, werden sie automatisch von zufällig vorbeikommenden Teilchen rasch wieder repariert.
An der experimentellen Umsetzung dieser neuen Ideen wird bereits gearbeitet. Einsatzmöglichkeiten für solche Strukturen gibt es viele. „Wir haben mit solchen Strukturen die Möglichkeit, den Transport von Teilchen über die Temperatur ganz gezielt zu steuern“, sagt Gerhard Kahl. Das könnte man zum Beispiel in der Medizin nutzen, um Medikamente genau an den richtigen Ort im Körper zu transportieren.
Originalpublikation: Ferrari et al., Nanoscale, 2017,9, 1956-1963:
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c6nr07987c#!divAbstract
Rückfragehinweis:
Prof. Gerhard Kahl
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Große Formeln für kleine Teilchen
Was unberechenbar erschien, lässt sich heute doch berechnen – zumindest näherungsweise mit dem Computer. ERC-Grant-Gewinner Prof. Andreas Grüneis entwickelt Methoden für die Quanten-Vielteilchenphysik.
Prof. Andreas Grüneis
Sie sind die Grundgesetze des Universums: Mit den Formeln der Quantenphysik kann man so ziemlich alles berechnen – zumindest theoretisch. In der Praxis stößt man allerdings rasch an Grenzen. Nur für einfachste Systeme, die aus ganz wenigen Teilchen bestehen, sind die Formeln exakt lösbar. Schon bei simplen Molekülen mit einigen Elektronen wird die Rechnung so kompliziert, dass selbst die besten Supercomputer hoffnungslos überfordert sind.
Man muss sich daher kluge Strategien ausdenken, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst gute Näherungslösungen zu erhalten. Mit solchen Näherungsverfahren für Vielteilchenprobleme in der Quantenphysik beschäftigt sich Prof. Andreas Grüneis, der im Juli 2017 von Stuttgart ans Institut für Theoretische Physik der TU Wien wechselte. Nach Wien mitgebracht hat er nicht nur sein Team, sondern auch einen ERC Starting Grant, der zu den höchstdotierten Forschungsförderungen Europas gehört.
Quantenteilchen sind keine Schreibtischlampen
Im Alltag kann man unterschiedliche Objekte meist problemlos beschreiben, indem man sie getrennt voneinander betrachtet. Der Ort, an dem sich der Wohnzimmertisch befindet, ist völlig unabhängig von der Position der Schreibtischlampe. In der Quantenphysik ist die Sache allerdings viel komplizierter: „In sogenannten hochkorrelierten Systemen hat es keinen Sinn, die Teilchen getrennt voneinander zu beschreiben“, erklärt Andreas Grüneis. „Wenn man etwa ein Elektron an einem bestimmten Ort misst, dann beeinflusst das augenblicklich die Wahrscheinlichkeit, mit der sich die anderen Elektronen an bestimmten Orten aufhalten.“
Will man statt der Position einer Schreibtischlampe die Position von drei Schreibtischlampen vermessen, dauert das dreimal so lange und man braucht dreimal so viel Speicherplatz um das Ergebnis zu notieren. Bei Quantensystemen hingegen steigen Aufwand und Speicherbedarf mit der Teilchenzahl exponentiell an. Schon den elektronischen Zustand eines einfachen Moleküls wie Methan zu berechnen, bringt moderne Hochleistungscomputer an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Exakte Berechnungen von größeren Systemen, etwa von Festkörpern, sind völlig unmöglich. Dafür bräuchte man mehr Speicherkapazität als auf der ganzen Welt je zur Verfügung stehen wird.
Aber es gibt Auswege: „Man kann mathematische Methoden finden, die das Problem vereinfachen“, sagt Andreas Grüneis. „Dann erhält man zwar nicht mehr exakt das richtige Ergebnis, aber wenn man es richtig macht, lässt sich in vielen Fällen ein Resultat erzielen, das der Wahrheit sehr nahe kommt.“
Grüneis vergleicht solche Verfahren mit Bildern am Computer: Wenn man ein Urlaubsfoto in optimaler Qualität abspeichert, belegt es so viel Speicherplatz wie ein ganzes Bücherregal an Texten. Bildverarbeitungsprogramme können es aber mit mathematischen Tricks auch viel platzsparender abspeichern – das Ergebnis weicht dann zwar vom Original ein bisschen ab, aber mit freiem Auge ist der Unterschied kaum zu bemerken und für die meisten Anforderungen genügt die vereinfachte Version völlig.
In der Materialwissenschaft beschäftigt man sich schon lange mit der Suche nach Lösungsverfahren für Vielteilchensysteme – so bekam etwa Walter Kohn, ein US-Physiker mit Wiener Herkunft, einen Nobelpreis für die Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie. Man bewegt sich auf diesem Gebiet direkt an der Schnittstelle von Physik, Chemie und Computerwissenschaft.
Die Fragestellungen, die man mit den neuen Näherungs-Rechenmethoden erforschen will, sind beinahe endlos: Wie laufen chemische Reaktionen ab? Welche Materialien lassen sich als Katalysatoren verwenden? Welche Eigenschaften haben Materialien unter extremen Bedingungen, wie zum Beispiel Wasserstoff auf Jupiter? Computersimulationen können diese Fragestellungen teilweise beantworten oder helfen bei der Interpretation von Experimenten.
„Gerade in den letzten Jahren erlebt die Vielteilchen-Quantenphysik einen Aufschwung, weil wir nun mit modernen Computern und Rechenmethoden endlich die Möglichkeit haben, viele wichtige Probleme anzupacken, die vor Jahrzehnten noch unlösbar schienen“, sagt Grüneis.
Wien, Cambridge, Stuttgart, Wien
Andreas Grüneis stammt ursprünglich aus Hörsching in Oberösterreich. Er studierte an der Universität Wien Physik, wo er 2011 auch promovierte. Schon damals beschäftigte er sich mit numerischer Vielteilchen-Quantenphysik. Als Postdoc ging er daraufhin nach Cambridge, wo er an der „Coupled Cluster Methode“ arbeitete, die bis heute ein wichtiger Teil seiner Forschungsarbeit ist. Mit einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften kehrte er dann nach Wien zurück, 2015 wurde er Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Im Jahr 2016 wurde er mit einem ERC Starting Grant des European Research Council ausgezeichnet. Seit Juli 2017 ist er als Professor an der TU Wien tätig.
Gerne ist Andreas Grüneis mit seiner Frau und zwei Kindern nach Wien zurückgekehrt – nicht nur aus privaten, sondern auch aus wissenschaftlichen Gründen: „Wien ist zweifellos heute eine Welthauptstadt im Bereich der numerischen Quantenphysik“, sagt Grüneis. „Es gibt hier wirklich viel hochkarätige Forschung auf diesem Gebiet, und ich freue mich auf spannende neue Ideen und Kooperationsmöglichkeiten.“
Kontakt:
Prof. Andreas Grüneis
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
andreas.grüneis@tuwien.ac.at
Nichtlineare Diamant-Effekte
Nichtlineare Effekte in einem gekoppelten System aus Diamant-Defekten und elektromagnetischer Strahlung wurden an der TU Wien untersucht.
Kryostat am Atominstitut der TU Wien
Ein perfekter Diamant besteht aus reinem Kohlenstoff – allerdings ist es möglich, dass an bestimmten Stellen ein Kohlenstoffatom fehlt und dafür ein Stickstoffatom eingebaut ist. Solche Defekte in Diamantkristallen wurden in den letzten Jahren intensiv auf ihre Eignung als Quantenbits und Quantenspeicher untersucht. Der Forschungsgruppe von Johannes Majer am Atominstitut der TU Wien ist es nun gelungen, diese Defekte für ganz andere Untersuchungen zu nutzen, nämlich für das Studium nichtlinearer Dynamik.
„Nichtlineare Systeme, bei denen der Output nicht direkt proportional zum Input ist, zeigen viele interessante und wichtige Phänomene“, sagt Johannes Majer. „Wir können das untersuchen, indem wir elektromagnetische Wellen eines supraleitenden Resonators an eine Ensemble von Diamant-Defekten koppeln.“ Die nichtlineare Dynamik dieses gekoppelten Systems sorgt dafür, dass es zwei stabile Zustände annehmen kann – man spricht von Bistabilität.
Interessant ist die Frage, wie rasch sich das System an die möglichen stabilen Zustände annähren kann: In theoretischen Berechnungen war vorausgesagt worden, dass sich die Dynamik des Systems beim Annähern an die Bistabilität extrem verlangsamt. Es ist gelungen, diese Verlangsamung zu untersuchen - dabei wurden ultralange Zeiten bis zu einer Stunde gemessen. Solche extrem langen Relaxationszeiten sind ungewöhnlich, bei Quantensystemen hat man es meist mit viel kürzeren Zeitskalen zu tun.
Diese Resultate wurden jetzt in der neuen Open Access Zeitschrift Science Advances publiziert. Unterstützt wurde das experimentelle Team von Forschungsgruppen aus Japan aus Japan (NTT Basic Research Laboratories und National Institute of Informatics) und vom Institute für Theoretische Physik der TU Wien. Entstanden ist die Arbeit im Rahmen des Doktorandenkolleges Solids4Fun.
Originalpublikation:
Andreas Angerer, Stefan Putz, Dmitry O. Krimer, Thomas Astner, Matthias Zens, Ralph Glattauer, Kirill Streltsov, William J. Munro, Kae Nemoto, Stefan Rotter, Jörg Schmiedmayer, and Johannes Majer, Ultralong relaxation times in bistable hybrid quantum systems, Science Advances 3, (2017)
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Die Wegstrecke des Lichts im Milchglas
Eine scheinbar widersinnige Vorhersage in der Physik konnte nun experimentell nachgewiesen werden: Egal wie durchsichtig oder undurchsichtig ein Objekt ist – das Licht legt darin immer dieselbe Wegstrecke zurück.
Licht auf dem Weg durch eine Flüssigkeit: Im Falle einer transparenten Flüssigkeit (links) sind Lichtpfade geradlinig. Im Falle einer Trübung durch Nanopartikel (rechts) werden Lichtpfade durch Streuung komplizierter. Manche der Pfade werden dadurch länger, manche kürzer - im Schnitt ist die mittlere Lände der Lichtpfade jedoch gleich wie im Falle ohne Trübung.
Simulationsergebnisse für Lichtpfade in kreisförmigen Scheiben mit unterschiedlicher Trübung. Das Licht trifft von links auf das Medium mit vielen verschiedenen Einfallswinkeln. Bildnachweis: Romain Pierret & Romulo Savo.
Was passiert, wenn Licht in ein Glas Milch fällt? Es dringt ein Stück ein, wird dann an den winzigen Partikeln in der Flüssigkeit mehrfach gestreut und verlässt das Glas dann wieder; die Streuung des Lichts ist für die weiße Farbe der Milch verantwortlich. Die Bahnen auf denen Lichtstrahlen die Milch durchqueren hängen allerdings davon ab, wie durchsichtig oder undurchsichtig die Flüssigkeit ist. Eine klare Substanz wird auf ziemlich direktem Weg vom Licht durchdrungen, in sehr trüben Substanzen kann das Licht auf komplizierten, zackigen Bahnen immer und immer wieder abgelenkt werden. Doch die mittlere Länge der Wege, die das Licht dabei durchschnittlich zurücklegt, bleibt erstaunlicherweise immer gleich.
Dieses überraschende Ergebnis hatte Prof. Stefan Rotter von der TU Wien zusammen mit Teams aus Frankreich bereits vor drei Jahren vorhergesagt. Jetzt arbeitete er mit diesen Forschungsgruppen aus Paris zusammen, um den Effekt auch im Experiment nachzuweisen. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Science“ veröffentlicht.
Welle und Teilchen
„Ein vereinfachtes Bild von diesem Phänomen können wir uns machen, wenn wir uns das Licht als Strom kleiner Teilchen vorstellen“, sagt Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Die Bahnen der Lichtteilchen in der Flüssigkeit hängen natürlich davon ab, auf wie viele Hindernisse sie dort treffen.“
In einer klaren, völlig durchsichtigen Flüssigkeit bewegen sich Lichtteilchen geradlinig, bis sie auf der gegenüberliegenden Seite die Flüssigkeit verlassen. In einer trüben Flüssigkeit hingegen sind die Bahnen komplizierter: Wenn ein Lichtteilchen ans gegenüberliegende Ende des Gefäßes gelangen soll, dann stößt es auf dem Weg dorthin mit zahlreichen Partikeln in der Flüssigkeit zusammen, wird dabei immer wieder abgelenkt und legt auf dieser zackigen Bahn eine ziemlich lange Strecke zurück.
Doch im Fall der trüben Flüssigkeiten gibt es auch viele Lichtteilchen, die das andere Ende gar nicht erreichen. Sie durchdringen das Flüssigkeits-Gefäß nicht vollständig, sondern werden bereits kurz nach dem Eindringen nach einigen wenigen Streuprozessen wieder nach außen gelenkt. „Man kann mathematisch zeigen, dass sich diese beiden Effekte erstaunlicherweise genau aufheben“, erklärt Stefan Rotter. „Im Mittel ist der durchschnittliche Weg, den das Licht in der Flüssigkeit zurücklegt, immer gleich lang.“
Tatsächlich ist die Sache ein wenig komplizierter: „Man muss berücksichtigen, dass sich das Licht als Welle durch das Medium bewegt und nicht wie ein Teilchen, das einer ganz bestimmten Bahn folgt“, sagt Stefan Rotter. „Dadurch wird die Sache mathematisch schwieriger zu beschreiben, aber wie sich herausstellt, ändert das nichts am Endergebnis: Auch in einer Beschreibung, die den Wellencharakter von Licht mitberücksichtigt, bleibt der zurückgelegte Weg immer gleich – unabhängig davon, wie stark die Welle im Inneren des Mediums gestreut wird.“
Experimente mit Nanopartikeln
Die theoretischen Berechnungen für dieses kontraintuitive Verhalten wurden bereits vor drei Jahren in einer gemeinsamen Arbeit von Stefan Rotters Arbeitsgruppe mit Kollegen aus Paris vorgestellt. Nun gelang es in einer Kooperation mit diesen französischen Forschungsteams, das Ergebnis experimentell zu bestätigen. Im Experiment wurde Wasser in ein Reagenzglas gefüllt und mit Nanopartikeln vermischt. Je mehr Nanopartikel das Wasser enthält, umso häufiger wird das Licht auf dem Weg durch die Probe gestreut und umso milchig-trüber erscheint die Flüssigkeit.
„Wenn Licht durch diese Flüssigkeit geschickt wird, dann ändert sich die Streuung fortwährend, weil sich die Nanopartikel im Wasser bewegen“, erklärt Stefan Rotter. „Dadurch entsteht ein charakteristisches Glitzern auf der Oberfläche des Reagenzglases. Wenn man dieses genau vermisst und analysiert, kann man daraus auf die Weglänge schließen, die das Licht in der Flüssigkeit zurückgelegt hat.“ Und tatsächlich: Egal, ob man eine fast durchsichtige oder eine milchig-trübe Probe betrachtet – der Weg des Lichts bleibt immer gleich lang.
Dieses erstaunliche Resultat hilft dabei, die Ausbreitung von Wellen in ungeordneten Medien besser zu verstehen. Anwendungsmöglichkeiten dafür gibt es viele. „Es ist ein universelles Gesetz, das grundsätzlich für jede Art von Welle gilt“, erklärt Stefan Rotter. „Ob es Lichtwellen in einer trüben Flüssigkeit sind, ob es sich um Schallwellen handelt, die von Objekten in der Luft gestreut werden, oder auch Gravitationswellen, die eine Galaxie durchdringen - die Physik ist in allen Fällen die gleiche.“
Originalpublikation:
Savo et al., Observation of mean path length invariance in light-scattering media, Science, 2017. DOI: 10.1126/science.aan4054.
Frei zugängliche Version: https://arxiv.org/abs/1703.07114
Beteiligt waren neben Stefan Rotter auch Romolo Savo, Ulysse Najar, Sylvain Gigan (Laboratoire-Kastler-Brossel) und Romain Pierrat, Rémi Carminati (Institut Langevin).
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Der Strahl, der unsichtbar macht
Eine neue Tarnkappen-Technologie wurde an der TU Wien entwickelt: Ein spezielles Material wird von oben so bestrahlt, dass es einen seitlich ankommenden Lichtstrahl ungestört passieren lässt.
Ein Material mit inneren Unregelmäßigkeiten streut einen einfallenden Lichtstrahl in alle Richtungen.
Von oben wird das Material mit einem ganz bestimmten Muster beleuchtet, dadurch kann die Welle von links das Objekt ungestört durchdringen.
Wie macht man Materialien unsichtbar? Ein Forschungsteam der TU Wien hat mit Unterstützung aus Griechenland und den USA einen neuen Ansatz für Tarnkappen-Technologien entwickelt: Ein vollständig undurchsichtiges Material wird von oben oder unten mit einem ganz bestimmten Wellenmuster bestrahlt – und das führt dazu, dass Lichtwellen von links nach rechts völlig ungehindert durch das Material dringen können. Dieses überraschende Resultat eröffnet ganz neue Möglichkeiten für aktive Camouflage. Das Prinzip ist für ganz unterschiedliche Arten von Wellen anwendbar – nicht nur für Licht, sondern etwa auch für Schallwellen. Erste Experimente dazu sind bereits in Planung.
Die Lichtstreuung überlisten
„Komplizierte Materialien wie etwa ein Stück Würfelzucker sind undurchsichtig, weil die Lichtwellen in ihnen unzählige Male abgelenkt und gestreut werden“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das Licht kann zwar eindringen und irgendwo wieder herauskommen, aber die Lichtwelle kann sich nicht geradlinig durch das Medium hindurchbewegen. Stattdessen wird sie chaotisch in alle Richtungen gestreut.“
Seit Jahren gibt es verschiedene Versuche, die Wellenstreuung zu überlisten und somit eine Art „Tarnkappe“ herzustellen. So kann man etwa aus speziellen Materialien Objekte herstellen, die bestimmte Lichtwellen außen um sich herumleiten. Es gibt auch Experimente mit Gegenständen, die von sich aus Licht abstrahlen: Wenn ein Bildschirm nach vorne genau das Licht aussendet, das er auf der Rückseite absorbiert, dann erscheint er unsichtbar – zumindest, wenn man ihn aus dem richtigen Winkel betrachtet.
An der TU Wien versuchte man nun allerdings, das Problem auf fundamentaler Ebene zu lösen. „Wir wollten die Lichtwelle nicht umleiten oder mit Zusatz-Displays wiederherstellen, sondern die ursprüngliche Lichtwelle auf geradem Weg durch das Objekt steuern, so als wäre das Objekt gar nicht da“, sagt Andre Brandstötter, ein Ko-Autor der Studie. „Das klingt merkwürdig, doch mit bestimmten Materialien und unserer speziellen Wellentechnologie ist das möglich.“
Laser-Material
Das Forschungsteam an der TU Wien beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit optisch aktiven Materialien, wie man sie zur Herstellung von Lasern verwendet. Damit ein Laser zu leuchten beginnt, muss ihm in Form von Licht Energie zugeführt werden. Tut man das nicht, verhält sich das Laser-Material wie die meisten anderen auch: Es absorbiert einen Teil des einfallenden Lichts.
„Der entscheidende Trick ist, dem Material punktgenau Energie zuzuführen und an anderen Stellen Absorption zu erlauben“, erklärt Prof. Konstantinos Makris von der Universität Kreta, der zuvor in der Arbeitsgruppe Rotter tätig war. „Von oben wird genau das richtige Punktmuster auf das Material gestrahlt – wie durch einen gewöhnlichen Videoprojektor, allerdings mit sehr hoher Auflösung.“
Passt dieses Muster genau zu den inneren Unregelmäßigkeiten im Material, an denen normalerweise das Licht gestreut wird, kann man durch das von oben zugeführte Licht die Streuung praktisch ausschalten und ein Lichtstrahl kann von links nach rechts völlig ungehindert und verlustfrei durch das Material gelangen.
„Dass es mathematisch überhaupt möglich ist, ein solches Punktmuster zu finden, ist auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich“, sagt Rotter. „Insbesondere muss jedes Objekt, das man durchsichtig machen will, mit einem eigenen Punktmuster bestrahlt werden – abhängig von der mikroskopischen Streuung in seinem Inneren. Wir haben nun eine Methode entwickelt, für ein beliebiges, zufällig streuendes Objekt genau das richtige Bestrahlungs-Punktmuster zu errechnen.“
Licht oder Schall
Dass die Methode funktioniert, konnte man in Computersimulationen bereits zeigen. Nun soll die Idee experimentell umgesetzt werden. Stefan Rotter ist zuversichtlich, dass das gelingen wird: „Wir sind bereits im Gespräch mit experimentellen Forschungsgruppen, mit denen wir das technisch umsetzen möchten. In einem ersten Schritt ist es wahrscheinlich einfacher mit Schallwellen anstatt mit Licht zu arbeiten – aus mathematischer Sicht spielt dieser Unterschied keine erhebliche Rolle.“
Originalpublikation:
Wave propagation through disordered media without backscattering and intensity variations, K. G. Makris, A. Brandstötter, P. Ambichl, Z. H. Musslimani, and S. Rotter, Light: Science & Applications 6, e17035 (2017):
http://www.nature.com/lsa/journal/v6/n9/full/lsa201735a.html
Eine Diskussion des Papers von Patrick Sebbah in Nature Photonics finden Sie hier:
http://rdcu.be/s87y
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Ausgezeichnete Lehre: Best Teacher Award an Herbert Balasin
Herbert Balasin wurde mit dem Best Teacher Award für seine herausragenden Leistungen in der Lehre an der Fakultät für Physik ausgezeichnet. Am Mittwoch, 14. Juni 2017 wurden erstmals die Best Teaching Awards der TU Wien verliehen. Ausgezeichnet wurde besonderes Engagement im Bereich Lehre. Aus 1.700 Nominierungen wurden die Gewinner_innen in je zwei Kategorien pro Fakultät, sowie ein Sonderpreis für externe Lehrende ausgewählt.
Physik, vlnr: Vizerektor Kurt Matyas, Herbert Balasin, Rektorin Sabine Seidler
Best Teacher Award
Ausgezeichnet wurden besonders engagierte Lehrpersonen der TU Wien, wobei die gesamte Lehrleistung und nicht allein eine spezielle Lehrveranstaltung der_des Lehrenden ausschlaggebend war:
• Fakultät für Physik: Privatdoz. DI Dr. Herbert BALASIN | Institut für Theoretische Physik
Herbert Balasin wurde für seine herausragenden Leistungen und sein jahrzehntelanges Engagement in der Lehre an der Fakultät für Physik mit dem Best Teacher Award 2017 ausgezeichnet. Mit seinem Schwerpunkt auf relativistischer Physik vermittelt er ein besonders schwer zugängliches, oft kontra-intuitives Gebiet der forschungsgeleiteten Lehre an der TU Wien. Durch seinen begeisterten und begeisternden Vortrag und seinen Zugang über die Geometrie lässt er den Funken überspringen und nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine große Reise durch die Allgemeine Relativitätstheorie. In seinen Grundlagenvorlesungen wie dem Elektrodynamik-Zyklus bietet er mit seinem fundierten und anschaulichen Vortrag die Grundlage für ein erfolgreiches weiteres Physik-Studium. Seine Wahlfachvorlesungen werden jedes Jahr von sehr, sehr vielen Studierenden aus allen Fakultäten der TU Wien mit großer Begeisterung besucht. Wir gratulieren Herbert Balasin sehr herzlich zu seinem hochverdienten Best Teacher Award 2017.
Die Eule - die Best Teaching Award Trophäe
Vizerektor Matyas bei der Eröffnung der Awardverleihung im TUtheSky
Pro Semester werden an der TU Wien knapp 30.000 Studierende in mehr als 2.000 Lehrveranstaltungen betreut. Lehrende erbringen eine bemerkenswerte Leistung, die die Grundlage für den hervorragenden Ruf und den weltweiten Erfolg von TU-Absolvent_innen darstellt. Dieses Engagement zu würdigen und den Schweinwerfer auf besonders engagierte Lehrende zu richten ist Ziel der Best Teaching Awards.
"Neben dem Inhalt, zeichnet auch die Art wie gelehrt wird, eine gute Universität aus. Dieser Award ist mir wirklich ein besonderes Anliegen, da ich finde, dass es viele Lehrende an unserer Universität gibt, die täglich ihr Bestes geben - trotz manchmal schwieriger Rahmenbedingungen, kreativ und mit Enthusiasmus ihren Job erledigen und darüber hinaus sich auch für das Wohl der Studierenden einsetzen. Anhand der Kommentare der Studierenden haben wir gesehen, dass diese dieses besondere Engagement sehen und auch sehr schätzen. Andere Awards vergeben Bambis, Palmen oder Löwen – wir zeichnen Kolleg_innen mit der TU-Eule – dem Symbol für Weisheit - aus", erklärt Kurt Matyas, Vizerektor für Studium und Lehre.
Die Best Teaching Awards wurden je Fakultät in zwei Kategorien vergeben. In den Best Teaching Awards Kategorien konnten nur TU-interne Lehrende ausgezeichnet werden, da diese im Rahmen ihrer Lehre häufig den Spagat zwischen Forschung, Lehre und Administrativem bewältigen müssen. Da aber auch externe Lehrbeauftragte einen wesentlichen Beitrag zur Lehre leisten und es der TUW ein Anliegen ist, deren Einsatz zu würdigen, wurde ein Sonderpreis für externe Lehrende geschaffen.
Max Riegler - Sub auspiciis Promotionen am 16. Mai 2017 an der TU Wien
Gleich sechs Absolvent_innen der TU Wien erhalten heute, 16. Mai 2017, den Ehrenring der Republik Österreich. Im Rahmen der Sub auspiciis Promotionen werden sie für Bestleistungen in Schule und Studium geehrt. Darunter ist auch Max Riegler, der sein Doktorat am Institut für Theoretische Physik abgeschlossen hat.
Dekan der Fakultät für Mathematik und Geoinformation Michael Drmota, Max Riegler, Michael Hofbauer, Martin Puhl, Rektorin Sabine Seidler, Staatssekretär Harald Mahrer in Vertretung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Martina Lindorfer, Roland Bliem, Benedikt Soja (v.l.n.r.)
Im Kuppelsaal der TU Wien werden promoviert:
• Dipl.-Ing Max Riegler, BSc
Dissertationsthema: How general is holography? : flat space and higher-spin holography in 2+1 dimensions
Fakultät für Physik | Institut für Theoretische Physik
Laudator: Assoc.Prof. Dr. Daniel Grumiller
• Dipl.-Ing. Benedikt Soja, BSc
Dissertationsthema: Application of Kalman Filtering in VLBI Data Analysis
Fakultät für Mathematik und Geoinformation | Department für Geodäsie und Geoinformation
Laudator: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c. Harald Schuh
• Dipl.-Ing. Roland Bliem, BSc
Dissertationsthema: Single metal adatoms at the reconstructed Fe3O4 (001) surface
Fakultät für Physik | Institut für Angewandte Physik
Laudatorin: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Diebold
• Dipl.-Ing Martina Lindorfer, BSc
Dissertationsthema: Malware Through the Looking Glass: Malware Analysis in an Evolving Threat Landscape
Fakultät für Informatik | Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme
Laudator: Privatdoz. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Edgar Weippl
• Mag. Dipl.-Ing. Martin Puhl
Dissertationsthema: Option-Implied Information and Risk-Neutral Probabilities
Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften | Institut für Managementwissenschaften
Laudator: Ao.Univ.-Prof. Mag. DDr. Thomas Dangl
• Dipl.-Ing. Michael Hofbauer, BSc
Dissertationsthema: Single Event Transients in 90 nm CMOS
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering
Laudator: Univ.-Prof. Mag. Dr. Horst Zimmermann
Max Riegler
Max Riegler wurde in Oberpullendorf geboren, ist in Kaindorf bei Hartberg aufgewachsen, bevor der Wohnort Wien wurde, wo er Volksschule und Gymnasium absolvierte. Ab 2007 absolvierte er Bachelor- und Masterstudium der Technischen Physik an der TU Wien inkl. einem Austauschsemester an der ETH Zürich. Das Doktoratsstudium absolvierte Riegler als Teil des Doktoratskollegs "Particles and Interactions", einem universitätsübergreifendes Doktoratskolleg der TU Wien, Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Forschungsaufenthalte in Korea und Japan waren ebenso Bestandteil dieser Zeit wie der Victor Franz Hess-Preis oder das DOC-Stipendium der ÖAW. Der Studienabschluss folgte im September 2016. Derzeit arbeitet Riegler in Belgien als Postdoc an der Université libre de Bruxelles.
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
Mein direktes Umfeld hat sehr positiv reagiert und sich gemeinsam mit mir gefreut. Einem Großteil meines Umfeldes, welches aus Österreich stammt, musste ich nicht erklären, was eine Sub auspiciis Promotion bedeutet. Meinem Umfeld, welches nicht aus Österreich stammt, musste ich hingegen schon erklären, was das ist.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
Meine große Leidenschaft neben der theoretischen Physik ist das Klettern in fast allen seinen Spielformen. Dementsprechend verbringe ich fast meine gesamte Freizeit an Felswänden (sofern vorhanden) in meiner jeweiligen Umgebung, oder, falls es die Topographie oder das Wetter nicht zulässt, in Kletter- bzw. Boulderhallen, um mich auf das nächste Kletterprojekt vorzubereiten.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
Ich persönlich habe die kollegiale Atmosphäre, zumindest im Bereich der technischen Physik sehr geschätzt. Dazu haben in sehr großem Maße die Fachschaften und das engagierte Lehrpersonal beigetragen. Ebenso habe ich es speziell im Falle der technischen Physik als sehr vorteilhaft empfunden, dass die Ausbildung sehr breit gefächert ist und man somit ein sehr breites Basiswissen zur Verfügung hat. Wenn ich einen Satz zur TU zu Maturant_innen sagen müsste, dann wäre das wohl folgendes: "Auch wenn ein Studium an der TU mit sehr viel Disziplin und Arbeitsaufwand verbunden ist, sind die erworbenen Fähigkeiten die Mühen auf jeden Fall mehr als wert!"
Benedikt Soja
Der Wiener Benedikt Soja absolvierte das Bachelorstudium Geodäsie und Geoinformation, gefolgt vom Masterstudium Geodäsie und Geophysik an der TU Wien, unterbrochen von einem Austauschsemester an der ETH Zürich. Danach absolvierte er das Doktoratsstudium Geodäsie und Geoinformationstechnik an der TU Berlin, den Doktoratsabschluss machte er 2016 an der TU Wien. Während und nach dem Doktoratsstudium arbeitete Soja als Forscher am Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam, bevor er im November 2016 als Postdoc-Stipendiat zum NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, USA, wechselte. An Auszeichnungen hat Soja unter anderem den Bernd Rendel-Preis für Geowissenschaften erhalten.
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
Mein Umfeld hat sich durchwegs sehr gefreut und mir ganz herzlich zu dieser Leistung gratuliert. Die Verzögerung der Promotion um mehr als ein Jahr nach der Verteidigung aufgrund der Komplikationen bei der Bundespräsidentenwahl lieferte einiges an Gesprächsstoff. Viele Personen hatten schon von einer Sub auspiciis Promotion gehört, die genauen Hintergründe musste ich aber meistens erklären.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
Neben meiner Tätigkeit als Forscher am NASA Jet Propulsion Laboratory betreibe ich leidenschaftlich den Sport "Mountain unicycling" (dt. Berg-Einradfahren). Es ist vergleichbar mit Mountainbiken, jedoch nur auf einem einzigen Rad. Ich nehme regelmäßig an nationalen und internationalen Wettbewerben teil und bin unter anderem in der Disziplin "Cross Country" amtierender Weltmeister.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
Während meiner Studienzeit habe ich besonders das gute Betreuungsverhältnis im Studienfach Vermessungswesen bzw. Geodäsie geschätzt. Der enge Kontakt zu Professoren und Institutsmitarbeiter_innen hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mich entschieden habe, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen. Meine Empfehlung für Maturant_innen: "Ein Studium an der TU eröffnet komplett neue Wege – wage das Unbekannte!"
Roland Bliem
Roland Bliem ist gebürtiger Salzburger (Tamsweg) und absolvierte sein Physikstudium bis zum Doktorat an der TU Wien. Ein Austauschsemester an der Universität von Granada in Spanien sowie diverse Forschungsaufenthalte von Erlangen, Stuttgart über Lund (Schweden) bis Berkeley (USA) bereicherten das TU-Studium. An Preisen konnte Bliem unter anderem 2015 den Christian Doppler Preis des Landes Salzburg gewinnen. Nach Studienabschluss war er als Postdoc am Institut für Angewandte Physik der TU Wien tätig, seit November 2016 arbeitet Bliem am MIT in Cambridge, Massachusetts, USA.
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
Meine Familie und meine Freunde haben sich sehr mit mir über diese Auszeichnung gefreut, und insbesondere meine Familie ist stolz auf diese Leistung. Einigen war zuvor nicht bekannt, was eine Promotion Sub auspiciis ist, aber generell wurde es sehr positiv aufgenommen, dass es diese Ehrung in Österreich gibt.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit in den Bergen, vor allem Schifahren und Wandern gehören zu meinen Leidenschaften. Abgesehen davon reise ich gerne, um andere Länder und Kulturen kennen zu lernen.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
Die Ausbildung an der TU Wien ist praxisorientiert, ohne den theoretischen Hintergrund zu vernachlässigen. Projektarbeiten ermöglichen Studierenden einen direkten Einblick in die Forschung der Arbeitsgruppen an der TU. Die Selektion an theoretisch orientierten Wahlfächern sowie praxisnahen, experimentellen Kursen erlaubt, verschiedene Teilgebiete der Wissenschaft kennenzulernen. Der eine Satz, den ich Maturant_innen zur TU Wien sagen würde, ist: Wenn du Freude an Naturwissenschaft und Technik hast und verschiedene theoretische und praxisnahe Aspekte deines Fachgebiets kennenlernen möchtest, ist die TU Wien sicher eine gute Wahl.
Martina Lindorfer
Die gebürtige Linzerin Martina Lindorfer absolvierte ihr Bachelorstudium der Informatik an der FH Hagenberg (OÖ), bevor sie für das Masterstudium Software Engineering an die TU Wien wechselte. Hier schloss Lindorfer im November 2015 auch ihr Doktoratsstudium ab. Forschungsaufenthalte verbrachte sie in Südkorea, Japan, Griechenland und den USA. Lindorfer kann auch auf eine Reihe von Auszeichnungen verweisen wie zum Beispiel ein Marshall Plan Stipendium und eine Google Anita Borg Memorial Scholarship. Derzeit forscht Martina Lindorfer an der University of California, Santa Barbara, USA als Postdoc in der Computer Security Group.
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
In Österreich kennt man das und in meinem Bekanntenkreis hat sich jeder sehr für mich gefreut, insbesondere meine Eltern. In den USA an der University of California, Santa Barbara war es schon schwieriger zu erklären warum ich mittlerweile im 2. Jahr Postdoc bin, aber noch immer kein offizieller Doktor bin.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
Reisen, Fotografieren, und Gourmetküche (gerne auch alles gemeinsam, aber nicht zwangsläufig in derselben Sekunde).
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
Ich habe erst zum Master an die TU Wien gewechselt und vorher meinen Bachelor an der Fachhochschule Oberösterreich in Hagenberg absolviert. Im Gegensatz zur sehr praxis-orientierten Ausbildung an der FH habe ich an der TU theoretische Grundlagen gelernt und auch selbstständigeres Arbeiten als mit dem fixen Studienplan an der FH war gefordert. Genau diese Flexibilität in der Auswahl der Fächer an der TU habe ich sehr geschätzt. Generell war für mich beides eine gute Mischung. Mein Rat richtet sich hauptsächlich an Maturantinnen: Man soll sich nicht einschüchtern lassen von den gängigen Informatiker Stereotypen und eventuell fehlendem Vorwissen. Ich habe nach der Matura an der HAK das Programmieren auch erst am Anfang des Studiums gelernt - im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen, die das schon in der HTL gelernt oder sich selber in der Freizeit beigebracht haben.
Martin Puhl
Martin Puhl lebt in Wien und studierte nicht nur das Diplomstudium Technische Physik an der TU Wien, sondern auch parallel Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien. In einem Austauschsemester in New York an der Zicklin School of Business vertiefte er sich in Finanzthemen. Sein Doktorat in Financial Economics betrieb er an der TU Wien und als Gastforscher an der Universität Oxford. Puhl arbeitet seit Februar 2011 für die Bankenaufsicht der Österreichischen Nationalbank und beschäftigt sich mit Modellen zur Risikobewertung für Banken und Versicherungen.
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
Glücklich, dass das Doktorat geschafft ist. Ich bin meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden sehr für die Unterstützung während dieser sehr intensiven Zeit dankbar. Ohne sie wäre das sehr schwer möglich gewesen. Die Sub auspiciis Promotion war dann eine zusätzliche Freude. Welche Ehrung ich da erhalte, musste ich im weiteren Bekanntenkreis aber öfter erklären.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
Reisen und Tanzen. Ich bin gerne unterwegs. Ob Afrika, Asien, Europa, Amerika oder Australien, man braucht mich nicht lange dazu überreden. Mein zweites Hobby ist das Tanzen. Während des Studiums war ich Mitglied in einer Wiener Walzer Formation und bin auf vielen Bällen und einigen Konferenzen und Konzerten aufgetreten. Heutzutage gehen sich noch ein paar Bälle im Jahr und der gelegentliche Freitagabend auf der Tanzfläche aus.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
An der TU habe ich die persönliche Betreuung und die direkte Kontaktmöglichkeit mit den Professor_innen sehr geschätzt. Man spürt die Begeisterung und den Einsatz der Lehrenden und findet leicht jemanden für Fragen oder interessante Diskussionen. Maturant_innen würde ich auf den Weg geben, dass man an der TU, in meinem Fall in der Physik, vor allem eine Art zu denken und an Aufgaben heranzugehen mitbekommt. Dies hilft einem in jedem Feld – ob jetzt in der Technik oder Wissenschaft, oder im Wirtschaftsleben.
Michael Hofbauer
Der Wiener Michael Hofbauer schloss die HTL 1, Wien 16 im Zweig Nachrichtentechnik ab. Danach folgte das Bachelorstudium Elektrotechnik, gefolgt vom Masterstudium Mikroelektronik an der TU Wien. Berufserfahrung sammelte er unter anderem bei Aufenthalten in Grenoble, Frankreich oder in Harwell Oxford, England. Schon während des Studiums arbeitete Hofbauer als Tutor und studentischer Mitarbeiter am Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering der TU Wien, wo er dann während des Doktoratsstudiums als Projektassistent tätig war und seit 2016 als Universitätsassistent angestellt ist.
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
Außer den Leuten in meinem direkten universitären Umfeld war die Sub auspiciis Promotion kaum jemandem aus meinem Bekanntenkreis und meiner Familie ein Begriff. Mein direktes Umfeld hat sich zuerst gewundert, warum so viel Zeit zwischen Rigorosum und Promotion vergeht, und warum man während dieser Zeit den Doktortitel noch nicht führen darf. Nach meiner Erklärung bezüglich der Sub auspiciis Promotion haben sich aber alle sehr für mich gefreut. So richtig realisiert habe ich es selbst allerdings erst mit dem Erhalt der offiziellen Einladung zur Promotion.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
Meine fachlichen Interessen sind auch eine große Leidenschaft von mir. Darüber hinaus liebe ich es zu reisen, die Natur zu erkunden und zu lesen. In meiner Freizeit fahre ich gerne Rad oder gehe schwimmen.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
Neben der Tatsache, dass sich die Lehrinhalte der Studienrichtungen an der TU Wien sehr gut mit meinen persönlichen Interessensgebieten überschneiden, schätze ich an der Ausbildung an der TU Wien besonders das gute Betreuungsverhältnis. Es herrscht schon beinahe ein familiäres Umfeld. Außerdem schätze ich die Möglichkeit praxisnahe Forschung zu betreiben und die gute Zusammenarbeit mit Kommiliton_innen sowie mit Kolleg_innen. Maturant_innen würde ich sagen, dass die möglichen Studien an der TU sicher herausfordernd sind, dass sich die Meisterung dieser Herausforderung aber auf jeden Fall lohnt und, dass das Studium selbst auch großen Spaß macht.
Aussender und Rückfragehinweis:
Herbert Kreuzeder, M.A.
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
pr@tuwien.ac.at
Sub auspiciis Promotionen am 16. Mai 2017 an der TU Wien
Gleich sechs Absolvent_innen der TU Wien erhalten den Ehrenring der Republik Österreich von Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen. Im Rahmen der Sub auspiciis Promotionen werden sie für Bestleistungen in Schule und Studium geehrt. Darunter ist auch Max Riegler, der sein Doktorat am Institut für Theoretische Physik abgeschlossen hat.
Max Riegler
Benedikt Soja, Roland Bliem, Max Riegler, Martina Lindorfer, Martin Puhl, Michael Hofbauer (v.l.n.r.)
Max Riegler (MR) wurde in Oberpullendorf geboren, ist in Kaindorf bei Hartberg aufgewachsen, bevor der Wohnort Wien wurde, wo er Volksschule und Gymnasium absolvierte. Ab 2007 absolvierte er Bachelor- und Masterstudium der Technischen Physik an der TU Wien inkl. einem Austauschsemester an der ETH Zürich. Das Doktoratsstudium absolvierte Riegler als Teil des Doktoratskollegs "Particles and Interactions", einem universitätsübergreifendes Doktoratskolleg der TU Wien, Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Forschungsaufenthalte in Korea und Japan waren ebenso Bestandteil dieser Zeit wie der Victor Franz Hess-Preis oder das DOC-Stipendium der ÖAW. Der Studienabschluss folgte im September 2016. Derzeit arbeitet Riegler in Belgien als Postdoc an der Université libre de Bruxelles.
Drei Fragen an Max Riegler:
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
MR: Mein direktes Umfeld hat sehr positiv reagiert und sich gemeinsam mit mir gefreut. Einem Großteil meines Umfeldes, welches aus Österreich stammt, musste ich nicht erklären, was eine Sub auspiciis Promotion bedeutet. Meinem Umfeld, welches nicht aus Österreich stammt, musste ich hingegen schon erklären, was das ist.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
MR: Meine große Leidenschaft neben der theoretischen Physik ist das Klettern in fast allen seinen Spielformen. Dementsprechend verbringe ich fast meine gesamte Freizeit an Felswänden (sofern vorhanden) in meiner jeweiligen Umgebung, oder, falls es die Topographie oder das Wetter nicht zulässt, in Kletter- bzw. Boulderhallen, um mich auf das nächste Kletterprojekt vorzubereiten.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
MR: Ich persönlich habe die kollegiale Atmosphäre, zumindest im Bereich der technischen Physik sehr geschätzt. Dazu haben in sehr großem Maße die Fachschaften und das engagierte Lehrpersonal beigetragen. Ebenso habe ich es speziell im Falle der technischen Physik als sehr vorteilhaft empfunden, dass die Ausbildung sehr breit gefächert ist und man somit ein sehr breites Basiswissen zur Verfügung hat.
Wenn ich einen Satz zur TU zu Maturant_innen sagen müsste, dann wäre das wohl folgendes:
"Auch wenn ein Studium an der TU mit sehr viel Disziplin und Arbeitsaufwand verbunden ist, sind die erworbenen Fähigkeiten die Mühen auf jeden Fall mehr als wert!"
Im Kuppelsaal der TU Wien werden promoviert:
• Dipl.-Ing. Benedikt Soja, BSc
Dissertationsthema: Application of Kalman Filtering in VLBI Data Analysis
Fakultät für Mathematik und Geoinformation | Department für Geodäsie und Geoinformation
Laudator: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr.h.c. Harald Schuh
• Dipl.-Ing. Roland Bliem, BSc
Dissertationsthema: Single metal adatoms at the reconstructed Fe3O4 (001) surface
Fakultät für Physik | Institut für Angewandte Physik
Laudatorin: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrike Diebold
• Dipl.-Ing Max Riegler, BSc
Dissertationsthema: How general is holography? : flat space and higher-spin holography in 2+1 dimensions
Fakultät für Physik | Institut für Theoretische Physik
Laudator: Assoc.Prof. Dr. Daniel Grumiller
• Dipl.-Ing Martina Lindorfer, BSC
Dissertationsthema: Malware Through the Looking Glass: Malware Analysis in an Evolving Threat Landscape
Fakultät für Informatik | Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme
Laudator: Privatdoz. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Edgar Weippl
• Mag. Dipl.-Ing. Martin Puhl
Dissertationsthema: Option-Implied Information and Risk-Neutral Probabilities
Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften | Institut für Managementwissenschaften
Laudator: Ao.Univ.-Prof. Mag. DDr. Thomas Dangl
• Dipl.-Ing. Michael Hofbauer, BSc
Dissertationsthema: Single Event Transients in 90 nm CMOS
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering
Laudator: Univ.-Prof. Mag. Dr. Horst Zimmermann
Der Wiener Benedikt Soja (BS) absolvierte das Bachelorstudium Geodäsie und Geoinformation, gefolgt vom Masterstudium Geodäsie und Geophysik an der TU Wien, unterbrochen von einem Austauschsemester an der ETH Zürich. Danach absolvierte er das Doktoratsstudium Geodäsie und Geoinformationstechnik an der TU Berlin, den Doktoratsabschluss machte er 2016 an der TU Wien. Während und nach dem Doktoratsstudium arbeitete Soja als Forscher am Deutschen GeoForschungsZentrum in Potsdam, bevor er im November 2016 als Postdoc-Stipendiat zum NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Kalifornien, USA, wechselte. An Auszeichnungen hat Soja unter anderem den Bernd Rendel-Preis für Geowissenschaften erhalten.
Roland Bliem (RB) ist gebürtiger Salzburger (Tamsweg) und absolvierte sein Physikstudium bis zum Doktorat an der TU Wien. Ein Austauschsemester an der Universität von Granada in Spanien sowie diverse Forschungsaufenthalte von Erlangen, Stuttgart über Lund (Schweden) bis Berkeley (USA) bereicherten das TU-Studium. An Preisen konnte Bliem unter anderem 2015 den Christian Doppler Preis des Landes Salzburg gewinnen. Nach Studienabschluss war er als Postdoc am Institut für Angewandte Physik der TU Wien tätig, seit November 2016 arbeitet Bliem am MIT in Cambridge, Massachusetts, USA.
Max Riegler (MR) wurde in Oberpullendorf geboren, ist in Kaindorf bei Hartberg aufgewachsen, bevor der Wohnort Wien wurde, wo er Volksschule und Gymnasium absolvierte. Ab 2007 absolvierte er Bachelor- und Masterstudium der Technischen Physik an der TU Wien inkl. einem Austauschsemester an der ETH Zürich. Das Doktoratsstudium absolvierte Riegler als Teil des Doktoratskollegs "Particles and Interactions", einem universitätsübergreifendes Doktoratskolleg der TU Wien, Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Forschungsaufenthalte in Korea und Japan waren ebenso Bestandteil dieser Zeit wie der Victor Franz Hess-Preis oder das DOC-Stipendium der ÖAW. Der Studienabschluss folgte im September 2016. Derzeit arbeitet Riegler in Belgien als Postdoc an der Université libre de Bruxelles.
Die gebürtige Linzerin Martina Lindorfer (ML) absolvierte ihr Bachelorstudium der Informatik an der FH Hagenberg (OÖ), bevor sie für das Masterstudium Software Engineering an die TU Wien wechselte. Hier schloss Lindorfer im November 2015 auch ihr Doktoratsstudium ab. Forschungsaufenthalte verbrachte sie in Südkorea, Japan, Griechenland und den USA. Lindorfer kann auch auf eine Reihe von Auszeichnungen verweisen wie zum Beispiel ein Marshall Plan Stipendium und eine Google Anita Borg Memorial Scholarship. Derzeit forscht Martina Lindorfer an der University of California, Santa Barbara, USA als Postdoc in der Computer Security Group.
Martin Puhl (MP) lebt in Wien und studierte nicht nur das Diplomstudium Technische Physik an der TU Wien, sondern auch parallel Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien. In einem Austauschsemester in New York an der Zicklin School of Business vertiefte er sich in Finanzthemen. Sein Doktorat in Financial Economics betrieb er an der TU Wien und als Gastforscher an der Universität Oxford. Puhl arbeitet seit Februar 2011 für die Bankenaufsicht der Österreichischen Nationalbank und beschäftigt sich mit Modellen zur Risikobewertung für Banken und Versicherungen.
Der Wiener Michael Hofbauer (MH) schloss die HTL 1, Wien 16 im Zweig Nachrichtentechnik ab. Danach folgte das Bachelorstudium Elektrotechnik, gefolgt vom Masterstudium Mikroelektronik an der TU Wien. Berufserfahrung sammelte er unter anderem bei Aufenthalten in Grenoble, Frankreich oder in Harwell Oxford, England. Schon während des Studiums arbeitete Hofbauer als Tutor und studentischer Mitarbeiter am Institute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering der TU Wien, wo er dann während des Doktoratsstudiums als Projektassistent tätig war und seit 2016 als Universitätsassistent angestellt ist.
Drei Fragen an die Ausgezeichneten:
Wie hat Ihr direktes Umfeld auf die Sub auspiciis Promotion reagiert? Mussten Sie erst erklären, was das ist?
BS: Mein Umfeld hat sich durchwegs sehr gefreut und mir ganz herzlich zu dieser Leistung gratuliert. Die Verzögerung der Promotion um mehr als ein Jahr nach der Verteidigung aufgrund der Komplikationen bei der Bundespräsidentenwahl lieferte einiges an Gesprächsstoff. Viele Personen hatten schon von einer Sub auspiciis Promotion gehört, die genauen Hintergründe musste ich aber meistens erklären.
RB: Meine Familie und meine Freunde haben sich sehr mit mir über diese Auszeichnung gefreut, und insbesondere meine Familie ist stolz auf diese Leistung. Einigen war zuvor nicht bekannt, was eine Promotion Sub auspiciis ist, aber generell wurde es sehr positiv aufgenommen, dass es diese Ehrung in Österreich gibt.
MR: Mein direktes Umfeld hat sehr positiv reagiert und sich gemeinsam mit mir gefreut. Einem Großteil meines Umfeldes, welches aus Österreich stammt, musste ich nicht erklären, was eine Sub auspiciis Promotion bedeutet. Meinem Umfeld, welches nicht aus Österreich stammt, musste ich hingegen schon erklären, was das ist.
ML: In Österreich kennt man das und in meinem Bekanntenkreis hat sich jeder sehr für mich gefreut, insbesondere meine Eltern. In den USA an der University of California, Santa Barbara war es schon schwieriger zu erklären warum ich mittlerweile im 2. Jahr Postdoc bin, aber noch immer kein offizieller Doktor bin.
MP: Glücklich, dass das Doktorat geschafft ist. Ich bin meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden sehr für die Unterstützung während dieser sehr intensiven Zeit dankbar. Ohne sie wäre das sehr schwer möglich gewesen. Die Sub auspiciis Promotion war dann eine zusätzliche Freude. Welche Ehrung ich da erhalte, musste ich im weiteren Bekanntenkreis aber öfter erklären.
MH: Außer den Leuten in meinem direkten universitären Umfeld war die Sub auspiciis Promotion kaum jemandem aus meinem Bekanntenkreis und meiner Familie ein Begriff. Mein direktes Umfeld hat sich zuerst gewundert, warum so viel Zeit zwischen Rigorosum und Promotion vergeht, und warum man während dieser Zeit den Doktortitel noch nicht führen darf. Nach meiner Erklärung bezüglich der Sub auspiciis Promotion haben sich aber alle sehr für mich gefreut. So richtig realisiert habe ich es selbst allerdings erst mit dem Erhalt der offiziellen Einladung zur Promotion.
Neben dem fachlichen Interesse: Was ist Ihre Leidenschaft? Hobbies?
BS: Neben meiner Tätigkeit als Forscher am NASA Jet Propulsion Laboratory betreibe ich leidenschaftlich den Sport “Mountain unicycling” (dt. Berg-Einradfahren). Es ist vergleichbar mit Mountainbiken, jedoch nur auf einem einzigen Rad. Ich nehme regelmäßig an nationalen und internationalen Wettbewerben teil und bin unter anderem in der Disziplin “Cross Country” amtierender Weltmeister.
RB: In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit in den Bergen, vor allem Schifahren und Wandern gehören zu meinen Leidenschaften. Abgesehen davon reise ich gerne, um andere Länder und Kulturen kennen zu lernen.
MR: Meine große Leidenschaft neben der theoretischen Physik ist das Klettern in fast allen seinen Spielformen. Dementsprechend verbringe ich fast meine gesamte Freizeit an Felswänden (sofern vorhanden) in meiner jeweiligen Umgebung, oder, falls es die Topographie oder das Wetter nicht zulässt, in Kletter- bzw. Boulderhallen, um mich auf das nächste Kletterprojekt vorzubereiten.
ML: Reisen, Fotografieren, und Gourmetküche (gerne auch alles gemeinsam, aber nicht zwangsläufig in derselben Sekunde).
MP: Reisen und Tanzen. Ich bin gerne unterwegs. Ob Afrika, Asien, Europa, Amerika oder Australien, man braucht mich nicht lange dazu überreden. Mein zweites Hobby ist das Tanzen. Während des Studiums war ich Mitglied in einer Wiener Walzer Formation und bin auf vielen Bällen und einigen Konferenzen und Konzerten aufgetreten. Heutzutage gehen sich noch ein paar Bälle im Jahr und der gelegentliche Freitagabend auf der Tanzfläche aus.
MH: Meine fachlichen Interessen sind auch eine große Leidenschaft von mir. Darüber hinaus liebe ich es zu reisen, die Natur zu erkunden und zu lesen. In meiner Freizeit fahre ich gerne Rad oder gehe schwimmen.
Welchen Aspekt der Ausbildung an der TU Wien schätzen Sie besonders? Was ist der eine Satz, den Sie Maturant_innen zur TU sagen würden?
BS: Während meiner Studienzeit habe ich besonders das gute Betreuungsverhältnis im Studienfach Vermessungswesen bzw. Geodäsie geschätzt. Der enge Kontakt zu Professoren und Institutsmitarbeiter_innen hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich mich entschieden habe, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen.
Meine Empfehlung für Maturant_innen: “Ein Studium an der TU eröffnet komplett neue Wege – wage das Unbekannte!“
RB: Die Ausbildung an der TU Wien ist praxisorientiert, ohne den theoretischen Hintergrund zu vernachlässigen. Projektarbeiten ermöglichen Studierenden einen direkten Einblick in die Forschung der Arbeitsgruppen an der TU. Die Selektion an theoretisch orientierten Wahlfächern sowie praxisnahen, experimentellen Kursen erlaubt, verschiedene Teilgebiete der Wissenschaft kennenzulernen.
Der eine Satz, den ich Maturant_innen zur TU Wien sagen würde, ist: Wenn du Freude an Naturwissenschaft und Technik hast und verschiedene theoretische und praxisnahe Aspekte deines Fachgebiets kennenlernen möchtest, ist die TU Wien sicher eine gute Wahl.
MR: Ich persönlich habe die kollegiale Atmosphäre, zumindest im Bereich der technischen Physik sehr geschätzt. Dazu haben in sehr großem Maße die Fachschaften und das engagierte Lehrpersonal beigetragen. Ebenso habe ich es speziell im Falle der technischen Physik als sehr vorteilhaft empfunden, dass die Ausbildung sehr breit gefächert ist und man somit ein sehr breites Basiswissen zur Verfügung hat.
Wenn ich einen Satz zur TU zu Maturant_innen sagen müsste, dann wäre das wohl folgendes:
"Auch wenn ein Studium an der TU mit sehr viel Disziplin und Arbeitsaufwand verbunden ist, sind die erworbenen Fähigkeiten die Mühen auf jeden Fall mehr als wert!"
ML: Ich habe erst zum Master an die TU Wien gewechselt und vorher meinen Bachelor an der Fachhochschule Oberösterreich in Hagenberg absolviert. Im Gegensatz zur sehr praxis-orientierten Ausbildung an der FH habe ich an der TU theoretische Grundlagen gelernt und auch selbstständigeres Arbeiten als mit dem fixen Studienplan an der FH war gefordert. Genau diese Flexibilität in der Auswahl der Fächer an der TU habe ich sehr geschätzt. Generell war für mich beides eine gute Mischung.
Mein Rat richtet sich hauptsächlich an Maturantinnen: Man soll sich nicht einschüchtern lassen von den gängigen Informatiker Stereotypen und eventuell fehlendem Vorwissen. Ich habe nach der Matura an der HAK das Programmieren auch erst am Anfang des Studiums gelernt - im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen, die das schon in der HTL gelernt oder sich selber in der Freizeit beigebracht haben.
MP: An der TU habe ich die persönliche Betreuung und die direkte Kontaktmöglichkeit mit den Professor_innen sehr geschätzt. Man spürt die Begeisterung und den Einsatz der Lehrenden und findet leicht jemanden für Fragen oder interessante Diskussionen.
Maturant_innen würde ich auf den Weg geben, dass man an der TU, in meinem Fall in der Physik, vor allem eine Art zu denken und an Aufgaben heranzugehen mitbekommt. Dies hilft einem in jedem Feld – ob jetzt in der Technik oder Wissenschaft, oder im Wirtschaftsleben.
MH: Neben der Tatsache, dass sich die Lehrinhalte der Studienrichtungen an der TU Wien sehr gut mit meinen persönlichen Interessensgebieten überschneiden, schätze ich an der Ausbildung an der TU Wien besonders das gute Betreuungsverhältnis. Es herrscht schon beinahe ein familiäres Umfeld. Außerdem schätze ich die Möglichkeit praxisnahe Forschung zu betreiben und die gute Zusammenarbeit mit Kommiliton_innen sowie mit Kolleg_innen.
Maturant_innen würde ich sagen, dass die möglichen Studien an der TU sicher herausfordernd sind, dass sich die Meisterung dieser Herausforderung aber auf jeden Fall lohnt und, dass das Studium selbst auch großen Spaß macht.
TU Wien startet zwei neue Doktoratskollegs
Um Bio-Nanotechnologie und um neue 2D-Materialien wird es in den beiden neuen von der TU Wien geförderten Doktoratskollegs gehen, die am 5. April eröffnet wurden.
Bio-interfaces und niedrigdimensionale Materialien
Miriam Unterlass, eine der Leiterinnen des DK "Bio-Interface"
Florian Libisch, Leiter des DK "TU-D"
Gleich zwanzig neue Dissertations-Stellen wurden an der TU Wien geschaffen. Gefördert wird dadurch die interdisziplinäre Arbeit innerhalb der TU Wien an zwei hochaktuellen, zukunftsträchtigen Forschungsgebieten: Das Doktoratskolleg „Biointerface“ untersucht Schnittstellen zwischen biologischen Zellen und ihrer anorganischen Umgebung. Im Doktoratskolleg „TU-D“ wird es um neuartige niedrigdimensionale Materialien gehen – etwa um das 2D-Material Graphen.
Beide Doktoratskollegs sind sehr interdiziplinär angelegt, insgesamt sind sechs Fakultäten der TU Wien an den Projekten beteiligt: Physik, Technische Chemie, Maschinenbau, Mathematik, Bauingenieurwesen sowie Elektrotechnik und Informationstechnik. Finanziert werden die zwanzig Doktoratsstellen von der TU Wien, für einen Zeitraum von drei Jahren. Offiziell eröffnet wurden die beiden Kollegs am 5. April 2017.
Man braucht nicht immer gleich drei Dimensionen
Normalerweise hängen die Eigenschaften eines Materials von der dreidimensionalen Struktur ab, in der seine Atome angeordnet sind. Doch manche Materialien sind bloß zweidimensional – und das eröffnet oft völlig neue Möglichkeiten. „Begonnen hat das Forschungsgebiet mit dem berühmt gewordenen Material Graphen, das aus einer einzigen Schicht von Kohlenstoffatomen besteht“, erklärt Prof. Florian Libisch, der das Kolleg „TU-D“ leitet. „Doch mittlerweile ist das Forschungsgebiet viel größer geworden, wir wollen in unserem Doktoratskolleg eine ganze Palette unterschiedlicher niedrigdimensionaler Materialien untersuchen.“
Dabei werden ganz verschiedene Aspekte der Materialforschung vereint – von der Herstellung und Charakterisierung der Materialien über die Modellierung und Simulation ihrer Eigenschaften am Computer bis hin zu ihrem Einsatz für technische Anwendungen.
Die Zelle und ihre Umgebung
Biologische Zellen haben eine Vielzahl an Strategien zur Verfügung, ihre Umgebung zu analysieren und auf die Eigenschaften von Oberflächen um sie herum zu reagieren. „Was wir bisher über dieses Thema wissen, ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Prof. Gerhard Kahl, der das DK „Biointerface“ gemeinsam mit Prof. Gerhard Schütz und Dr. Miriam Unterlass leitet. „In unserem Doktoratskolleg wird es darum gehen, funktionale Schnittstellen zwischen anorganischen und bio-organischen Systemen herzustellen.“ Das soll grundlegend neue Erkenntnisse bringen und neue technologische Anwendungen ermöglichen.
Auch das Doktoratskolleg „Biointerface“ umfasst zahlreiche Forschungsgebiete, von der Festkörper- und Oberflächenphysik über Biophysik und Zellbiologie bis zur Nanotechnologie und organischen Chemie. Auch theoretische Physik, mathematische Modellierung und Scientific Computing spielen dabei eine wichtige Rolle.
Gruppenfoto zum Abschied
Stefan Nagele verlässt nach 11 Jahren das Institut für Theoretische Physik in Richtung Europäisches Patentamt.
Stehend, vlnr: Isabella Floss, Matthias Liertzer, Stefan Nagele, Joachim Burgdörfer, Stefan Donsa, Florian Aigner, Iva Hunger Brezinova
Kniend, vlnr: Valerie Smejkal, Alexander Schumer, Heike Höller
Mit Sekt und (Schokolade-)Torte, wie es sich in der Gruppe von Prof. Burgdörfer gehört, wurde der Abschied von Stefan Nagele gefeiert. Von viel Talent und gemeinsamer Wissenschaft, etlichen Schokoladenwetten und der guten und wohlwollenden Stimmung in der Gruppe und am Institut war die Rede, von Dank und der Freude, bald wieder auf Besuch zu kommen.
Doch erst einmal geht es nach München, wo bereits eine luftige Wohnung in einem ruhigen Stadtteil auf die junge Familie Nagele wartet. In seiner Tätigkeit am Europäischen Patentamt wird Stefan Patentanträge im Hinblick auf ihre Einzigartigkeit recherchieren und auf ihre Patentwürdigkeit hin beurteilen. Seine Frau Susi hat bereits das bayerische Zulassungsverfahren als Kunst- und Italienisch-Gymnasiallehrerin durchlaufen und sucht derzeit eine Schule in München.
Zurück bleibt – auch ganz in der Tradition der Gruppe Burgdörfer – eine signierte Sektflasche und die Vorfreude auf einen Besuch am Institut.
(28. März 2017)
Neuste Resultate vom Large Hadron Collider in Wien
Am 1. und 2. Dezember 2016 findet in Wien das zwölfte Vienna Central European Seminar (VCES) über Teilchenphysik und Quantenfeldtheorie statt.
Computersimulation einer Kollision zweier schwarzer Löcher
Die Vorträge sind im Naturhistorischen Museum Wien, wo noch bis 1. Mai 2017 die thematisch passende Sonderausstellung "Wie alles begann. Von Galaxien, Quarks und Kollisionen" gezeigt wird. Das VCES gibt es in Wien seit dem Jahr 2004 und ist Nachfolger der Konferenzreihe "Vienna Triangle Seminar", bei dem sich über 35 Jahre lang Wissenschaftler_innen aus Bratislava, Budapest und Wien ausgetauscht haben. Die Veranstaltung soll Nachwuchswissenschaftler_innen als Ausgangspunkt für wissenschaftliche Kooperationen, Konferenzen und Postgraduiertenkursen in Zentraleuropa dienen.
Thematisch steht VCES dieses Jahr unter dem Motto "Physik am Large Hadron Collider - Run 2". Nach zwei Jahren intensiver Arbeit wurde im Jahr 2015 der Large Hadron Collider (LHC) am europäischen Forschungslabor CERN nahe Genf mit beinahe verdoppelter Kollisionsenergie wieder in Betrieb genommen. Allein im Jahr 2016 wurden damit mehr Daten gesammelt, als in alle vorherigen Betriebsjahren zusammen. Im Jahr 2012 wurde mit dem LHC erstmals das Higgs-Boson nachgewiesen und damit alle Bausteine der Standardmodells der Teilchenphysik experimentell bestätigt. In der zweiten Betriebsphase geht es nun darum, das Higgs-Boson genauer zu vermessen und neue Phänomene zu entdecken, die jenseits der bekannten Standardmodell-Theorie liegen.
Im Rahmen der VCES-Konferenz werden erste Resultate aus der neuen Betriebsphase des LHC gezeigt und die Ergebnisse vonseiten der theoretischen Physik beleuchtet und ausgiebig diskutiert. Am Abend des ersten Tages gibt es zudem einen öffentlichen Abendvortrag in englischer Sprache des US-amerikanischen theoretischen Physikers Marc Kamionkowski: "Cosmic ripples from black holes and the big bang". In seinem Vortrag wird Prof. Kamionkowski über die erstmals im Herbst 2015 entdeckten Gravitationswellen sprechen, die aus der Kollision zweiter schwarzer Löcher entstanden sind. Zudem wird er den Zusammenhang zwischen Schwarzen Löchern und Dunkler Materie beleuchten und wie man Gravitationswellen aus dem Urknall nachweisen könnte. Der Eintritt ist frei und Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung im Naturhistorischen Museums.
Das VCES wird gemeinsam von der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und dem Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) organisiert, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Organisiert wird das Seminar im Rahmen vom FWF-Doktoratskolleg "Particles und Interactions", dass gemeinsam von den drei oben genannten Instituten geleitet wird. Zudem wird die Veranstaltung vom Europäischen COST-Netzwerk unterstützt.
Weiterführende Informationen:
VCES 2016: https://indico.cern.ch/event/523588/
Öffentlicher Abendvortrag: https://indico.cern.ch/event/523588/images/11640-Public-Lecture.jpg
Ausstellung "wie alles begann. Von Galaxien, Quarks und Kollisionen" im NHM Wien: http://www.nhm-wien.ac.at/anfang
Bild: © http://wwwsfb.tpi.uni-jena.de/Projects/B7.shtml
Neue Quantenzustände für bessere Quantenspeicher
Wie kann man Quanteninformation möglichst lange abspeichern? Einem Team der TU Wien gelingt bei der Entwicklung von Quantenspeichern ein wichtiger Schritt nach vorne.
Ein künstlicher Diamant unter dem optischen Mikroskop. Da der Diamant viele Stickstoff-Fehlstellen enthält, fluoresziert er in roter Farbe.
Messapparatur zur Herstellung von langlebigen Quantenzuständen. Um den Einfluss von thermischem Rauschen auszuschließen, wird der Aufbau auf 20 Milligrad (-273.13° Celsius) über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt.
Die Speicher, die wir heute für unsere Computer verwenden, unterscheiden nur zwischen 0 und 1. Die Quantenphysik erlaubt aber auch beliebige Überlagerungen von Zuständen. Auf diesem Grundsatz, dem "Superpositionsprinzip", beruhen Ideen für neue Quanten-Technologien. Ein zentrales Problem daran ist allerdings, dass solche quantenphysikalischen Überlagerungen sehr kurzlebig sind. Nur für eine winzige Zeitspanne kann man die Information aus einem Quantenspeicher zuverlässig auslesen, danach ist sie unwiederbringlich verloren.
An der TU Wien ist nun in der Entwicklung neuer Quantenspeicher-Konzepte ein wichtiger Schritt nach vorne gelungen. In Zusammenarbeit mit dem japanischen Telekommunikationsriesen NTT arbeiten die Wiener Forscher unter der Leitung von Johannes Majer an Quantenspeichern aus Stickstoffatomen und Mikrowellen. Durch ihre unterschiedliche Umgebung weisen die Stickstoffatome alle leicht unterschiedliche Eigenschaften auf, wodurch der Quantenzustand relativ schnell „zerläuft“. Durch gezielte Manipulation eines kleinen Teils der Atome kann man diese jedoch in einen neuen Quantenzustand bringen, der eine mehr als zehnfache Lebensdauer hat. Diese Ergebnisse wurden nun im Fachjournal "Nature Photonics" veröffentlicht.
Stickstoff im Diamant
"Wir verwenden synthetische Diamanten, in denen einzelne Stickstoffatome eingebaut sind.", erklärt Projektleiter Johannes Majer vom Atominstitut der TU Wien. "Den Quantenzustand dieser Stickstoffatome koppeln wir mit Mikrowellen, das ergibt ein Quantensystem, in dem wir Information speichern und später wieder auslesen können."
Die Speicherdauer in diesen Systemen ist allerdings durch die inhomogene Verbreiterung der Mikrowellenübergänge in den Stickstoffatomen im Diamantkristall beschränkt. Nach etwa einer halben Mikrosekunde kann der Quantenzustand nicht mehr zuverlässig ausgelesen werden, das eigentliche Signal geht verloren. Das Team um Johannes Majer hatte nun die Idee des "spektralen Lochbrennens", einem Trick, der es im optischen Bereich ermöglicht Daten in inhomogen verbreiterten Medien zu speichern, für supraleitende Quantenschaltkreise und Spin-Quantenspeicher zu adaptieren.
Dmitry Krimer, Beneditk Hartl und Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik der TU Wien) konnten in einer Theoriearbeit zeigen, dass solche Zustände, die vom störenden Rauschen weitgehend entkoppelt sind auch für diese Systeme existieren. "Der Trick ist das Quantensystem durch gezielte Manipulation in diese langlebigen Zustände zu bringen, damit die Information auch dort abgespeichert werden kann“, erklärt Dmitry Krimer.
Bestimmte Energien ausschließen
"Durch die lokalen Eigenschaften des nicht ganz perfekten Diamantkristalls haben die Übergänge in den Stickstoffatomen leicht unterschiedliche Energien", erklärt Stefan Putz, Erstautor der Studie, der mittlerweile von der TU Wien an die Princeton University gewechselt ist. Wenn man mit Hilfe von Mikrowellen gezielt Stickstoffatome bei einer bestimmten Energien "ausbleicht" entsteht ein "Spektrales Loch". Die übrigen Stickstoffatome können dann in einen neuen Quantenzustand, einen so genannten Dunkelzustand, im Zentrum dieses "Spektralen Lochs" gebracht werden. Dieser ist viel stabiler und eröffnet völlig neue Möglichkeiten. „Unsere Arbeit ist ein Machbarkeitsbeweis für ein neues Konzept mit dem wir das Fundament für die weitere Erkundung innovativer Operationsprotokolle von Quantenspeichern legen wollen“, sagt Stefan Putz.
Mit der neuen Methode konnte die Lebensdauer von Quantenzuständen des gekoppelten Systems aus Mikrowellen und Stickstoffatomen um mehr als das zehnfache auf etwa fünf Mikrosekunden gesteigert werden. Das ist in den Zeitmaßstäben unseres Alltags noch immer nicht viel, reicht allerdings für wichtige quantentechnologische Anwendungen bereits aus. "Der Vorteil unseres Systems ist, dass man Quanteninformation innerhalb von Nanosekunden einschreiben und auslesen kann", erklärt Johannes Majer. "In den Mikrosekunden, die es stabil gehalten werden kann, ist daher eine große Zahl von Arbeitsschritten möglich."
Originalpublikationen: Spectral hole burning and its application in microwave photonics Nature Photonics: PUBLISHED ONLINE: 21 NOVEMBER 2016 | DOI: 10.1038/NPHOTON.2016.225
http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2016.225.html
Hybrid quantum systems with collectively coupled spin states: suppression of decoherence through spectral hole burning, Phys. Rev. Lett. 115, 033601 (2015) | DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.033601
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.033601
Rückfragehinweis:
Univ.Ass. Dipl.-Phys. Dr. Johannes Majer
Atominstitut
Technische Universität Wien
johannes.majer@tuwien.ac.at
Die Spitzen-Leistung der Elektronen
Scharfe Metallspitzen verwendet man, um Elektronen gezielt in eine Richtung zu senden. Ein Quanten-Effekt liefert nun eine neue Methode, die Elektronen-Emission extrem genau zu kontrollieren.
Laserpulse werden auf eine Metallspitze geschossen und lösen Elektronen heraus. [1]
Joachim Burgdörfer (r) und Christoph Lemell (l)
Florian Libisch - vor einem Supercomputer
Wenn man Elektronen präzise kontrollieren will, dann lässt man sie aus feinen Metallspitzen austreten – so macht man das etwa in einem Elektronenmikroskop. Seit Kurzem werden solche Metallspitzen auch als hochpräzise Elektronenquellen zur Erzeugung von Röntgenstrahlung verwendet. Ein Team der TU Wien entwickelte nun gemeinsam mit einer Forschungsgruppe aus Deutschland (FAU Erlangen-Nürnberg) eine Methode, diese Elektronenemission mit Hilfe zweier Laserpulse viel genauer zu steuern als bisher. Damit wird es jetzt möglich, den Fluss der Elektronen auf extrem kurzen Zeitskalen ein- und auszuschalten.
Nur die Spitze zählt
„Die Grundidee ist ähnlich wie beim Blitzableiter“, erklärt Prof. Christoph Lemell vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Das elektrische Feld rund um eine Nadel ist immer genau an der Spitze am größten. Daher schlägt der Blitz in die Spitze des Blitzableiters ein, und aus demselben Grund verlassen Elektronen die Nadel genau an der Spitze.“
Mit modernen Methoden der Nanotechnologie kann man heute extrem feine Nadeln herstellen, ihre Spitze hat eine Ausdehnung von wenigen Nanometern. Man weiß also sehr genau, an welcher Stelle die Elektronen das Metall verlassen. Wichtig ist es zusätzlich nun aber auch, eine genaue Kontrolle darüber zu haben, ob und zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Elektronen aus der Metallspitze austreten.
Genau das wird nun mit einer neuen Technik möglich: „Man beschießt die Metallspitze mit zwei verschiedenen Laserpulsen“, erklärt Florian Libisch (TU Wien). Die Farben dieser Laser wählt man so, dass die Lichtteilchen des einen Lasers genau doppelt so viel Energie haben wie die Lichtteilchen des anderen Lasers. Wichtig ist außerdem, dass die Lichtwellen der beiden Laser perfekt im gleichen Takt schwingen.
Das Team von der TU Wien konnte aufgrund von Computersimulationen vorhersagen, dass sich die zeitliche Verzögerung eines der beiden Pulse als „Schalter“ für die Elektronenemission verwenden lässt. Diese Vorhersage wurde nun von der Forschungsgruppe von Prof. Peter Hommelhoff von der FAU Erlangen-Nürnberg experimentell bestätigt. Aufgrund dieser Ergebnisse konnte auch der detaillierte Prozessablauf erklärt werden.
Elektronen, die Lichtteilchen absorbieren
Schießt man Laserpulse auf die Metallspitze kann das elektrische Feld des Lasers Elektronen aus dem Metall reißen – das war bereits bekannt. Neu ist allerdings, dass es durch die Kombination von zwei verschiedenen Lasern eine Möglichkeit gibt, die Emission der Elektronen auf wenige Femtosekunden genau zu kontrollieren.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Elektron ausreichend viel Energie bekommen kann, um die Nadelspitze zu verlassen: Beispielsweise kann das Elektron entweder ein Lichtteilchen des Lasers mit höherer Energie und zwei Lichtteilchen mit niedrigerer Energie absorbieren oder aber vier Lichtteilchen des niederenergetischen Laserpulses. Beides führt zum selben Ergebnis. „So wie ein Teilchen im Doppelspaltexperiment, das sich auf zwei Pfaden gleichzeitig bewegt, kann ein Elektron auch hier zwei verschiedene Wege gleichzeitig beschreiten“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer (TU Wien). „Die Natur legt sich nicht fest, welchen Weg das Elektron nimmt – beide Möglichkeiten finden gleichzeitig statt und überlagern einander.“
Durch präzise Kontrolle der beiden Laser kann man nun einstellen, ob sich diese beiden Quanten-Möglichkeiten gegenseitig verstärken – dann kommt es zu einer erhöhten Emission von Elektronen – oder ob sie einander stattdessen auslöschen sollen, sodass praktisch überhaupt keine Elektronen ausgesandt werden. So kann man einfach und effektiv die Elektronen-Emission kontrollieren.
Das ist nicht nur eine ganz neue Methode, mit der man nun wichtige Experimente mit energiereichen Elektronen durchführen kann, die neue Technik soll in Zukunft auch eine sehr präzise Steuerung von Röntgenstrahlen ermöglichen: „Es wird bereits an innovativen Röntgen-Quellen gearbeitet, die Arrays aus feinen Nano-Spitzen als Elektronenquelle verwenden“, erklärt Lemell. „Mit unserer neuen Methode könnte man diese Nano-Spitzen genau richtig ansteuern, um kohärente Röntgenstrahlung zu erzeugen.“
Originalpublikation: Phys. Rev. Lett. 117, 217601 DOI:
10.1103/PhysRevLett.117.217601:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.217601
[1] Copyright: FAU Erlangen/Nürnberg
Rückfragehinweise:
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at
Dr. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
florian.libisch@tuwien.ac.at
TU Chor im Halbfinale bei der Großen Chance der Chöre
Der TU Chor singt am Freitag, 18. November 2016, ab 20:15 Uhr auf ORF eins um den Einzug ins Finale der Castingshow "Die Große Chance der Chöre". Jeder Anruf zählt!
Mit einer ungewöhnlichen Performance von Adeles "Skyfall" überzeugte der TU Chor Jury-Mitglied Fräulein Mai und konnte mit ihrem Joker direkt ins Halbfinale der Großen Chance der Chöre einziehen. Am 18. November 2016 müssen sich die Sänger_innen gegen elf weitere Chöre behaupten. Ob der Einzug ins Finale gelingt, entscheidet dieses Mal nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum. Jeder Anruf für den TU Chor zählt.
Die große Chance der Chöre – Das Weihnachtsalbum
Alle 25 Halbfinalisten der zweiten Staffel der ORF-Castingshow zeigen auf dem Weihnachtsalbum, das am 25. November 2016 erscheint, ihr vielseitiges Talent. Der TU Chor ist mit "Carol of the Bells" in der Version von Pentatonix mit dabei.
Die Große Chance der Chöre | Halbfinale LIVE
Freitag, 18. November 2016 ab 20:15 Uhr, ORF eins
http://diegrossechance.orf.at/choere/stories/2799887
http://chor.tuwien.ac.at
Bild: © ORF | Hans Leitner
Zwei Wege führen aus dem Helium-Atom
Ein Effekt, zwei verschiedene Wege: Im Fachjournal „Science“ präsentiert ein Forschungsteam mit Beteiligung der TU Wien, wie sich Quantenüberlagerungen im Helium-Atom auf extrem kurzen Zeitskalen aufbauen.
Ein Helium-Atom kann auf zwei verschiedene Arten ionisiert werden.
Joachim Burgdörfer, Stefan Nagele, Stefan Donsa und Renate Pazourek (v.l.n.r.)
Es ist zweifellos das berühmteste Experiment in der Quantenphysik: Beim Doppelspaltversuch wird ein einzelnes Teilchen auf eine Platte mit zwei Öffnungen geschossen, und aufgrund seiner Quanteneigenschaften muss es sich nicht für eine der beiden Öffnungen entscheiden, es tritt durch beide gleichzeitig hindurch. Etwas Ähnliches lässt sich auch beobachten, wenn man einem Helium-Atom mit einem Laserpuls ein Elektron entreißt.
So wie sich ein Teilchen gleichzeitig auf zwei Pfaden bewegt, kann Ionisation von Helium gleichzeitig über zwei verschiedene Prozesse ablaufen – und das lässt sich an ganz speziellen Überlagerungseffekten erkennen. Im Fall des Helium-Atoms handelt es sich dabei um sogenannte „Fano-Resonanzen“. Nun gelang es einem Team der TU Wien, des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg und der Kansas State University, das Entstehen dieser Fano-Resonanzen direkt zu beobachten – obwohl dieser Effekt auf der Zeitskala von Femtosekunden abläuft.
Das Experiment wurde in Heidelberg durchgeführt, die Grundidee für das Experiment und komplexe Computersimulationen kamen von der TU Wien, weitere theoretische Beiträge lieferte die Kansas State University.
Direkter und indirekter Weg
Wenn ein Laserpuls das Helium-Atom trifft und ausreichend viel Energie auf eines der Elektronen überträgt, wird das Elektron einfach aus dem Atom herausgerissen. Es gibt allerdings noch eine zweite Möglichkeit, wie das Helium-Atom ionisiert werden kann – sie ist etwas komplizierter, wie Prof. Joachim Burgdörfer (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) erklärt: „Wenn man beide Elektronen in einen höheren Energiezustand versetzt, dann kann eines davon wieder in den niedrigeren Energiezustand zurückkehren. Die dabei freiwerdende Energie kann auf das zweite Elektron übertragen werden, das damit schließlich das Atom verlässt.“
Das Endresultat beider Prozesse ist genau derselbe, beide verwandeln das neutrale Helium-Atom in ein Helium-Ion mit nur noch einem verbleibenden Elektron. So betrachtet sind beide Prozesse prinzipiell ununterscheidbar.
Fano-Resonanzen
„Quantenphysikalisch betrachtet kann jedes Atom beide Wege gleichzeitig beschreiten“, erklärt Renate Pazourek (TU Wien). „Genau das hinterlässt charakteristische Spuren.“ Wenn man das Licht untersucht, das von den Helium-Atomen absorbiert wird, dann erkennt man sogenannte Fano-Resonanzen – ein klares Zeichen dafür, dass hier der Endzustand auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden kann, einmal direkt und einmal indirekt.
Das lässt sich aber auch gezielt verhindern: Während des Ionisationsprozesses kann man den Zwischenschritt mit einem weiteren Laserstrahl ausschalten, dann gibt es nur noch den direkten Weg zur Ionisation und die Fano-Resonanz ist verschwunden. Das eröffnet nun eine neue Möglichkeit, den zeitlichen Ablauf des Prozesses zu studieren: Man erlaubt dem Atom zunächst, beide Wege gleichzeitig zu gehen, erst nach einer gewissen Zeit blockiert man den indirekten Weg. Je nachdem, wie lange beide Pfade gleichzeitig zugänglich waren, sind die Fano-Resonanzen stärker oder schwächer ausgeprägt.
Zusehen, wie Quanteneffekte entstehen
„Fano-Resonanzen konnte man schon in unterschiedlichen Systemen beobachten, sie spielen in der Atomphysik eine wichtige Rolle“, sagt Stefan Donsa (TU Wien). „Im Experiment konnten nun zum ersten Mal gezeigt werden, wie diese Resonanzen entstehen, wie man sie kontrollieren kann und wie sie sich im Lauf von Femtosekunden nach und nach aufbauen.“
„Die Zeitskalen, auf denen solche Quanten-Effekte ablaufen, sind so kurz, dass sie nach üblichen Zeitmaßstäben ganz plötzlich erscheinen, von einem Augenblick zum nächsten“, sagt Stefan Nagele. „Erst durch neue, aufwändige Methoden der Attosekundenphysik wird es heute möglich, den zeitlichen Ablauf solcher Vorgänge genau zu studieren.“
Das hilft nicht nur dabei, fundamentale Quanteneffekte besser zu verstehen, es liefert auch neue Möglichkeiten, in solche Abläufe einzugreifen und sie zu steuern – bis hin zu chemischen Reaktionen, die gezielt herbeigeführt oder unterdrückt werden können.
Originalpublikation (Observing the ultrafast build-up of a Fano resonance in the time domain, A. Kaldun et al., Science. (DOI: 10.1126/science.aah6972)):
http://science.sciencemag.org/content/354/6313/738
Wie groß das Interesse an diesen grundlegenden Effekten ist, zeigt auch, dass in derselben Ausgabe des Science-Magazins eine Arbeit von französischen und spanischen Forschern erscheint, welche eine komplementäre Methode der zeitaufgelösten Photoelektronen-Spektroskopie eingesetzt haben, um einen Blick „von außen“ auf die Fano-Resonanz des Atoms zu werfen (DOI: 10.1126/science.aah5188).
Rückfragehinweise:
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at
Dr. Stefan Nagele
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.nagele@tuwien.ac.at
Den Quanten beim Springen zusehen
Die bisher genauste zeitliche Vermessung von Quantensprüngen gelang in einem Forschungsprojekt von TU Wien und Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.
Ein kurzer Laserpuls ionisiert ein Helium-Atom und kann den Zustand des verbleibenden Elektrons verändern.
Stefan Nagele, Joachim Burgdörfer und Renate Pazourek
Ganz plötzlich können Quantenteilchen ihren Zustand ändern, man spricht dann oft von „Quantensprüngen“. So können Atome zum Beispiel ein Lichtteilchen absorbieren und dadurch in einen Zustand mit höherer Energie wechseln. Meistens geht man davon aus, dass solche Vorgänge ganz abrupt ablaufen, von einem Augenblick auf den anderen. Mit neuen Methoden, die an der TU Wien maßgeblich mitentwickelt wurden, gelingt es nun allerdings, die zeitliche Struktur dieser extrem schnellen Übergänge zu studieren. Ähnlich wie das Elektronenmikroskop erlaubt, einen Blick auf winzige räumliche Strukturen zu werfen, die für das Auge unsichtbar sind, kann man nun mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse zeitliche Strukturen analysieren, die uns bisher verborgen waren.
Den theoretischen Teil der Forschungsarbeit übernahm das Team von Prof. Joachim Burgdörfer an der TU Wien, das auch die ursprüngliche Idee für das Experiment entwickelt hatte. Der experimentelle Teil wurde am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching durchgeführt. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Physics“ publiziert.
Die genaueste Zeitmessung eines Quantensprungs
Ein neutrales Heliumatom hat zwei Elektronen. Wenn man es mit einem energiereichen Laserpuls beschießt, kann es zur Ionisation kommen: Eines der Elektronen wird vom Laserpuls fortgerissen und verlässt das Atom. Dieser Prozess läuft auf der Zeitskala von Attosekunden ab – eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde.
„Nun könnte man glauben, dass das zweite Elektron, das im Atom bleibt, bei diesem Prozess gar keine Rolle spielt – das stimmt aber nicht“, sagt Renate Pazourek (TU Wien). Die beiden Elektronen sind korreliert, also quantenphysikalisch eng miteinander verbunden, daher kann man sie nicht isoliert voneinander betrachten. „Wenn das eine Elektron aus dem Atom gerissen wird, kann es passieren, dass ein Teil der Laser-Energie auf das zweite Elektron übertragen wird. Es bleibt zwar im Atom gebunden, wird aber in einen höheren Energiezustand versetzt“, erklärt Stefan Nagele (ebenfalls TU Wien).
Man kann also zwei verschiedene Ionisationsprozesse beobachten: Einen, in dem das verbleibende Elektron zusätzliche Energie bekommt, und einen, in dem es im Zustand minimaler Energie bleibt. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Versuchsaufbaus mit zwei verschiedenen Lasern konnte man nun zeigen, dass diese beiden Prozesse nicht exakt gleich lange dauern.
„Wenn das verbleibende Elektron einen Teil der Energie abbekommt, dann läuft der Photoionisationsprozess schneller ab – um etwa fünf Attosekunden“, erklärt Stefan Nagele. Bemerkenswert ist, wie gut theoretische Berechnungen und aufwändige Computersimulationen (durchgeführt am Vienna Scientific Cluster, Österreichs größtem Supercomputer) mit den Messungen übereinstimmen: „Die Genauigkeit des Experiments liegt bei weniger als einer Attosekunde, das ist die genaueste Zeitmessung für einen Quantensprung, die es bisher gab“, sagt Renate Pazourek.
Kontrolle über die Attosekunde
Das Experiment liefert neue Einblicke in die Physik ultrakurzer Zeitskalen. Was man vor wenigen Jahrzehnten noch als „plötzlich“ oder „instantan“ gesehen hat, lässt sich heute als zeitliche Entwicklung betrachten, die man berechnen, messen und sogar kontrollieren kann. Das hilft nicht nur dabei, die grundlegenden Gesetze der Natur besser zu verstehen, es ermöglicht auch neue Methoden, die Materie auf kleinster Skala zu manipulieren.
Originalpublikation (Attosecond Correlation Dynamics, M. Ossiander et al. Nature Physics):
http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/full/nphys3941.html
Rückfragehinweis:
Dr. Renate Pazourek
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
renate.pazourek@tuwien.ac.at
Leuchtender Zufall
Es galt als kaum erreichbares Ziel in der Laserforschung: Gebündeltes Licht im Terahertz-Bereich, das aus vielen verschiedenen Wellenlängen besteht. An der TU Wien gelang nun eine erste Umsetzung mit einem überraschenden Trick.
Karl Unterrainer, Sebastian Schönhuber, Michael Krall und Stefan Rotter (v.l.n.r.)
Zufallslaser mit Mikro-Löchern
Der Zufallslaser strahlt nicht in alle Richtungen, sondern gezielt nach oben.
Terahertzwellen sind zwar schwer herzustellen, aber sie sind äußerst nützlich. Man kann sie zum Beispiel für chemische Sensoren verwenden, die ganz bestimmte Stoffe detektieren. Dafür müssen sie allerdings zwei wichtige Anforderungen erfüllen: Erstens muss der Terahertz-Lichtstrahl eng gebündelt sein, damit man ihn gezielt an den gewünschten Ort lenken kann, und zweitens darf er nicht wie gewöhnliches Laserlicht bloß eine einzelne Wellenlänge aufweisen, sondern sollte aus vielen verschiedenen Wellenlängen zusammengesetzt sein. Beides gleichzeitig zu erreichen war bisher kaum möglich. An der TU Wien gelang es nun mit einem ungewöhnlichen Trick erstmals einen gebündelten Terahertz-Laser mit Breitband-Spektrum herzustellen: Durch zufällig angeordnete Löcher im aktiven Lasermedium.
Den Zufall mit einbauen
„Wir beschäftigen uns mit zwei unterschiedlichen Arten von Lasern, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben“, sagt Sebastian Schönhuber vom Institut für Photonik (Fakultät für Elektrotechnik) der TU Wien. „Einerseits forschen wir an Quantenkaskadenlasern, die aus genau aufeinander abgestimmten dünnen Halbleiterschichten bestehen, andererseits haben wir uns in unserem aktuellen Projekt auch mit Zufallslasern beschäftigt.“
Quantenkaskadenlaser werden an der TU Wien bereits seit Jahren entwickelt. Sie bestehen aus einem ausgeklügelten Halbleiter-Schichtsystem. Schon bei der Konstruktion des Lasers kann man dadurch genau festlegen, welche Wellenlängen das abgestrahlte Licht haben soll. Allerdings senden Quantenkaskadenlaser ihr Licht nicht in eine bestimmte Richtung, sondern sie strahlen für gewöhnlich einen breiten Lichtkegel ab. Dieses Licht danach wieder auf einen engen Strahl zu fokussieren ist kaum möglich.
Ein ähnliches Problem hat man bei den sogenannten Zufallslasern - einem völlig anderen und recht neuen Konzept der Lasertechnik. „Zufallslaser bestehen typischerweise aus Pulvern oder Flüssigkeiten, die das Licht erzeugen und es dann gleichzeitig in ihrem Inneren immer wieder zufällig streuen“, erklärt Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik. So bewegen sich die Lichtwellen auf ungeordnete, schwer vorhersehbare Weise durch den Laser. Das kann dazu führen, dass viele unterschiedliche Wellenlängen gleichzeitig abgestrahlt werden – allerdings in alle Richtungen gleichzeitig, ähnlich wie bei einer Glühbirne.
Zufällige Löcher, wie im Schweizer Käse
In einem Forschungsprojekt, in dem die beiden TU-Forschungsgruppen aus der Elektrotechnik und aus der Physik zusammenarbeiteten, wurde nun beides miteinander verknüpft: An zufällig ausgewählten Positionen wurden Löcher in einen Quantenkaskadenlaser gebohrt, somit wurde er zum Zufallslaser. Der zunächst überraschende Nebeneffekt dieses neuen Konzepts: Der durchlöcherte Laser sendet den seine Strahlung direkt nach oben, in Form eines sehr eng gebündelten Strahls.
„Diesen Effekt im Detail zu erklären, war zunächst gar nicht einfach“, sagt Martin Brandstetter vom Institut für Photonik. „Es liegt an der Art, wie sich die einzelnen Wellenlängen zu einem Strahl addieren. Einzelne Frequenzanteile können in verschiedene Richtungen ausgesandt werden, aber insgesamt ist der Strahl eng fokussiert. Er zeigt genau in die Richtung, in der man die Löcher in den Quantenkaskadenlaser gebohrt hat.“
Damit steht nun erstmals ein Laser zur Verfügung, der einerseits breitbandige Teraherzstrahlung aus vielen unterschiedlichen Wellenlängen absendet und andererseits seine Strahlung in eine genau definierte Richtung abgibt – ein wichtiger Schritt für die Anwendung von Zufallslasern in der Praxis. Nun möchte man an der TU Wien noch einen Schritt weitergehen: „Wir wollen eine noch größere spektrale Bandbreite erreichen. Dadurch sollen neue Anwendungen in der Spektroskopie und bei bildgebenden Verfahren in diesem hochinteressanten aber technisch herausfordernden Bereich der Terahertzstrahlung möglich werden“, ist Sebastian Schönhuber zuversichtlich.
Originalpublikation: Schönhuber et al., Optica Vol. 3, Issue 10, pp. 1035-1038 (2016), doi: 10.1364/OPTICA.3.001035:
https://www.osapublishing.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-3-10-1035&id=350245
Rückfragehinweis:
Dipl.-Ing. Sebastian Schönhuber
Institut für Photonik
Technische Universität Wien
sebastian.schoenhuber@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
florian.aigner@tuwien.ac.at
Künstliche 2D-Kristalle auf Knopfdruck verändern
Geladene Teilchen können ganz von selbst eine unerwartet große Vielzahl von Kristallstrukturen bilden. Ein Forschungsteam mit Beteiligung der TU Wien zeigt, wie man die Bildung dieser Strukturen einfach kontrollieren kann.
Ganz unterschiedliche Strukturen können die Teilchen ausbilden, die sich zwischen zwei geladenen Platten befinden.
In der Natur gibt es eine bunte Vielfalt von Kristallen – vom einfachen Salzkristall über schillernde Opale bis hin zu biologischen Kristallen, die für die Farbenpracht von Schmetterlingsflügeln verantwortlich sind. Doch mit neuen technischen Methoden könnte die Vielfalt der Kristalle noch deutlich erweitert werden: Sogenannte „kolloidale Systeme“ bestehen aus Teilchen, die sich ganz von selbst zu geordneten Strukturen zusammenfinden. Eine Forschungsgruppe mit Beteiligung der TU Wien konnte nun zeigen, dass man Teilchen zwischen zwei geladenen Platten dazu bringen kann, eine erstaunlich große Anzahl völlig unterschiedlicher Kristallstrukturen zu bilden. Ändert man Abstand und elektrische Ladung der Platten, ordnen sich die Teilchen auf völlig andere Weise an.
Wigner-Kristalle
Die Grundidee gibt es schon lange: „Der Nobelpreisträger Eugene Wigner, einer der ganz Großen der theoretischen Physik, beschäftigte sich schon in den 1930erjahren mit der Frage, wie sich geladene Teilchen auf einer ebenen, elektrisch geladenen Platte verteilen“, erklärt Prof. Gerhard Kahl vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Sie ordnen sich nicht zufällig an, sondern bilden eine Struktur – einen sogenannten Wigner-Kristall.“ Wigners Vorhersage, dass die Teilchen ein hexagonales Gitter bilden, konnte 1979 mit Elektronen auf einer Helium-Oberfläche verifiziert werden.
Was lag also näher, als einen Schritt weiterzugehen und das Verhalten von Teilchen zwischen zwei parallelen, geladenen Platten zu untersuchen? Moritz Antlagner widmete sich dieser Fragestellung in einem Teil seiner Dissertation in der Forschungsgruppe von Gerhard Kahl. Bald zeigte sich, dass es sich dabei um ein überaus kniffliges Thema handelt: Die Teilchen können in diesem Fall nämliche eine bemerkenswerte Fülle unterschiedlicher Strukturen bilden. Man stößt auf dreieckige, viereckige oder gar fünfeckige Muster – letzteres ist bei geordneten Strukturen besonders ungewöhnlich. Auch verschiedene Kombinationen dieser Muster kann man beobachten. Die Teilchen können sich in zwei Schichten organisieren: Eine nahe der oberen Platte, die anderen bei der unteren Platte. Jede Schicht kann ihr eigenes geometrisches Muster bilden, die Gesamtstruktur ist nur dann stabil, wenn beide Muster kompatibel sind und in einer passenden geometrischen Beziehung zueinander stehen.
Die Vielfalt der möglichen Muster zu berechnen und zu charakterisieren war eine äußerst aufwändige Aufgabe: „Wir führen analytische Rechnungen durch, entwickelten Computersimulationen und spezielle, neuartige Optimierungsalgorithmen“, sagt Gerhard Kahl. Dabei arbeitete das Team aus Wien mit Kollegen aus Paris und Bratislava zusammen. Der Rechenaufwand war enorm: „Ungefähr 1.5 Millionen CPU-Stunden an Großrechnern in Wien und Paris wurden verbraucht. Außerdem musste viel Arbeit in die Analyse und Interpretation der Daten investiert werden“, berichtet Gerhard Kahl. Mit viel Geduld gelang es schließlich, die riesige Zahl an möglichen Strukturen in ein Schema – ein sogenanntes Phasendiagramm – einzuordnen.
Wie sich zeigte, hängt die erstaunliche Vielfalt an Kristallmustern zwischen den beiden Platten bloß von zwei charakteristischen Größen ab: Dem Abstand der Platten und dem Verhältnis ihrer elektrischen Ladungen. Unterschiedliche Kombinationen dieser beiden Parameter ergeben ganz unterschiedliche Kristallmuster.
„Dass die Vielfalt an möglichen Strukturen so einfach zu kontrollieren ist – über die Kombination von bloß zwei Parametern – das war für uns überraschend“, sagt Gerhard Kahl. Damit kann man nun zweidimensionale Kristallstrukturen gezielt steuern und auf Knopfdruck verändern. „Für die Physik von Halbleiter-Doppelschichten, ionischen Plasmen oder Graphen-Doppelschichten kann das von großer Bedeutung sein“, meint Kahl.
Rückfragehinweis:
Prof. Gerhard Kahl
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
„Künstliches Atom“ in Graphen-Schicht
Elektronen offenbaren ihre Quanteneigenschaften, wenn man sie in engen Bereichen gefangen hält. Ein Forschungsteam mit TU Wien-Beteiligung baut Elektronen-Gefängnisse in Graphen.
Die elektrisch geladene Spitze eines Rastertunnelmikroskops (oben) und ein zusätzliches Magnetfeld führen zu stabilen, lokalisierten Elektronenzuständen im Graphen.
Florian Libisch erklärt die Graphen-Struktur
Wenn man Elektronen in einem engen Gefängnis einsperrt, dann benehmen sie sich ganz anders als im freien Raum. Ähnlich wie die Elektronen in einem Atom können sie dann nur noch ganz bestimmte Energien annehmen – daher bezeichnet man solche winzigen Elektronengefängnisse auch als „künstliche Atome“. In vielerlei Hinsicht benehmen sich die Elektronen in künstlichen Atomen genauso wie in echten Atomen. Sie zeigen aber auch zusätzliche Eigenschaften, die häufig für die Anwendung insbesondere in der Quanteninformation besonders interessant sind.
Das wurde nun mit Hilfe einiger technischer Tricks erstmals für künstliche Atome in Graphen gezeigt. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Nano Letters“ publiziert, neben der TU Wien waren auch die RWTH Aachen und die Universität Manchester beteiligt.
Künstliche Atome bauen
„Künstliche Atome bieten uns neue, spannende Möglichkeiten, weil man ihre Eigenschaften gezielt verändern kann“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik. In Halbleitermaterialien wie Galliumarsenid ist es bereits gelungen, Elektronen in winzigen Bereichen kontrolliert einzusperren. Man spricht in diesem Fall auch von „Quantenpunkten“ bzw. „Quantum Dots“. Ähnlich wie die Elektronen eines Atoms, die auf ganz bestimmten Bahnen um den Atomkern kreisen, können die Elektronen auch in einem solchen Quantenpunkt nur ganz bestimmte Zustände annehmen.
Noch weitaus interessantere Möglichkeiten ergeben sich allerdings bei der Verwendung des in den letzten Jahren berühmt gewordenen Materials Graphen, das aus einer einzigen Schicht sechseckig angeordneter Kohlenstoffatome besteht. „In den meisten Materialien gibt es für jedes Elektron mit einer bestimmten Energie zwei verschiedene quantenmechanische Zustände – in Graphen sind es durch die geometrische Symmetrie des Materials sogar vier. Das eröffnet potentielle Anwendung in der Quanteninformation, zum Beispiel um Information zu speichern und quantenphysikalisch zu verarbeiten“, erklärt Florian Libisch von der TU Wien. Die Herstellung kontrollierbarer künstlicher Atome in Graphen galt bisher allerdings als besonders schwierig.
Ausschneiden genügt nicht
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein künstliches Atom zu erzeugen: Die einfachste ist, eine kleine Flocke aus dem Material auszuschneiden und ein Elektron hineinzusetzen. Das funktioniert bei Graphen zwar, allerdings wird dabei die Symmetrie des Materials durch den rauhen Rand der Flocke (der auf atomarer Skala niemals perfekt glatt ist) gestört, sodass die vier Zustände sich auf die gewöhnlichen zwei reduzieren.
Man begab sich also auf die Suche nach anderen Möglichkeiten: Es ist gar nicht nötig, kleine Flocken von Graphen zu benutzen, um die Elektronen in winzigen Bereichen einzusperren. Besser gelingt es durch eine ausgeklügelte Kombination von elektrischen und magnetischen Feldern. Mit der Spitze eines Rastertunnelmikrokops kann man lokal ein elektrisches Feld anlegen. Dadurch entsteht im Graphen ein winziger Bereich, in dem sich Elektronen mit niedriger Energie aufhalten können. Gleichzeitig zwingt man die Elektronen mit einem zusätzlichen Magnetfeld auf winzige Kreisbahnen. „Würde man nur elektrische Felder verwenden, könnten die Elektronen durch quantenmechanische Effekte problemlos entkommen“ erklärt Libisch.
Nobelpreisträger-Beteiligung
Vermessen wurden die neuartigen künstlichen Atome an der RWTH Aachen von Nils Freitag und Peter Nemes-Incze in der Gruppe von Prof. Markus Morgenstern. Simulationen und theoretische Modelle dazu lieferten Larisa Chizhova, Florian Libisch und Joachim Burgdörfer am Institut für theoretische Physik der TU Wien. Die Graphen-Probe selbst kam vom Team rund um Andre Geim und Kostya Novoselov – die beiden Forscher wurden 2010 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, nachdem es ihnen erstmals gelungen war, Graphen herzustellen.
Die kontrollierbaren künstlichen Atome im Graphen eröffnen nun eine Spielwiese für viele neue quantentechnologische Experimente: „Die vier lokalisierte Elektronen-Zustände mit gleicher Energie ermöglichen es, zwischen den unterschiedlichen Zuständen hin und her zu schalten und Information zu speichern. “, erklärt Joachim Burgdörfer. Über lange Zeitskalen könnten die Elektronen beliebige Überlagerungen der Zustände beibehalten, ideale Voraussetzungen für so genannte Quantencomputer. Außerdem hat die neue Methode den Vorteil ausgezeichneter Skalierbarkeit: Man könnte auf einem kleinen Chip ohne großen Aufwand eine große Zahl solcher künstlicher Atome herstellen und sie für Quanteninformations-Anwendungen nutzen.
Originalpublikation: DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02548:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02548
Rückfragehinweis:
Dr. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
florian.libisch [at] tuwien.ac.at
How General Is Holography? Flat Space and Higher-Spin Holography in 2+1 Dimensions
Der heurige Victor-Hesspreis geht an Max Riegler für seine Dissertation "How general is holography?". Wir geben hier einen Einblick in seine Doktorarbeit. Auf der Suche nach einer umfassenden Theorie der Quantengravitation verwenden PhysikerInnen gerne einfache aber umfassende Slogans, die in Formeln gegossen werden können deren Konsequenzen man dann prüfen kann. Ein erfolgreicher Slogan dieser Art ist das holographische Prinzip, das in den 1990ern von 't Hooft und Susskind postuliert worden ist und das eine konkrete Realisierung durch Maldacena in der sogenannten Anti-de Sitter/konformen Feldtheorie (AdS/CFT) Korrespondenz gefunden hat, die in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche neue Forschungsrichtungen eröffnet hat.
Max Riegler, Viktor-Hess-Preisträger
Dieses Bild zeigt ein besonders anschauliches Beispiel wie das holographische Prinzip Raumzeitgeometrie mit der Observablen einer Quantenfeldtheorie in Verbindung bringt. Die hier gezeigte Raumzeitgeometrie entspricht einer dreidimensionalen Anti-de Sitter-Raumzeit, welche eine Raumzeit mit konstant negativer Krümmung ist. Die dazu duale Quantenfeldtheorie ist eine konforme Feldtheorie, welche an einem bestimmten Zeitpunkt in zwei Teilsysteme, A und das dazugehörige Komplement B, aufgeteilt werden kann. Die für dieses Beispiel relevante Observable ist die Verschränkungsentropie zwischen den Teilsystemen A und B. Diese kann entweder mit speziellen Quantenfeldtheorietechniken, oder aber holographisch, mittels der Länge der in Orange dargestellten Geodäte (eine Kurve, welche die Länge zwischen zwei Punkten minimiert), berechnet werden. Beide Rechnungen liefern dasselbe Resultat und sind daher äquivalente Methoden, die Verschränkungsentropie zwischen den beiden Subsystemen A und B zu berechnen.
AdS beschreibt negativ gekrümmte Raumzeiten, und gemäß AdS/CFT ist Quantengravitation in z.B. 3 Dimensionen äquivalent zu seinem "Hologramm", einer (konformen) Quantenfeldtheorie in 2 Dimensionen. Wenn das holographische Prinzip tatsachlich in der Natur gilt, dann muss es aber jenseits von AdS/CFT gelten, da unser Universum auf mittleren Distanzen eher flach und auf großen Distanzen positiv gekrümmt ist. Max Rieglers Doktorarbeit "How general is holography?" beschäftigt sich mit der Frage, wie allgemein das holographische Prinzip umsetzbar ist und speziell, ob es auch in flachen Raumzeiten und in Theorien jenseits der Einsteingravitation, sogenannten 'Höhere Spin-Gravitationstheorien', gilt. Da obige Frage zu allgemein ist, um konkrete Fortschritte zu erzielen, vereinfacht Max die Situation durch Betrachtung von Theorien in 2+1 Raumzeitdimensionen. Die beiden Säulen seiner Dissertation sind Höhere Spin-Gravitationstheorien und Holographie in flachen Raumzeiten. Von den zahlreichen neuen Forschungsergebnissen, die in Max Rieglers Doktorarbeit enthalten sind sollen hier zwei hervorgehoben werden. In der Arbeit "Flat space limit of higher-spin Cardy formula", die Max als alleiniger Autor in Physical Review D 2015 veröffentlicht hat , leitet er zum ersten Mal den flachen Limes der sogenannten Cardy-Formel her, die die (Bekenstein-Hawking) Entropie Schwarzer Löcher mikroskopisch erklärt. In der Arbeit "Entanglement entropy in Galilean conformal field theories and flat holography" wird Verschränkungsentropie zum ersten Mal für sogenannte Galileische CFTs hergeleitet. Da man vermutet, dass diese Quantenfeldtheorien holographisch äquivalent zu 2+1 dimensionaler Einsteingravitation (ohne kosmologischer Konstante, also in flachen Raumzeiten) sind, erlaubt diese Berechnung eine Überprüfung dieser Vermutung, so ferne man Verschränkungsentropie auch holographisch (also auf der Gravitationsseite) bestimmen kann. Dies ist Max mit Hilfe von sogenannten Wilsonschleifen gelungen, und das Ergebnis stimmt präzise mit dem Feldtheorieergebnis überein. Diese Arbeit, die 2015 in Physical Review Letters erschienen ist, liefert somit eine neuartige Bestätigung des holographischen Prinzips jenseits von AdS/CFT. Abgesehen von den innovativen Forschungsergebnissen ist Max Rieglers Doktorarbeit mit viel Liebe zum Detail angefertigt, und die einführenden Kapitel, sowie die drei abschließenden Kapitel, sind auch für PhysikerInnen die (noch) nicht ExpertInnen in Holographie sind, lesenswert.
Max Riegler
max dot riegler at tuwien dot ac dot at
Die Ausnahme und ihre Regeln
Sogenannte "Ausnahmepunkte" sorgen für physikalische Effekte, die der Intuition zuwiderlaufen. Ein Team der TU Wien macht sich dies für die Entwicklung eines neuartigen Wellenleiters zunutze und präsentiert das Ergebnis im Fachjournal "Nature".
Ausnahmepunkte - Lösungen von Gleichungen in komplexen Räumen
Neue Impulse für die Wellenphysik: Wellen mit komplexen Frequenzen
Egal ob Schallwellen, quantenphysikalische Materiewellen oder Lichtwellen eines Lasers – Wellen können unterschiedliche Schwingungszustände annehmen, denen sich unterschiedliche Frequenzen zuordnen lassen. Diese Schwingungsfrequenzen auszurechnen gehören zum täglichen Handwerk in der theoretischen Physik. In letzter Zeit sorgen aber ganz spezielle Systeme für immer mehr Aufmerksamkeit, bei denen manche gewohnte Regel über Bord geworfen werden muss.
Wenn die Wellen Energie abgeben oder aufnehmen können, stößt man auf sogenannte "Ausnahmepunkte" (man spricht in der Physik von "exceptional points"), in deren Umgebung die Wellen merkwürdiges Verhalten zeigen: Laser schalten sich ein, obwohl man ihnen eigentlich Energie wegnimmt, Licht leuchtet nur noch in ganz bestimmte Richtungen, und Wellen, die zunächst in ein wildes Durcheinander geraten, treten daraus in einem bestimmten Zustand wieder geordnet hervor.
Einem Forschungsteam der TU Wien gelang es nun mit Unterstützung von Kollegen aus Brasilien, Frankreich und Israel, einen solchen "Ausnahmepunkt" im Experiment zu umrunden – mit bemerkenswerten Ergebnissen, die nun im Fachjournal "Nature" publiziert wurden.
Wellen mit komplexen Frequenzen
"Die Schwingungsfrequenzen von Wellen in einem bestimmten System hängen normalerweise von mehreren verschiedenen Parametern ab", erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Die charakteristischen Frequenzen von Mikrowellen in einem Metallbehälter werden etwa von der Größe und Form des Behälters bestimmt. Man kann diese Parameter gezielt verändern und somit auch die Frequenz bestimmter Wellenzustände kontinuierlich verschieben.
"Viel komplizierter wird die Situation allerdings bei Systemen, die Energie aufnehmen oder abgeben", sagt Rotter. "So ähnlich wie man in der Mathematik ein komplexes Ergebnis erhält, wenn man die Wurzel aus negativen Zahlen zieht, ergeben unsere Gleichungen dann für die Wellen komplexe Frequenzen." Auf den ersten Blick mag das wie eine bloße mathematische Spielerei aussehen, doch in den letzten Jahren zeigte sich, dass diese "komplexen Frequenzen" tatsächlich eine wichtige physikalische Bedeutung haben.
Mikrowellen in der Metallbox
Am deutlichsten treten die Besonderheiten von komplexen Frequenzen zutage wenn man ein System zu einem sogenannten "Ausnahmepunkt" hinsteuert. "Ausnahmepunkte treten in Wellen-Systemen auf, deren Form und Absorption so abgestimmt werden können, dass zwei verschiedene Wellen sich bei einer bestimmten komplexen Frequenz treffen", erklärt Rotter. "Am Ausnahmepunkt haben die beiden unterschiedliche Schwingungszustände nicht nur dieselbe Resonanzfrequenz und dieselbe Energieverlustrate sondern auch dieselbe räumliche Struktur. Man kann also davon sprechen, dass am Ausnahmepunkt zwei Wellenzustände zu einem einzelnen verschmelzen."
Wenn ein System solche Ausnahmepunkte erlaubt, lassen sich merkwürdige Effekte beobachten: "In unserer Arbeit senden wir zwei Wellenmoden in einen Mikrowellenleiter, der so strukturiert ist, dass die Wellen im Inneren des Wellenleiters einen Ausnahmepunkt nicht nur ansteuern, sondern umrunden", erklärt Jörg Doppler, der Erstautor der Studie. Egal welche der beiden Wellenmoden man in das System einkoppelt, kommt am Ende immer dieselbe Mode heraus. Koppelt man aus der Gegenrichtung ein, wird die jeweils andere Mode bevorzugt. "Das ist als ob man mit einem Auto in einen zweispurigen Tunnel einfährt, im Inneren des Tunnels wie auf Glatteis herumschlittert, aber am Ende garantiert immer auf der richtigen Straßenseite ankommt", meint Doppler.
Um die theoretischen Modelle zu testen, die er mit seiner Forschungsgruppe dazu entwickelt, wandte sich Stefan Rotter an französische Kollegen, die mit Mikrowellenstrukturen arbeiten – hohle Metallbehälter, durch die man elektromagnetische Strahlung schickt, um das Verhalten der Wellen zu studieren. An der TU Wien wurde berechnet, welche spezielle Form ein Wellenleiter haben muss, um die merkwürdigen Ausnahmepunkt-Eigenschaften zu zeigen. In der Gruppe von Ulrich Kuhl an der Universität in Nizza wurden dann die Experimente durchgeführt und das vorhergesagte Verhalten tatsächlich beobachtet.
Neue Impulse für die Wellenphysik
Systeme mit Ausnahmepunkten bringen eine ganz neue Klasse von Möglichkeiten mit sich, Wellen unterschiedlichster Art zu kontrollieren. "So ähnlich wie die komplexen Zahlen zusätzliche Kapitel für die Mathematik aufschlagen, eröffnen die komplexen Ausnahmepunkte ganz neue Perspektiven für die Physik der Wellen", meint Rotter. Tatsächlich arbeiten mittlerweile bereits mehrere Forschungsgruppen an Ausnahmepunkten: In derselben Ausgabe von Nature in der die Arbeit der Wiener Gruppe erscheint, berichtet etwa ein Team von der Universität Yale (USA), dass Ausnahmepunkte auch in der Optomechanik auftreten und dort zu ganz neuartigen Effekten führen können. "Von Ausnahmepunkten wird man in Zukunft in mehreren Gebieten der Physik sicherlich noch oft hören", ist sich Stefan Rotter sicher.
Jörg Doppler, Alexei A. Mailybaev, Julian Böhm, Ulrich Kuhl, Adrian Girschik, Florian Libisch, Thomas J. Milburn, Peter Rabl, Nimrod Moiseyev, Stefan Rotter (2016). "Dynamically encircling an exceptional point for asymmetric mode switching". Nature: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature18605.html
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien
Zwanzig neue Doktoratsstellen werden geschaffen – es geht um zukunftsweisende Fragen rund um neuartige Materialien.
"Biointerface" wird geleitet von Miriam Unterlass, Gerhard Kahl (beide oben) und Gerhard Schütz (unten links), Florian Libisch (unten rechts) ist Leiter von "TU-D".
Die TU Wien schafft zusätzliche Chancen für junge WissenschaftlerInnen und startet zwei neue Doktoratskollegs: Um Verbindungen zwischen anorganischen und biologischen Systemen geht es im Kolleg „BioInterface“, im Kolleg „TU-D - Unravelling advanced 2D Materials“ beschäftigt man sich mit neuen Materialien, die wie das Kohlenstoff-Material Graphen nur aus einer ultradünnen Schicht bestehen.
Ausgewählt wurden diese beiden Kollegs vom Rektorat der TU Wien in einem internen Ausschreibungsverfahren. Beide sind ausgesprochen interdisziplinär angelegt: Im Kolleg „BioInterface“ arbeiten Forschungsteams aus vier Fakultäten zusammen (Physik, Chemie, Maschinenbau und Bauingenieurwesen), im Kolleg „TU-D“ sind es sogar fünf (Physik, Chemie, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen und Mathematik). In beiden Kollegs werden jeweils zehn Dissertationsstellen ausgeschrieben – zumindest die Hälfte davon wird mit Frauen besetzt werden.
Organisch und Anorganisch
„Bei uns geht es darum, funktionelle Schnittstellen zwischen anorganischen und bio-organischen Systemen zu untersuchen“, sagt Gerhard Kahl, der das Doktoratskolleg „BioInterface“ gemeinsam mit Miriam Unterlass und Gerhard Schütz leitet. „Wir wollen die Materialien besser verstehen und sie technologisch anwendbar machen.“
Dazu sollen ganz unterschiedliche Ansätze kombiniert werden: Mit Computersimulationen wird man erklären, wie bestimmte Moleküle ganz von selbst gewünschte Strukturen bilden können, man wird an Anwendungen aus der Zellbiologie arbeiten und spezielle Synthese- und Strukturierungsmethoden für neuartige Materialen entwickeln.
Darf’s auch eine Dimension weniger sein?
Unter „niedrigdimensionalen Materialien“ versteht man Strukturen wie das Kohlenstoff-Material Graphen, das bloß aus einer einzigen Schicht von Atomen besteht – in diesem Sinn ist es bloß zweidimensional, seine Ausdehnung in der dritten Dimension ist minimal. Mittlerweile wird mit unterschiedlichen 2D-Materialien gearbeitet, im Doktoratskolleg „TU-D“, geleitet von Florian Libisch, wird man sie untersuchen und weiterentwickeln.
„Zu diesem Thema gibt es sehr viel Expertise an der TU Wien“, sagt Florian Libisch. „So ist es uns gelungen, die vier großen Schlüsselbereiche der Nanotechnologie in einem Kolleg zu vereinen: Synthese und Materialdesign, Experiment und Charakterisierung, Theorie und Modellbildung, und nicht zuletzt die Entwicklung von Prototypen und Anwendungsideen.“
Die neuen Doktoratsstellen werden in den nächsten Monaten ausgeschrieben.
Kontakt:
Gerhard Kahl: gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Florian Libisch: florian.libisch@tuwien.ac.at
Der Quanten-Strom im Graphen
Wenn der Strom in Portionen fließt: Berechnungen der TU Wien liefern Erkenntnisse über die Quanten-Eigenschaften des Kohlenstoff-Materials Graphen.
Florian Libisch
Eine Elektronenwelle im Graphen
Eine Elektronenwelle im Graphen
Dass Graphen ganz bemerkenswerte Eigenschaften hat, ist bekannt. Bereits 2010 wurde der Nobelpreis für die Entdeckung dieses ganz besonderen Materials vergeben, das aus einer Schicht wabenförmig angeordneter Kohlenstoffatome besteht. Doch je weiter die Graphen-Forschung fortschreitet, umso mehr bemerkenswerte Effekte kann man dem Material entlocken. Nun gelang es einem internationalen Forschungsteam mit Beteiligung der TU Wien, das Verhalten der Elektronen zu erklären, die sich durch enge Stellen in einer Graphen-Schicht bewegen. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.
Das Elektron ist eine Welle
„Wenn Strom durch Graphen fließt, dann sollte man sich die Elektronen nicht vorstellen wie kleine Kugeln, die durch das Material rollen“, sagt Florian Libisch vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien, der den theoretischen Teil des Projektes leitete. Die Elektronen schwappen als langgestreckte Wellenfront durch das Material, die Wellenlänge des Elektrons kann hundertfach größer sein als der Abstand zwischen den Kohlenstoffatomen. „Das Elektron sitzt nicht auf einem bestimmten Kohlenstoffatom, es befindet sich gewissermaßen überall gleichzeitig“, erklärt Libisch.
Untersucht wurde das Verhalten der Elektronen, die sie sich durch Engstellen im Graphen hindurchzwängen müssen. „Je schmäler diese Verengung wird, umso weniger Strom fließt hindurch“, sagt Florian Libisch. „Allerdings zeigt sich, dass der Zusammenhang zwischen dem Stromfluss, dem Durchmesser der Engstelle und der Energie der Elektronen ziemlich kompliziert ist. An bestimmten Stellen weist er charakteristische Sprünge auf, das ist ein klarer Hinweis auf Quanteneffekte.“
Ist die Wellenlänge des Elektrons so groß, dass sie nicht durch die Engstelle hindurchpasst, ist der Stromfluss sehr gering. „Wenn man die Energie des Elektrons erhöht, dann wird seine Wellenlänge kleiner“, erklärt Libisch. „Irgendwann passt dann eine Wellenlänge durch die Engstelle, dann zwei, dann drei – dadurch erhöht sich auch der Stromfluss in charakteristischen Stufen.“ Der Stromfluss wächst nicht kontinuierlich, er ist quantisiert.
Theorie und Experiment
Dieser Effekt lässt sich auch in anderen Materialien beobachten – ihn in Graphen aufzuspüren war aber bedeutend schwieriger, weil es durch die ungewöhnlichen elektronischen Eigenschaften des Materials zu verschiedenen zusätzlichen Effekten kommt. Die Experimente wurden an der RWTH Aachen in der Gruppe von Prof. Christoph Stampfer durchgeführt, theoretische Rechnungen und Computersimulationen in Wien von Larisa Chizhova und Florian Libisch in der Gruppe von Prof. Joachim Burgdörfer. Beides ist äußerst herausfordernd: Für die Experimente musste man die Graphen-Stücke nanometergenau in Form bringen, stabilisiert wurden sie, indem man das Graphen zwischen Atomlagen von hexagonalem Bornitrid einschloss.
Ähnlich herausfordernd ist es, die Experimente am Computer zu simulieren. „Ein frei bewegliches Elektron in der Graphen-Schicht kann so viele verschiedene Quantenzustände annehmen, wie es dort Kohlenstoffatome gibt“, sagt Florian Libisch. „In unserem Fall sind das über zehn Millionen.“ Das macht die Rechnungen extrem aufwändig – will man etwa ein Elektron in einem Wasserstoffatom beschreiben, kommt man mit einigen wenigen Quantenzuständen gut aus. Das Team vom Institut für Theoretische Physik entwickelte daher Computercodes, die am Hochleistungsrechner VSC3 an der TU Wien auf hunderten Prozessoren gleichzeitig laufen.
Randzustände
Eine wichtige Rolle für das Verhalten von Graphen spielt der Randbereich des Materials: „Nachdem die Atome in einer sechseckigen Wabenform angeordnet sind, ist der Rand niemals eine völlig gerade Linie, er ist auf atomarer Skala betrachtet immer gezackt“, sagt Florian Libisch. Die Elektronen können dort spezielle Randzustände einnehmen, die einen wichtigen Einfluss auf die elektronischen Eigenschaften des Materials haben. „Nur mit Computersimulationen auf extrem großer Skala auf den größten heute verfügbaren Computerclustern können wir die experimentell hergestellten Graphenstrukturen detailliert simulieren, und diesen Randzuständen auf die Spur kommen“, sagt Libisch. „Wie die augezeichnete Übereinstimmung von Rechnung und Experiment zeigt, ist uns das gut gelungen.“
Die Entdeckung von Graphen öffnete die Tür zur Erforschung ganz unterschiedlicher ultradünner Materialien, die nur aus einzelnen Atomlagen bestehen. Speziell die Kombination dieser Schichten, zum Beispiel wie hier Graphen mit hexagonalem Bornitrid – verspricht in Zukunft spannende Erkenntnisse und neue Anwendungen im Bereich der Nanoelektronik. „Bedenkt man, dass die Größe der Transistoren in der heutigen Elektronik schon im zwanzig-Nanometer Bereich liegt, wird man für die Elektronik von morgen auf jeden Fall viel über Quantenphysik wissen müssen“, ist Libisch sicher.
Originalpublikation:
/ “Size quantization of Dirac fermions in graphene constrictions”, nature Communications, DOI: 10.1038/NCOMMS11528
Rückfragehinweis:
Dr. Florian Libisch
florian.libisch@tuwien.ac.at
Goldenes Diplom und Kategoriesieg für TU Chor
Der Chor der TU Wien wurde beim 13. Internationalen Chorwettbewerb und Festival Bad Ischl mit einem goldenen Diplom Kategoriesieger.
Der Chor der TU Wien unter der Leitung von Andreas Ipp wurde beim 13. Internationalen Chorwettbewerb und Festival Bad Ischl mit einem goldenen Diplom ausgezeichnet. Der Chor wurde in der Kategorie "Pop - Jazz - Gospel - Spiritual" Kategoriesieger und durfte sich in einer weiteren Runde mit sechs anderen Chören aus verschiedenen Kategorien um den Großpreis messen.
24 Chöre aus 14 Nationen traten von 30. April bis 4. Mai 2016 beim renommierten Internationalen Chorwettbewerb & Festival in Bad Ischl in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Der TU Chor unter der Leitung von Andreas Ipp sang sich in der Kategorie "Pop - Jazz - Gospel - Spiritual" an die Spitze. Den zweiten Platz in dieser Kategorie erlangten die Vokalsolisten Kärnten und der dritte Platz ging an den Gøtu Kirkju Ungdómskór von den Färöer-Inseln.
Als Kategoriesieger schaffte es der TU Chor in die zweite Runde, in der sieben Chöre um den Großpreis sangen, darunter Chöre aus Estland, Lettland, Schweden, Slowenien und Japan. Gewonnen hat den Großpreis der Seisen High School Choir aus Japan.
Neben dem Wettbewerb nahm der TU Chor noch am umfangreichen Rahmenprogramm teil und gestaltete die Eröffnung des Wettbewerbs beim Galakonzert mit. Neben einem Freundschaftskonzert in der Trinkhalle von Bad Ischl holte sich der Chor außerdem von einer internationalen Jury in einem Beratungskonzert Choreografie-Tipps für zukünftige Auftritte.
Die Stücke, die der TU Chor beim Wettbewerb vorgetragen hat, werden übrigens auch beim Frühlingskonzert des TU Chors am 19. und 20. Mai 2016 zu hören sein.
Mehr über den TU-Chor gibt's unter:
http://chor.tuwien.ac.at/mitsingen/
Bunt ist alle Theorie
Prof. Joachim Burgdörfer, der neue Dekan der Fakultät für Physik, im Portrait
Prof. Joachim Burgdörfer
„Manche Leute sagen, die Quantenphysik ist widersinnig und verstößt gegen die Intuition“, sagt Prof. Joachim Burgdörfer. „Das habe ich nie so gesehen. Im Gegenteil: Es fällt mir schwer, mir eine Welt vorzustellen, die keinen quantenmechanischen Regeln gehorcht.“ In der Welt der Quanten hat der theoretische Physiker Joachim Burgdörfer viel Erfahrung. Mit Papier und Bleistift, aber oft auch mit großen Computersimulationen geht er mit seiner Forschungsgruppe ganz unterschiedlichen Phänomenen auf den Grund, die oft in unvorstellbar kurzen Zeiträumen ablaufen. Wichtig war ihm dabei immer die enge Verbindung von Theorie und Experiment. Auch in seiner neuen Funktion als Dekan der Fakultät für Physik wird es wichtig sein, theoretische und experimentelle Forschung gleichermaßen zu fördern.
Aufgewachsen ist Burgdörfer im Süden Deutschlands, im Schwarzwald. Für Naturwissenschaft interessierte er sich schon früh, trotzdem war für ihn in seiner Jugend keineswegs klar, dass er sich der Physik zuwenden würde. „Geschichte, Politik, Wissenschaft – mich hat immer schon vieles interessiert“, sagt er. Dass die Wahl dann schließlich auf ein Physikstudium an der Freien Universität Berlin fiel, hat er aber nie bereut.
Klar war für Burgdörfer dann aber bald, dass er die theoretische Physik spannender fand als das Experimentieren: „Ich hatte immer zwei linke Hände. Ein gewisser Minimalabstand zum Experiment war für mich gut.“ Allerdings will er sich nicht damit begnügen, intellektuell fordernde Rechenbeispiele zu lösen, die bloß von theoretischem Interesse sind. Er entwickelt Theorien, mit denen man aktuelle Experimente erklären kann, er berechnet Daten, die man mit Messergebnissen direkt vergleichen kann. „Das rein theoretische Nachdenken über die fundamentalen Gesetze der Physik hat natürlich einen großen Intellektuellen Reiz. Aber wenn man nicht gerade Einstein oder vielleicht Feynman heißt, dann ist man gut beraten, als Theoretiker für die Experimentalisten da zu sein und Ergebnisse zu liefern, die allen wirklich weiterhelfen.“
In seiner Dissertation an der Freien Universität Berlin verknüpfte Joachim Burgdörfer Festkörperphysik mit Atomphysik, in diesem Bereich arbeitet er bis heute. Kollisionen von Teilchen und Festkörpern, von Laserstrahlen und Materie, Elektronenanregungen in Atomen – viele wichtige quantenphysikalische Prozesse laufen auf äußerst kurzen Zeitskalen ab. Mit seinem Team versucht Burgdörfer, solche Phänomene zu berechnen und zu verstehen, manchmal auch durch die Entwicklung neuer Rechenmethoden. Unverzichtbar ist dabei heute der Einsatz von Großrechnern wie dem VSC3 an der TU Wien.
Prägende Jahre in den USA
Bereits als Dissertant in Berlin erhielt Joachim Burgdörfer eine Einladung zu einem Gastaufenthalt in die USA. 1982 ging er dann als Postdoc ans National Lab in Oak Ridge, Tennessee. Zwei Jahre später wechselte er auf eine Assistenzprofessur an der University of Tennessee, 1988 wurde er dort Full Professor. Fünfzehn Jahre verbrachte er mit seiner Frau, die aus Berlin mit ihm in die USA gewechselt war, in den USA. Wissenschaftlich war das für ihn eine prägende Zeit, dennoch entschloss er sich 1997 nach Europa zurückzukehren und nahm eine Professur an der TU Wien an. Trotz mehrerer Rufe ins Ausland, unter anderem an das Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, blieb der der TU Wien bis heute treu.
„Der Wissenschaftsbetrieb hat auf beiden Seiten des Atlantiks Vor- und Nachteile“, sagt Burgdörfer. „Was ich hier in Wien ganz besonders schätze, ist die hohe Qualität der Studierenden. Man findet hier viele höchst begabte Leute, die bei uns Diplomarbeiten oder Dissertationen schreiben, und das ist für die Forschung äußerst wichtig.“ In den USA hatte er manchmal den Eindruck, dass besonders talentierte Leute sehr oft finanziell lukrativere Richtungen wie Medizin, Wirtschaft oder Rechtswissenschaften einschlagen. „In Europa gibt es vielleicht noch mehr idealistisch gesinnte junge Leute, denen es in erster Linie darum geht, zu verstehen wie die Welt funktioniert.“
An der TU Wien arbeitete er unter anderem intensiv mit Prof. Ferenc Krausz zusammen, der am Institut für Photonik an ultrakurzen Laserpulsen forschte. Die Attosekundenphysik, die Wissenschaft der Quantendynamik extrem kurzer Zeitskalen, ist nach wie vor eines von Burgdörfers Hauptthemen. Sein Team kooperiert auf diesem Gebiet nicht nur mit dem Institut für Photonik der TU Wien sondern auch mit vielen anderen führenden Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt.
Forscher und Dekan gleichzeitig
Auch wenn sein neues Amt als Dekan viel Arbeit mit sich bringt, möchte Joachim Burgdörfer auf jeden Fall weiterhin Zeit in die Forschung investieren. Er pendelt daher nun täglich zwischen dem Dekanatsbüro im fünften Stock und dem Institut für Theoretische Physik im zehnten Stock des Freihauses. Die Fakultät für Physik ist derzeit gut aufgestellt: „Mein Vorgänger Gerald Badurek hat viel geleistet und die Fakultät zwölf Jahre lang stark geprägt“, sagt Burgdörfer. „Es war eine sehr erfolgreiche Phase der Expansion. Das wird sich in dieser Form nicht fortsetzen lassen. Ich erwarte mir nun eine Phase der Konsolidierung, in der die weitere qualitative Verbesserung im Vordergrund stehen wird.“
Physik-Konferenz in Wien: Statistik zwischen Ost und West
Bei derMECO41 präsentiert sich die Statistische Physik in ihrer großen thematischen Breite und verbindet ost- und westeuropäische Staaten.
Computersimulation (basierend auf Konzepten der Statistischen Physik) eines Systems komplexer kolloidaler Teilchen.
Eine 1974 in Wien begonnene Konferenzserie kehrt nächste Woche ein weiteres Mal nach Wien zurück. Zentrales Thema dieser Tagung, die von Wissenschaftlern der Universität Wien, der TU Wien und der Medizinischen Universität Wien gemeinsam organisiert wird, ist die Statistische Physik in all ihren Facetten: dazu gehören sehr grundlegende, mathematische Fragestellungen, Probleme der Weichen Materie, aber auch die Beschreibung biologischer Systeme oder die Dynamik von Finanzmärkten.
1974 wurde die Idee geboren, die wissenschaftlichen Kontakte im Bereich der Statistischen Physik zwischen Gruppen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges durch ein gemeinsames Seminar zu intensivieren; auch wenn dieses Treffen, das damals an der Universität Wien stattfand, noch nicht den Namen MECO („Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics“) trug, so war es doch die Geburtsstunde einer überaus erfolgreichen Konferenzserie, die lediglich 1992/1993 als Folge des Kriegs in Jugoslawien kurz unterbrochen war. Die Treffen fanden dann auch tatsächlich abwechselnd diesseits und jenseits des Eisernen Vorhanges statt und haben zweifelsohne zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen teilnehmenden Gruppen geführt.
Die politischen Veränderungen am Ende der 1980-er Jahre haben zur Internationalisierung der Konferenzserie beigetragen: die 170 Teilnehmer der diesjährigen MECO41, die gemeinsam von Christoph Dellago und Marcello Sega (Universität Wien), Gerhard Kahl (TU Wien) und Stefan Thurner (Medizinische Universität Wien) organisiert wird, kommen aus 26 Nationen, darunter Länder wie China, Israel, Mexiko oder Japan.
Auch thematisch hat die Serie der MECO-Konferenzen einen großen Wandel durchlebt, der stets modernen Entwicklungen der Statistischen Physik Rechnung getragen hat. Standen bei 1974 bei der ersten Konferenz noch strukturelle Phasenübergänge thematisch im Vordergrund, so ist heuer in Wien die Weiche Materie das zentrale Wissenschaftsgebiet. „Trotz all dieser Veränderungen waren die Organisatoren der MECO Konferenzen stets bestrebt, auch ‚exotischen‘ Problemkreisen der Statistischen Mechanik genügend Platz einzuräumen“, berichtet Gerhard Kahl; dazu gehören heuer etwa Beiträge über die Dynamik von Finanzmärkten oder die Erforschung von Grundmustern in Konferenzteilnahmen.
Vom 14. bis zum 17.2.2016 werden all diese Aspekte der Statistischen Physik in Räumlichkeiten der Universität Wien intensiv diskutiert.
http://meco41.univie.ac.at/
Monstergruppen berechnen den Mondschein
Timm Wrase will, dass das Verständnis des Universums in einer einzigen physikalischen Theorie aufgeht. Bisher gibt es zwei konträre Ansätze. Die mögliche Lösung: Stringkompaktifizierung und Mondschein.
Finden Sie den vollständigen Presse-Artikel unter:
http://diepresse.com/home/science/4885731/Monstergruppen-berechnen-den-Mondschein?_vl_backlink=/home/science/index.do
Das Schalter-Molekül
Ein neuartiger Schalter auf Nanometer-Skala wurde von einem internationalen Forschungsteam vorgestellt. Mit einem einzigen Elektron kann man den Zustand des Schalters gezielt verändern.
Ein einzelnes organisches Molekül - mit einem Molybdän-Atom im Zentrum zwischen zwei Gold Elektroden - dient als Schalter.
Ohne Transistoren läuft in der Elektronik gar nichts. Sie sind die fundamentalen Bauteile, auf denen die logischen Schaltungen in unseren Computerchips beruhen. Normalerweise bestehen sie aus Siliziumkristallen, dotiert mit anderen Atomsorten. Einem österreichisch-schweizerischen Forschungsteam (TU Wien, Universität Wien, Universität Zürich, IBM Zürich) gelang es nun, einen Transistor zu entwickeln, der auf grundlegend andere Weise funktioniert und nur aus einem einzigen Molekül besteht. Statt drei Elektroden, wie bei einem gewöhnlichen Transistor, benötigt dieses Schalter-Molekül bloß zwei Elektroden. Der neue Nano-Schalter wurde nun im Fachjournal „Nature Nanotechnology“ präsentiert.
Null oder eins
„Das Entscheidende an einem Transistor ist, dass er zwei verschiedene Zustände annehmen kann“, erklärt Robert Stadler vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien (bei Projektbeginn war er noch am Department für physikalische Chemie der Universität Wien tätig). Je nachdem, in welchem Zustand sich der Transistor befindet, lässt er Strom fließen oder nicht. Ein gewöhnlicher Transistor aus Silizium-Kristallen hat daher drei Kontakte: Von einem kommt der Strom, in den zweiten kann er abfließen – und ob das tatsächlich geschieht, hängt von der Spannung ab, die am dritten Kontakt, dem sogenannten Gate-Kontakt, angelegt wird.
Um immer mehr Transistoren auf immer geringerer Fläche unterzubringen, wurden die Transistoren in den letzten Jahrzehnten immer kleiner. Das hat die Leistungsfähigkeit der Elektronik drastisch verbessert, bringt aber auch immer größere technische Probleme mit sich: Mit gewöhnlicher Siliziumtechnologie stößt man dabei an physikalische Grenzen. „Bei extrem kleinen Kristallen hat man keine ausreichende Kontrolle mehr über die elektronischen Eigenschaften, vor allem wenn nur noch wenige Dotieratome vorhanden sind und die Trennschicht zum Gate immer undichter wird“, erklärt Stadler. „Wenn man auf der Nano-Skala allerdings von Kristallen auf organische Moleküle umsteigt, dann hat man neuartige Möglichkeiten, die Transporteigenschaften zu verändern.“
Ein Molekül wird zum Transistor
An der Universität Zürich synthetisierten Chemiker daher organometallische Molekülstrukturen, die mit einzelnen Metallatomen aus Eisen, Ruthenium oder Molybdän ausgestattet wurden. Nur etwa zweieinhalb Nanometer lang sind diese Designermoleküle, die am IBM Forschunglabor in Rüschlikon dann vorsichtig mit zwei Goldkontakten kontaktiert werden, bevor man eine elektrische Spannung an sie anlegen kann.
Bei einer der getesteten Molekülsorten, in deren Mitte ein Molybdän-Atom platziert ist, stellte man ganz bemerkenswerte Eigenschaften fest: Wie ein Silizium-Transistor lässt sich dieses Molekül zwischen zwei verschiedenen Zuständen hin und her schalten, die sich hinsichtlich ihrer Leitfähigkeit um drei Größenordnungen unterscheiden. Um den zugrundeliegenden Prozess zu verstehen, bedurfte es aufwändiger Computersimulationen am Vienna Scientific Cluster (VSC), die von Robert Stadler und seinem Dissertanten Georg Kastlunger in Wien durchgeführt wurden. Dadurch konnte der Mechanismus auf quantenphysikalischer Ebene entschlüsselt werden.
„Direkt am Molybdän-Atom gibt es einen bestimmten Platz, den ein Elektron besetzen kann“, sagt Robert Stadler. „Wieviel Strom bei einer bestimmten Spannung durch das Molekül fließt, hängt davon ab, ob an diesem Platz tatsächlich ein Elektron sitzt oder nicht.“ Und genau das lässt sich steuern. Wenn der Platz besetzt ist, fließt bei kleiner angelegter Spannung relativ wenig Strom. Bei einer höheren Spannung allerdings kann das Elektron von seinem speziellen Platz beim Molybdän-Atom entfernt werden. Dadurch schaltet das System in einen neuen Zustand mit rund tausendmal besserer Leitfähigkeit, der Stromfluss steigt sprungartig an. Sowohl Umschalt- als auch Ausleseprozess lassen sich somit über die beiden Gold-Kontakte, zwischen denen das Molekül fixiert ist, realisieren. Eine dritte Elektrode, wie sie ein gewöhnlicher Transistor braucht, ist nicht mehr notwendig was die Verdrahtung massiv vereinfacht.
Technik für die Chips von übermorgen
Noch ist die verwendete Technologie allerdings zu aufwändig, um sie in Massenproduktion für kommerzielle Computerchips einzusetzen. Die Experimente fanden deshalb bei tiefen Temperaturen und im Ultrahochvakuum statt. Allerdings arbeitet man bei IBM bereits an Konzepten um mehrere solche Moleküle in Nanoporen auf einem Silizium-Chip aufzubringen, sodass diese unter gewöhnlichen Umgebungsbedingungen, bei Raumtemperatur, funktionieren. „Das wäre einfacher – und auch für solche Systeme wären unsere theoretischen Methoden zweifellos geeignet“, ist Stadler zuversichtlich. „Vielleicht sind organische Moleküle mit eingebauten Metallatomen der Weg zu ultrakleinen Schaltern für neue Speicher – das Potenzial für spannende Anwendungen ist jedenfalls da, vor allem weil durch Wegfall der dritten Elektrode unerreichte Integrationsdichten möglich werden.“
Die Gruppe von Robert Stadler wird zur Gänze über Fellowships des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF finanziert. Georg Kastlunger erhielt ein einjähriges Stipendium, welches zu gleichen Teilen von GÖCH, ÖAW und Springer Verlag gestiftet wurde. Die Schweizer Projektpartner wurden vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert.
Artikel im Standard: http://derstandard.at/2000025820453/Molekularer-Transistor-entwickelt-der-mit-nur-einem-Elektron-schaltet
Rückfragehinweis:
Dr. Robert Stadler
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13651
robert.stadler@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Ein Teilchen aus reiner Kernkraft
Berechnungen der TU Wien legen nahe, dass es sich bei dem Meson f0(1710) um ein ganz besonderes Teilchen handelt - um den lange gesuchten „Glueball“, ein Teilchen aus reiner Kraft.
Kernteilchen (links) bestehen aus Quarks (Materieteilchen) und Gluonen (Kraftteilchen). Ein Glueball (rechts) hingegen besteht aus reinen Gluonen.
Seit Jahrzehnten sucht man nach sogenannten „Gluebällen“, nun könnten sie gefunden sein. Ein Glueball ist ein exotisches Teilchen, das ganz aus Gluonen besteht – aus den „Klebeteilchen“, von denen unsere Kernteilchen zusammengehalten werden. Weil Gluebälle extrem instabil sind, kann man sie nur indirekt über ihre Zerfallsprozesse nachweisen, über die aber wenig bekannt ist.
Prof. Anton Rebhan und Frederic Brünner von der TU Wien konnten nun allerdings durch einen neuen theoretischen Zugangs den Zerfall von Gluebällen berechnen. Ihre Ergebnisse passen sehr gut zu Daten, die man in Teilchenbeschleuniger-Experimenten gemessen hat. Somit deutet nun vieles darauf hin, dass es sich bei der bereits beobachteten Resonanz f0(1710) um den lange gesuchten Glueball handelt. Weitere Experimente werden in den nächsten Monaten erwartet.
Auch Kräfte sind Teilchen
Protonen und Neutronen bestehen aus noch kleineren Elementarteilchen, den Quarks. Diese Quarks werden von der starken Kernkraft zusammengehalten. „In der Elementarteilchenphysik wird jede Kraft durch ein bestimmtes Kraftteilchen vermittelt, und das Kraftteilchen der starken Kernkraft ist das sogenannte Gluon“, erklärt Prof. Anton Rebhan vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Man kann Gluonen als kompliziertere Version der Photonen betrachten. Die masselosen Photonen (Lichtteilchen) vermitteln die Kräfte des Elektromagnetismus, acht verschiedene Gluonen vermitteln die starken Kernkräfte. Allerdings gibt es zwischen Photonen und Gluonen einen ganz entscheidenden Unterschied: Gluonen spüren die von ihnen übertragene Kraft auch selbst, Photonen nicht. Daher gibt es keine Bindungszustände aus reinem Licht. Teilchen, die nur aus Gluonen zusammengesetzt sind, die also aus reiner Kernkraft bestehen, sind hingegen prinzipiell möglich.
Schon 1972, kurz nachdem die Theorie der Quarks und Gluonen entwickelt wurde, spekulierten die Physiker Murray Gell-Mann und Harald Fritzsch, dass es einen solchen Bindungszustand aus reinen Gluonen geben könnte (ursprünglich etwas vornehmer „Gluonium“ genannt). Bei Teilchenbeschleuniger-Experimenten fand man mehrere Teilchen, die als Kandidaten für Gluebälle gelten, doch Einigkeit darüber, ob eines der gemessenen Signale tatsächlich der gesuchte Glueball ist, gab es nie. Es könnte sich auch um gewöhnliche Bindungszustände aus Quarks und deren Antiteilchen handeln. Für einen direkten Nachweis sind Gluebälle jedenfalls zu kurzlebig. Wenn es sie gibt, muss man sie anhand ihrer Zerfallsprodukte identifizieren.
Kandidat f0(1710) zerfällt in seltsame Quarks
„Leider sind die Zerfallsmuster der Gluebälle nicht rigoros berechenbar“, sagt Anton Rebhan. Vereinfachte Modellrechnungen haben aber ergeben, dass es zwei realistische Kandidaten für Gluebälle gibt: Mesonen mit den Bezeichnungen f0(1500) und f0(1710). Ersteres wurde lange Zeit für den wahrscheinlichsten Glueball-Kandidaten gehalten. Das zweite würde mit seiner höheren Masse zwar besser zu Computersimulationen passen, doch bei seinem Zerfall entstehen bevorzugt schwere Quarks (die sogenannten „strange Quarks“), und das erschien der Mehrheit der Teilchenphysik-Community unplausibel, weil Gluonen bei ihren Wechselwirkungen normalerweise keinen Unterschied zwischen schweren und leichten Quarks machen.
Anton Rebhan und sein Doktorand Frederic Brünner sind der Lösung dieses Rätsels nun aber mit einem neuen Zugang einen großen Schritt nähergekommen. Es gibt nämlich fundamentale Zusammenhänge zwischen Quantentheorien, die teilchenphysikalische Phänomene in unserer dreidimensionalen Welt beschreiben, und bestimmten Gravitationstheorien, die höherdimensionale Räume beschreiben. Dadurch kann man Fragen aus der Teilchenphysik mit Methoden aus der Gravitationstheorie beantworten.
„Aus unseren Rechnungen ergab sich, dass Gluebälle tatsächlich bevorzugt in schwere Quarks zerfallen können“, sagt Anton Rebhan. Das berechnete Zerfallsmuster in zwei leichtere Teilchen konnte erstaunlicherweise das Zerfallsmuster von f0(1710) mit hoher Genauigkeit reproduzieren. Gleichzeitig sind auch kompliziertere Zerfälle der Gluebälle in mehr als zwei Teilchen möglich, auch diese Zerfallsraten konnten mit dem neuen Ansatz berechnet werden.
Weitere Messdaten bald erwartet
Für diese zusätzlichen Zerfallsraten gibt es bisher noch keine Messungen, doch bereits in den nächsten Monaten könnten zwei spezielle Experimente am Large Hadron Collider des CERN (TOTEM und LHCb) sowie ein Beschleunigerexperiment in Beijing (BESIII) neue Daten dazu liefern. „Diese Tests werden die Nagelprobe für unsere Theorie sein“, glaubt Anton Rebhan. „Unsere Rechnung liefert für diese Zerfälle ganz andere Vorhersagen als konkurrierende einfachere Modelle. Sollten die Ergebnisse also mit unseren Vorhersagen zusammenpassen, wäre das ein entscheidender Erfolg für unseren Ansatz.“ Damit wären die Indizien erdrückend, dass das bereits seit längerer Zeit bekannte aber bislang noch wenig erforschte Teilchen f0(1710) der so lange gesuchte Glueball-Zustand ist. Außerdem würde es ein weiteres Mal zeigen, dass sich mit höherdimensionaler Gravitationstheorie auch teilchenphysikalische Phänomene analysieren lassen – das wäre ein neuerlicher Triumph der allgemeinen Relativitätstheorie, die heuer im November ihren 100. Geburtstag feiert.
Originalpublikation in Physical Review Letters
Artikel auf science.orf.at
Rückfragehinweis:
Prof. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Poster Award für Alexander Haber und seine Supraflüssigkeiten
Alexander Haber, Doktorand am Institut für Theoretische Physik der TU Wien, wurde bei der Sommerschule „Dense matter in compact stars" in Bukarest, Rumänien, http://www.nipne.ro/indico/conferenceDisplay.py?confId=236, mit dem ersten Preis für das beste Poster der Schule ausgezeichnet. Das Siegerposter „Instabilities in two-component superfluids“ http://hep.itp.tuwien.ac.at/~ahaber/haber_poster.pdf wurde in einer anonymen Wahl von Studenten und Vortragenden ausgewählt, und Alexander erhielt die Gelegenheit, sein Poster in der finalen Sitzung der Sommerschule in Form eines 25-minütigen Vortrags zu präsentieren.
Alexander Haber
Siegerposter (Download: http://hep.itp.tuwien.ac.at/~ahaber/haber_poster.pdf)
Die Sommerschule fand im Rahmen des von der EU gefördertes Netzwerks “Exploring fundamental physics with compact stars” (NewCompStar http://compstar.uni-frankfurt.de) statt, das die führenden Experten in Astrophysik, Kernphysik und Gravitationstheorie zusammenbringt um das faszinierende Gebiet der Neutronensternphysik interdisziplinär zu erforschen.
Die heißesten Supraflüssigkeiten des Universums
Das Projekt, das durch Alexander Haber mit dem Poster präsentiert wurde, ist ein Teilprojekt seiner Doktorarbeit unter der Betreuung von Andreas Schmitt und wurde in Zusammenarbeit mit Stephan Stetina von der Washington University in Seattle ausgeführt. In diesem Projekt werden spezielle Eigenschaften von zwei-komponentigen Supraflüssigkeiten untersucht. Solche supraflüssigen Systeme können im Labor erzeugt werden, z.B. in kalten Quantengasen. Vor allem aber vermutet man sie im Innern von Neutronensternen. Durch die extrem hohen Dichten, die in Neutronensternen erreicht werden (ein Kubikzentimeter Neutronensternmaterie wiegt in etwa soviel wie die gesamte Menschheit), wird erwartet, dass Neutronen und Protonen, bei ultra-hohen Dichten auch Quarks, eine Supraflüssigkeit bzw. einen Supraleiter bilden. Dies geschieht trotz der relativ hohen Temperaturen (zirka eine Milliarde Grad Celsius), im Gegensatz zu Supraflüssigkeiten im Labor, für die ultra-kalte Bedingungen nötig sind (z.B. -271 °C, d.h. 2 Grad über dem absoluten Nullpunkt, für supraflüssiges Helium). Durch die Wechselwirkung zweier Flüssigkeitskomponenten (z.B. Neutronen und Protonen, oder auch zwei verschiedene ultrakalte, atomare Gase im Labor) kann es zu interessanten Instabilitäten kommen, wenn die beiden Flüssigkeiten sich mit einer Relativgeschwindigkeit zueinander bewegen. Mit anderen Worten, man erwartet spektakuläre Effekte wie z.B. supraflüssige Turbulenz, wenn eine Flüssigkeit hinreichend schnell im Vergleich zur anderen fließt.
Diese sogenannten Zwei-Strom-Instabilitäten haben möglicherweise einen wichtigen Einfluss auf die Rotationsfrequenz von Neutronensternen. Diese zeigen von Zeit zu Zeit ein bis heute nicht vollständig verstandenes Verhalten: Während die Rotationsgeschwindigkeit den Großteil der Zeit, wie erwartet, kontinuierlich sinkt, kommt es gelegentlich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von wenigen Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der Winkelgeschwindigkeit, in der Fachsprache „Pulsar Glitch“ genannt. Die Ursache dafür wird einer speziellen Eigenschaft von Supraflüssigkeiten zugeschrieben: Setzt man den Behälter, in dem sich die Supraflüssigkeit befindet (in diesem Fall den Neutronenstern selbst) in Rotation, dreht sich die Supraflüssigkeit, im Gegensatz zu Wasser zum Beispiel, nicht mit. Stattdessen bilden sich Wirbel aus, in denen, wie in kleinen Tornados, der Drehimpuls gespeichert wird. Es wird angenommen, dass die plötzlichen Änderungen in der Rotationsfrequenz der Sterne durch ein kollektives Übertragen des Drehimpulses der Wirbel zurück auf den Stern zustande kommen. Wodurch diese Übertragung jedoch ausgelöst wird, ist bis dato unbekannt, wobei die untersuchte Instabilität als möglicher Kandidat gilt.
Da die Rotationsfrequenz leicht messbar ist, bilden diese Instabilitäten somit einen entscheidender Baustein für die Beobachtung von „stellaren Suprafluessigkeiten“. Das Forschungsprojekt von Alexander Haber verbindet also Fragen der fundamentalen Wechselwirkungen mit astrophysikalischen Beobachtungen und ist auch von Relevanz für Systeme kondensierter Materie im Labor.
Rückfragehinweis:
Alexander Haber
Technische Universität Wien
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: ahaber@hep.itp.tuwien.ac.at
Hundert Jahre allgemeine Relativitätstheorie
Was Sie immer schon über Albert Einsteins Theorien wissen wollten: Zum hundertsten Geburtstag der allgemeinen Relativitätstheorie gibt es eine Ausstellung, Vorträge und vieles mehr.
Albert Einstein
Vor hundert Jahren, im Herbst 1915, veröffentlichte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie. Sie war mit Sicherheit eine der bahnbrechendsten Werke der Wissenschaftsgeschichte. Raum und Zeit kann man seither nicht mehr als unveränderlich und starr betrachten, stattdessen beschrieb Einstein eine vierdimensionale Raumzeit, die sich verbiegen kann. In Wien gibt es zahlreiche Veranstaltungen dazu – sowohl für die wissenschaftliche Community als auch für interessierte Laien.
Relativitätstheorie zum Angreifen
Die allgemeine Relativitätstheorie ist für unsere menschliche Intuition schwer zu begreifen. Das was wir als Gravitationskraft wahrnehmen, ergibt sich nach Einstein aus der Geometrie von Raum und Zeit, und diese Geometrie wiederum wird durch große Massen wie die Erde bestimmt, die eine Verbiegung der Raumzeit hervorrufen können. Wer sich darunter zunächst noch nicht viel vorstellen kann, sollte die Ausstellung „Einstein|Wellen|Mobil“ besuchen, die bis 6. November im Hauptgebäude der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Station macht. Dort erfährt man einiges über ungewöhnliche Objekte wie Schwarze Löcher und Gravitationswellen, und man kann sogar auf einem „relativistischen Fahrrad“ ein Gefühl für relativistische Effekte bekommen.
Workshop und Vorträge
Vom fünften bis siebten Oktober findet der internationale wissenschaftliche Workshop „100 Years of Curved Spacetime“ statt, mitorganisiert von Daniel Grumiller (Institut für Theoretische Physik, TU Wien). Auch wenn die Relativitätstheorie hundert Jahre alt ist, gibt es in diesem Bereich noch immer viele ungelöste Probleme. Kosmologie und Astrophysik werfen immer neue Fragen auf, die nur mit relativistischen Ansätzen beantwortet werden können, die Zusammenhänge zwischen Gravitation und Quantentheorien sind bis heute nicht geklärt. An der ÖAW finden mehrere Abendvorträge für die interessierte Öffentlichkeit statt, bei denen man sich über alte und neue Fragen der Relativitätstheorie informieren kann.
Festakt
Mit einem Festakt wird die Veranstaltungsreihe feierlich eröffnet. Der Vortrag von Jürgen Renn (Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) bildet hier den Kernpunkt. Unter dem Titel „Die Entstehung und Renaissance der Allgemeinen Relativitätstheorie“ beleuchtet der Festredner die dramatische Geschichte der Entstehung der Allgemeinen Relativitätstheorie und ihre Renaissance in den späten 50er und 60er Jahren. Jürgen Renn geht auch der Frage nach, was die wechselhafte Geschichte der Allgemeinen Relativitätstheorie für die Zukunft der Physik bedeutet. Begrüßt wird vom Präsidenten der ÖAW, Anton Zeilinger sowie für das Organisationskomitee Markus Aspelmeyer (Universität Wien) und Daniel Grumiller (TU Wien).
Auch wird der Chor der TU mit „Bohemian Gravity“ auftreten. Anschließend wird zum Empfang inmitten der Ausstellung, die damit ebenfalls eröffnet wird, eingeladen.
Neues Materialdesign ermöglicht ungestörte Lichtwellen
In Materialien, die Licht abschwächen und verstärken können, sind überraschende Arten von Lichtwellen möglich – das zeigen Berechnungen der TU Wien.
Eine Welle dringt in ein Material ein: Normalerweise kommt es zu komplizierten Wellenüberlagerungen, zu hellen und dunklen Bereichen.
Eine Welle dringt in ein Material ein: Bei speziell designten nicht-hermitischen Materialien bleibt die Welle unbeeinflusst.
Wenn eine Lichtwelle in ein Material eindringt, ändert sie sich normalerweise drastisch. Sie wird gestreut und abgelenkt, und durch die Überlagerung von Lichtwellen kommt es zu einem Muster aus helleren und dunkleren Bereichen. In maßgeschneiderten High-Tech-Materialien, die das Licht lokal verstärken oder abschwächen können, ergeben sich nun neue Möglichkeiten solche Effekte vollständig zu unterdrücken: Wie eine theoretische Arbeit der TU Wien zeigt, ermöglichen diese neuen Materialien ganz besondere Lichtwellen, die im Inneren des Materials an jedem Ort dieselbe Intensität aufweisen - so als gäbe es keinerlei Wellenüberlagerung. Durch diese ungewöhnlichen Eigenschaften könnten sich diese neuartigen Lösungen der Wellengleichung des Lichts technisch nutzen lassen.
Hindernisse verändern die Lichtintensität
Wenn sich eine Lichtwelle gerade und eben durch den freien Raum bewegt, dann kann sie überall dieselbe Intensität haben, ihr Licht ist demnach überall gleich hell. Trifft sie allerdings auf ein Hindernis, dann wird die Welle abgelenkt, das Licht ist danach an manchen Stellen heller, an anderen Stellen dunkler als es ohne Hindernis gewesen wäre. Erst durch solche Überlagerungs- oder Interferenzeffekte können wir Objekte sehen, die selbst kein Licht ausstrahlen.
In den letzten Jahren gab es allerdings immer wieder Experimente mit neuen Materialien, die Lichtwellen auf ganz besondere Weise verändern können: Sie können das Licht lokal verstärken (ähnlich wie das in einem Laser geschieht) oder auch abschwächen (wie in einer Sonnenbrille). „Wenn solche Prozesse möglich sind, muss man die Lichtwelle mathematisch anders beschreiben, als man es in gewöhnlichen, transparenten Materialien tut“, erklärt Prof. Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik, TU Wien). „Wir sprechen dann von sogenannten nicht-hermitischen Medien.“
Eine neue Lösung für die Wellengleichung
Konstantinos Makris und Stefan Rotter entdeckten gemeinsam mit Kollegen aus den USA, dass sich damit neuartige Lösungen der Wellengleichung finden lassen. „Man erhält Lichtwellen, die überall gleich hell sind, wie bei einer ebenen Welle im freien Raum, obwohl die Welle ein stark strukturiertes Material durchdringt“, sagt Konstantinos Makris. „Für die Welle ist das Material in gewissem Sinn unsichtbar, obwohl sie es durchdringt und mit ihm stark wechselwirkt.“
Das neue Konzept der Physiker erinnert an sogenannte „Metamaterialien“, mit denen in den letzten Jahren viel experimentiert wurde. Dabei handelt es sich um strukturierte Materialien, die Licht auf ungewöhnliche Weise ablenken und in bestimmten Fällen um ein Objekt herum führen können, sodass das Objekt wie durch Harry Potters Tarnumhang ("invisibility cloak") unsichtbar gemacht wird. „Unsere nicht-hermitischen Materialien funktionieren allerdings auf Basis eines anderen Prinzips“, betont Stefan Rotter. „Die Lichtwelle wird nicht außen herumgelenkt, sondern sie durchdringt das Material. Aber der Effekt, den das Material auf die Intensität der Welle hat, wird durch ein genau justiertes Wechselspiel aus Verlust und Verstärkung ausgeglichen.“ Am Ende ist die Welle überall im Raum genauso hell, wie sie ohne das Objekt gewesen wäre.
Bis es tatsächlich gelingt, Objekte herzustellen, die Lichtwellen unberührt passieren lassen, ist noch eine Reihe technischer Details zu lösen – gearbeitet wird daran bereits. Mathematisch ist allerdings nun bewiesen, dass es neben Metamaterialien auch noch einen anderen, äußerst vielversprechenden Pfad gibt, Wellen auf ungewöhnliche Weise zu manipulieren. „In einem gewissen Sinn haben wir mit unserer ersten Arbeit zu diesem Thema eine Tür aufgestoßen, hinter der wir noch eine Vielzahl an neuen Einsichten vermuten“, erklärt Konstantinos Makris.
Originalpublikation in Nature Communications:
http://www.nature.com/ncomms/2015/150708/ncomms8257/full/ncomms8257.html
Frei zugängliche Version:
http://arxiv.org/abs/1503.08986
Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter at tuwien.ac.at
Ist unser Universum ein Hologramm?
Zur Beschreibung des Universums braucht man möglicherweise eine Dimension weniger als es den Anschein hat. Rechnungen der TU Wien legen nun nahe, dass es sich dabei nicht bloß um einen Rechentrick handelt, sondern um eine grundlegende Eigenschaft des Raums.
Leben wir in einem Hologramm?
Daniel Grumiller
Auf den ersten Blick scheint jeder Zweifel ausgeschlossen: Das Universum sieht für uns dreidimensional aus. Doch eine der fruchtbarsten Ideen der theoretischen Physik in den letzten beiden Jahrzehnten stellt genau das in Frage: Das „holographische Prinzip“ sagt, dass man für die Beschreibung unseres Universums möglicherweise eine Dimension weniger braucht als es den Anschein hat. Was wir dreidimensional erleben, kann man auch als Abbild von zweidimensionalen Vorgängen auf einem riesigen kosmischen Horizont betrachten.
Bisher wurde es nur in exotischen Raumzeiten mit negativer Krümmung studiert, die zwar theoretisch interessant sind, sich von unserem Universum aber wesentlich unterscheiden. Ergebnisse der TU Wien legen nun allerdings nahe, dass dieses holographische Prinzip auch in flachen Raumzeiten gilt, wie wir sie in unserem Universum beobachten.
Das Holographische Prinzip
Man kennt das von Hologrammen auf Geldscheinen oder Kreditkarten. Sie sind eigentlich zweidimensional, sehen für uns aber dreidimensional aus. Möglicherweise verhält sich das Universum ganz ähnlich. „Schon 1997 stellte der Physiker Juan Maldacena die Vermutung auf, dass es eine Korrespondenz zwischen Gravitationstheorien in gekrümmten Anti-de-Sitter-Räumen und Quantenfeldtheorien in Räumen mit einer Dimension weniger gibt“, sagt Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Man beschreibt Gravitations-Phänomene in einer Theorie mit drei Raumdimensionen oder das Verhalten von Quantenteilchen in einer Theorie in zwei Raumdimensionen und kann die Ergebnisse ineinander überführen. Ein solcher Zusammenhang ist zunächst ähnlich überraschend als würde man mit den Formeln aus einem Astronomie-Lehrbuch einen CD-Player reparieren. Doch die Methode hat schon viele Erfolge gebracht. Mehr als zehntausend wissenschaftliche Arbeiten wurden mittlerweile zu Maldacenas „AdS-CFT-Korrespondenz“ veröffentlicht.
Korrespondenzprinzip auch im flachen Universum
Für die theoretische Physik ist das zwar wichtig, doch mit unserem Universum hat das zunächst noch nichts zu tun. Wir leben nämlich definitiv nicht in einem Anti-de-Sitter-Raum. Solche Räume haben sehr merkwürdige Eigenschaften. Sie sind negativ gekrümmt, Objekte, die man auf gerader Linie wegwirft, kommen wieder zurück. „Unser Universum hingegen ist ziemlich flach – und auf astronomischen Distanzen betrachtet ist es positiv gekrümmt“, sagt Daniel Grumiller.
Grumiller vermutete allerdings schon vor einigen Jahren, dass ein Korrespondenzprinzip auch für unser reales Universum gelten könnte. Um das herauszufinden, muss man Gravitationstheorien konstruieren, die keine exotischen Anti-de-Sitter-Räume brauchen, sondern in gewöhnlichen flachen Räumen zu Hause sind. Daran wird seit etwa drei Jahren in einer internationalen Kooperation von der Universität Edinburgh, Harvard, IISER Pune, dem MIT, der Universität Kyoto und der TU Wien gearbeitet. Nun veröffentlichte Grumiller mit Kollegen aus Indien und Japan einen Artikel im Journal „Physical Review Letters“, das die Korrespondenz-Vermutung in einem flachen Universum bestätigt.
Zweimal gerechnet – selbes Ergebnis
„Wenn die Quantengravitation im flachen Raum eine holographische Beschreibung durch eine gewöhnliche Quantentheorie zulässt, dann muss man physikalische Größen in beiden Theorien berechnen können, und die Ergebnisse müssen übereinstimmen“, sagt Grumiller. Insbesondere muss sich eine Schlüsseleigenschaft der Quantenmechanik – die Quantenverschränkung – auch auf der Seite der Gravitationstheorie finden.
Wenn Quantenteilchen verschränkt sind, lassen sie sich mathematisch nicht getrennt beschreiben – sie bilden quantenphysikalisch betrachtet ein gemeinsames Objekt, auch wenn sie weit voneinander entfernt sind. Ein Maß für die quantenmechanische Verschränkung ist die sogenannte „Verschränkungsentopie“. Gemeinsam mit Arjun Bagchi, Rudranil Basu und Max Riegler konnte Daniel Grumiller zeigen, dass man für diese Verschränkungsentropie in einer flachen Quantengravitationstheorie und in einer niedrigdimensionalen Quantenfeldtheorie tatsächlich denselben Wert erhält.
"Diese Rechnung bestätigt unsere Vermutung, dass das holographische Prinzip auch in flachen Raumzeiten realisiert sein kann. Es ist somit ein Hinweis für die Gültigkeit dieses Prinzips in unserem Universum." erklärt Max Riegler, DOC-Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Daniel Grumillers Forschungsgruppe. "Allein die Tatsache, dass wir auf der Gravitationsseite über Quanteninformationsbegriffe wie Verschränkungsentropie reden können ist verblüffend und war vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar. Dass wir sie nun sogar als Werkzeug verwenden können um die Gültigkeit des holographischen Prinzips zu testen - und das dieser Test auch funktioniert hat – ist wirklich bemerkenswert“, sagt Daniel Grumiller.
Damit ist freilich noch nicht bewiesen, dass wir tatsächlich auf einem Hologramm leben – doch die Hinweise auf die Gültigkeit des Korrespondenzprinzips in unserem realen Universum scheinen sich zu verdichten.
Originalpublikation: Phys. Rev. Lett. 114, 111602, 2015:
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.114.111602
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Rückfragehinweis:
Prof. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
daniel.grumiller at tuwien.ac.at
Gipfeltreffen der Teilchenphysik in Wien
Neue Entdeckungen am CERN und die Suche nach unbekannten Teilchen beschäftigen die Forscher_innen auf einer der bedeutendsten Teilchenphysik-Konferenzen der Welt.
CMS Detektor am CERN in Genf
Seit vergangenem Mittwoch steht Wien im Zeichen von Pentaquarks, Neutrinos, Higgs-Boson & Co. Mehr als 700 internationale Physiker_innen diskutieren bei einer der weltweit bedeutendsten Teilchenphysik-Konferenzen die neuesten Ergebnisse ihres Forschungsbereichs. Im Zentrum der Konferenz, die von der European Physical Society, dem Institut für Hochenergiephysik bzw. dem Stefan-Meyer-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der Technischen Universität (TU) Wien und der Universität Wien veranstaltet wird, stehen die mit Spannung erwarteten Resultate der kürzlich wieder angelaufenen Experimente am Large Hadron Collider (LHC) des CERN. Bei einer Pressekonferenz am 27. Juli 2015 konnte CERN-Generaldirektor Rolf Heuer bereits Neuigkeiten zu den erst vor wenigen Tagen entdeckten Pentaquarks präsentieren. Insgesamt fällt die Zwischenbilanz über die neu gestarteten Versuchsreihen am CERN überaus positiv aus: „Mit den LHC-Experimenten haben wir schon weit mehr Daten gesammelt als im Jahr 2010, in dem der LHC seinen Betrieb erstmals bei hohen Energien aufgenommen hat. Wir spüren gerade einen fantastischen Pioniergeist bei den Physikern, die derzeit völlig neuartige Daten bei bisher unerforschten Energien auswerten“, sagte Heuer vor Vertretern der internationalen Presse.
Österreichs Forschung leistet wesentliche Beiträge in der Teilchenphysik
Österreich ist bereits seit 1959 Teil der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) und österreichische Forschungseinrichtungen leisten seit vielen Jahren wichtige Beiträge in der Kern- und Teilchenphysik. Ein Schwerpunkt der österreichischen Beteiligung am CERN ist die Mitarbeit bei internationalen Großexperimenten. So ist das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW Gründungsmitglied des CMS-Experiments am CERN, einem der beiden großen Detektoren, in denen 2012 der Nachweis des Higgs-Bosons gelang. Auch das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik der ÖAW, das Atominstitut der TU Wien, das Institut für Theoretische Physik der Universität Wien sowie fünf weitere österreichische Forschungseinrichtungen arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen und theoretischen Kern- und Teilchenphysik.
„Die Technologieentwicklungen für die Experimente am CERN werden an verschiedenen Instituten weltweit vorangetrieben. Auch kleinere Länder wie Österreich sind federführend beteiligt. Beispielsweise hat das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW in den vergangenen Jahren eine international anerkannte Rolle bei der Entwicklung und dem Bau von Spurdetektoren eingenommen“, sagte Jochen Schieck, Direktor des Instituts für Hochenergiephysik der ÖAW auf der Pressekonferenz. Spurdetektoren sind wichtige Instrumente für die Arbeit am CERN. Sie haben die Aufgabe Signale aufzuzeichnen, die die Teilchen hinterlassen. Damit können Flugbahnen und Ursprungsorte von Teilchen präzise vermessen werden.
Von der Grundlagenforschung, die an österreichischen Forschungseinrichtungen und am CERN betrieben wird, hat nicht nur die Wissenschaft etwas. Die österreichische Wirtschaft profitiert vom Know‐how der neu entwickelten Technologien und von finanziellen Rückflüssen an österreichische Unternehmen. Die österreichischen Kern‐ und Teilchenphysik‐Institute bieten zudem ein exzellentes Ausbildungsprogramm für Studierende und Doktorand_innen. Nachwuchswissenschaftler_innen sind von Beginn an in internationale Forschungsprojekte involviert.
Die neuesten Erkenntnisse vom LHC
Ein Höhepunkt der Pressekonferenz war das Update des CERN zum neugestarteten LHC. Der schnellste und stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt, auch als „Weltmaschine“ bekannt, läuft seit seinem Neustart mit fast dem Doppelten der bisherigen Kollisionsenergie. Waren es vor der Wartungspause Energien von rund acht Tera-Elektronenvolt, so sind jetzt bereits bis zu 13 Tera-Elektronenvolt möglich. Übersetzt entspricht diese Energie dem Milliardenfachen der Temperatur im Inneren der Sonne. Der Vorteil dieser hohen Energien: Je heftiger die Zusammenstöße der Protonen sind, desto exotischere, bislang unbekannte Partikel könnten auftauchen.
Selbst die Daten aus der ersten Betriebsphase des LHC sind noch voller Überraschungen, wie sich erst kürzlich wieder zeigte. Lange, nämlich bereits seit den 1960er Jahren, hatte man darüber spekuliert, jetzt wurde es erstmals sichtbar: Das „Pentaquark“, ein Konglomerat aus fünf Quarks und ein weiterer Meilenstein in der Teilchenphysik.
„Mit den hohen Energien, die seit 2015 am LHC möglich sind, betreten wir physikalisches Neuland“, betonte Rolf Heuer bei der Pressekonferenz, „denn diese Energien sind nie zuvor erreicht worden“, so der Generaldirektor des CERN weiter.
27 Kilometer ist der unterirdische Ringtunnel des LHC im CERN bei Genf lang. In ihm werden zwei Strahlen, bestehend aus Paketen von jeweils 100 Milliarden Protonen, in gegenläufiger Richtung fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und im Zentrum der Detektoren alle 50 Nanosekunden frontal zur Kollision gebracht. Die Zahl der Pakete wird derzeit schrittweise erhöht und in den nächsten Tagen soll die Zeit zwischen den Kollisionen sogar halbiert werden. Das ambitionierte Ziel ist, bis Ende des Jahres die Anzahl der Pakete im Beschleuniger auf 2000 pro Strahl zu steigern. Die Aussichten damit neue, bisher völlig unbekannte Teilchen zu finden, werden damit noch größer.
Wichtigster Preis der Teilchenphysik verliehen
Bei der noch bis Mittwoch laufenden Teilchenphysik-Konferenz wurde erstmals in Wien auch einer der prestigeträchtigsten Preise der gegenwärtigen Physik vergeben: Der „High Energy and Particle Physics“-Preis der European Physical Society. Dessen Bedeutung unterstreicht auch die Tatsache, dass viele seiner bisherigen Träger_innen später mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden. Die Preisträger_innen des EPS-Preises 2015 sind die theoretischen Physiker James D. Bjorken (Stanford), Guido Altarelli (Rom), Yuri L. Dokshitzer (Paris und St. Petersburg), Lev Lipatov (St. Petersburg) und Giorgio Parisi (Rom).
Einer der EPS-Preise, der „Giuseppe und Vanna Cocconi-Preis“ für herausragende Leistungen im Bereich der Astrophysik, wurde in diesem Jahr an Francis Halzen verliehen. Halzen leitet eines der derzeit meistbeachteten Experimente der Astrophysik, das sich mit der Erforschung einer ganz besonderen Art von Teilchen befasst: Das IceCube-Projekt sucht mit einem gigantischen Teleskop in der Antarktis nach Neutrinos im Weltall. Die Verleihung des „Giuseppe und Vanna Cocconi-Preises“ würdigt Halzens visionäre und führende Rolle bei der Entdeckung von hochenergetischen extraterrestrischen Neutrinos. Auf der Pressekonferenz erläuterte er: „Neueste Erkenntnisse zeigen, dass Neutrinos uns von Quellen aus dem gesamten Universum erreichen. Es scheint, dass die Quellen der Neutrinos mit den bereits bekannten Quellen hochenergetischer Lichtquanten zusammenhängen.“ Halzens Forschungsergebnisse eröffnen der Astroteilchenphysik damit ein neues Fenster für das Verständnis unseres Universums.
Die Teilchenphysik der Zukunft
Das Universum steht auch in den kommenden zwei Tagen im Zentrum des Interesses der Forscher_innen, die sich mit zahlreichen weiteren Themen der aktuellen Physik beschäftigen. Neben der Suche nach dunkler Materie und der Entstehung des Universums durch den Urknall versprechen auch die am LHC erreichten höheren Kollisionsenergien sowie die inzwischen atemberaubende Präzision der Ergebnisse aus der kosmologischen Forschung immer genauere Informationen über die Zusammensetzung und den Aufbau des Universums.
Die faszinierenden Rätsel an der Wurzel unserer Existenz waren darüber hinaus auch Thema bei der gemeinsamen Strategiesitzung der European Physical Society und dem europäischen Komitee für zukünftige Beschleuniger, die im Rahmen der Konferenz stattfand. So hält die Frage, ob es eine Verbindung zwischen der Physik des Allerkleinsten und des Allergrößten gibt, gleichermaßen Teilchenphysik wie Kosmologie – der Wissenschaft vom Ursprung, der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des Universums – in Atem. Zu erwarten ist, dass zukünftig die Teilchenphysik und die Kosmologie noch enger verknüpft werden können – und damit Ergebnisse für zahlreiche weitere Gipfeltreffen der Physik liefern.
Den Abschluss einer der weltweit größten Konferenzen der Teilchenphysik bildet am 29. Juli der Vortrag der designierten CERN-Generaldirektorin Fabiola Gianotti. Sie gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Teilchenphysik und die nächste Generation von Beschleunigern.
Pressetext und Fotos zum Download unter: www.oeaw.ac.at/pr
Informationen zum Programm der Konferenz unter http://eps-hep2015.eu
Ein täglicher Newsletter zur Konferenz unter http://eps-hep2015.eu/news-press
Information und Kontakte:
The European Physical Society
The European Physical Society (EPS) is a not for profit association whose members include 42 National Physical Societies in Europe, individuals from all fields of physics, and European research institutions.
As a learned society, the EPS engages in activities that strengthen ties among the physicists in Europe. As a federation of National Physical Societies, the EPS studies issues of concern to all European countries relating to physics research, science policy and education.
www.eps.org
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat die gesetzliche Aufgabe, „die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern“. 1847 als Gelehrtengesellschaft gegründet, steht sie mit ihren heute über 770 Mitgliedern sowie rund 1.300 Mitarbeiter_innen für innovative Grundlagenforschung, interdisziplinären Wissensaustausch und Wissenschaftsvermittlung – mit dem Ziel der Förderung des wissenschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritts.
www.oeaw.ac.at
Die Technische Universität Wien
Die Technische Universität Wien – kurz: TU Wien - liegt im Herzen Europas, an einem Ort kultureller Vielfalt und gelebter Internationalität. Hier wird seit fast 200 Jahren im Dienste des Fortschritts geforscht, gelehrt und gelernt. Die TU Wien zählt zu den erfolgreichsten Technischen Universitäten in Europa und ist mit über 29.000 Studierenden und rund 3.300 Wissenschaftler_innen Österreichs größte naturwissenschaftlich-technische Forschungs- und Bildungseinrichtung.
www.tuwien.ac.at
Die Universität Wien
Die Universität Wien ist eine der ältesten und größten Universitäten Europas: An 19 Fakultäten und Zentren arbeiten rund 9.700 Mitarbeiter_innen, davon 6.900 Wissenschafter_innen. Die Universität Wien ist damit die größte Forschungsinstitution Österreichs sowie die größte Bildungsstätte: An der Universität Wien sind derzeit rund 92.000 nationale und internationale Studierende inskribiert. Mit über 180 Studien verfügt sie über das vielfältigste Studienangebot des Landes. Die Universität Wien ist auch eine bedeutende Einrichtung für Weiterbildung in Österreich. 1365 gegründet, feiert die Alma Mater Rudolphina Vindobonensis im Jahr 2015 ihr 650-jähriges Gründungsjubiläum.
www.univie.ac.at
Rückfragehinweise
Dipl.-Soz. Sven Hartwig
Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation
Österreichische Akademie der Wissenschaften
sven.hartwig at oeaw.ac.at
Mag. Alexandra Frey
Pressebüro der Universität Wien
Forschung und Lehre
alexandra.frey at univie.ac.at
MMag. Christine Cimzar-Egger
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Forschungs-PR
christine.cimzar-egger at tuwien.ac.at
Bild: © CERN
Ausgezeichneter TU Chor
Der Chor der TU Wien unter der Leitung von Andreas Ipp wurde beim 5. Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz mit dem silbernen Diplom ausgezeichnet.
Silbernes Diplom für den TU Chor beim Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival
19 Chöre aus 12 Nationen traten von 3. bis 7. Juni 2015 beim renommierten Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Zum ersten Mal war der TU Chor unter der Leitung von Andreas Ipp dabei und wurde in der Kategorie "B1 - Mixed Choirs without compulsory piece" mit dem silbernen Diplom ausgezeichnet. Gold in dieser Kategorie erhielten der Nanyang Technological University Choir aus Singapur sowie der Pärnu Kammerkoor aus Estland.
Der Großpreis ging an den Choir of the West, Pacific Lutheran University, USA, der sich beim Abschlusskonzert gegen die besten Chöre aus den verschiedenen Kategorien durchsetzen konnte.
Neben dem Wettbewerbsauftritt im Brucknerhaus nutzen die TU-Sänger_innen die Gelegenheit, sich von der internationalen Jury in einem Beratungskonzert Feedback zu holen und probten mit dem Dirigenten Fred Sjöberg aus Schweden.
Beim Freundschaftskonzert im Marmorsaal des Stiftes St. Florian konnte der TU Chor zeigen, dass er nicht nur klassische Stücke wie das "Jagdlied" von Felix Mendelssohn Bartholdy beherrscht: Das Publikum zeigte sich begeistert vom 1990er-Medley "I don`t care who you are".
Singen auf den Spuren Anton Bruckners
Knapp 60.000 km haben alle Teilnehmerchöre insgesamt zurückgelegt, um beim INTERKULTUR Event in Linz dabei zu sein. Die weiteste Anreise hatte dabei der "Cantata Choir - Puerto Princesa City" von den Philippinen mit 10.245 km. Andere Chöre kamen unter anderem aus den USA, Singapur, Estland, Finnland, Rumänien und Kroatien.
Die Veranstaltungstage begannen traditionell mit der Aufführung von Anton Bruckners "Te Deum" im Neuen Dom Linz. Internationale Chöre aus Dänemark, Estland und den Niederlanden traten als "Sing’n’Joy Festivalchor" gemeinsam mit dem Domchor, Solist_innen und dem Orchester der Dommusik auf. Auch die nächsten Tage standen ganz im Zeichen Anton Bruckners. Ob als Pflichtstück in der Wettbewerbskategorie A oder bei Festivalkonzerten an seiner ehemaligen Wirkungsstätte im Stift St. Florian – überall folgen die Teilnehmer_innen in Linz seinen Spuren. Bei der Abschlussveranstaltung am Samstagabend sangen alle Chöre gemeinsam Bruckners "Locus iste", dirigiert von Domkapellmeister Josef Habringer.
Details zum Wettbewerb: http://www.interkultur.com
Mehr zum TU Chor unter: http://chor.tuwien.ac.at/home/
Ernest Rutherford Fellowship für Andreas Schmitt
Andreas Schmitt vom Institut für Theoretische Physik hat das hoch angesehene Ernest Rutherford Fellowship des Science & Technology Facilities Council (STFC) errungen. Dieses Fellowship ermöglicht den weltweit besten und vielversprechendsten jungen Wissenschaftlern unabhängige Spitzenforschung im Bereich der Teilchen-, Kern- und Astrophysik an einer ausgewählten Institution in Großbritannien über einen Zeitraum von fünf Jahren durchzuführen. Andreas Schmitt wird das Fellowship an der Universität von Southampton, im neu etablierten "Southampton Theory Astrophysics and Gravity Research Center" (STAG), antreten, in dem zahlreiche international anerkannte Forscher arbeiten und das deshalb eine ideale Umgebung für moderne Forschung im Grenzbereich zwischen fundamentaler Teilchenphysik und Astrophysik darstellt.
Andreas Schmitt
Neutronenstern im Krebsnebel, der bei einer Supernova-Explosion im Jahr 1054 entstanden ist (Chandra X-Ray Observatory)
Die ganze Menschheit in einem Stück Würfelzucker
Die Forschungsvorhaben, die Andreas Schmitt während dieses Fellowships anstrebt, sind zum Teil eine Fortsetzung und Weiterentwicklung seiner bisherigen erfolgreichen Arbeit, die er in den vergangenen Jahren am Institut für Theoretische Physik der TU Wien durchgeführt hat. Dabei handelt es sich vor allem um offene Probleme der Kern- und Teilchenphysik, die sowohl von fundamentalem Interesse sind als auch wichtig sind für das Verständnis astrophysikalischer Beobachtungen von Neutronensternen. Die zu Grunde liegende - und äußerst schwer zu beantwortende - Frage ist, was mit Materie passiert, wenn man sie immer weiter zusammenpresst, so dass man ultradichte Materie erhält, in der die fundamentalen Freiheitsgrade wie Quarks und Gluonen eine Rolle spielen. Während irdische Experimente nur schwerlich solch extreme Dichten erreichen können, existiert ultradichte Kern- und eventuell Quarkmaterie im Innern von Neutronensternen: ultra-kompakte Sterne schwerer als die Sonne, aber nicht größer als eine Großstadt wie Wien - ein zuckerwürfelgroßes Stück Neutronensternmaterie wiegt in etwa so viel wie die gesamte Menschheit.
Supraflüssigkeit, quantisierte Wirbel und magnetische Flussschläuche
Es geht also im geplanten Forschungsvorhaben darum, mikroskopische, auf Quantenfeldtheorien basierende Eigenschaften von dichter Materie mit astrophysikalischen Phänomenen zu verknüpfen. In der Forschungsarbeit von Andreas Schmitt steht dabei zum Beispiel die Supraflüssigkeit von ultradichter Materie im Mittelpunkt. Wie bei wohlbekannten, im Labor untersuchten Supraflüssigkeiten können auch Neutronen, Protonen und Quarks in Neutronensternen Cooper-Paar-Kondensate bilden, deren Bindung durch die starke Kernkraft erzeugt wird und die zu charakteristischen Phänomenen von Supraleitung und Supraflüssigkeit führen, wie zum Beispiel quantisierte Wirbel und magnetische Flussschläuche. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt während des Fellowships wird die Anwendung der Dualität von gewissen Eich- und Gravitationstheorien sein, die auf stringtheoretische Methoden zurückgreift und mit Hilfe derer man Eigenschaften stark gekoppelter Materie untersuchen kann. Eine große Herausforderung, die aber auch enorme Möglichkeiten für zukünftige Forschung bietet, ist die Entwicklung eines realistischen Modells für dichte Kernmaterie im Rahmen dieser Dualität.
Rückfragehinweis:
Dr. Andreas Schmitt
Technische Universität Wien
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: aschmitt@hep.itp.tuwien.ac.at;
Fertigstellung der Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten im Freihaus
Am Mittwoch, 22. April, werden die sanierten Türme A und B im Freihaus feierlich eröffnet.
Freihaus
Als Folge der Zusammenführung der Fakultät für Maschinenwesen am Getreidemarkt werden im Rahmen der "TU Nachnutzungen" freiwerdende Bereich saniert und modernisiert. Mit den Fakultäten Mathematik und Geoinformation sowie Physik wurden zur Zusammenführung der Institute im Freihaus entsprechende Projekte entwickelt und umgesetzt.
Ab 2014 begannen im Grünen Bereich (Turm A - vorwiegend Mathematik), 3. bis ins 8. OG und im gelben Bereich (Turm B), 3 und 4 Stockwerken die Bauaktivitäten. Es erfolgten Sanierungsarbeiten und Adaptierungen von Teilbereichen und strukturbereinigende Maßnahmen die nun fertiggestellt wurden.
Eröffnung
Mi, 22.04.2015, 16:00 Uhr
TU Wien Freihaus, Gelber Turm (DB), 4.OG, Seminarraum 105A
1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8 - 10
Im Faxraum ist alles in Ordnung
Die alten Swoboda-Kästen in unserem Faxraum im 10. Stock fielen auseinander. So nutzten wir die Gelegenheit der herannahenden neuen Möbel und nahmen drei jung gebliebene Kästen aus dem Jahr 1988 aus Prof. Schwedas Zimmer. „Neue“ Kästen, ein bisschen Ausmisten und eine neue Ordnung – schon strahlt unser Faxraum in nie gekanntem Glanz.
Vor allem in den offenen Bereichen der „Kredenzen“ und im linken Kasten finden Sie alles Nötige.
Hier noch ein paar Bilder:
Hochdotierte Förderung für Materialforschung
Zwei Spezialforschungsbereiche des FWF im Bereich der Materialwissenschaft wurden verlängert: Die erfolgreiche Forschung an funktionalen Oxid-Oberflächen (FOXSI) und an materialwissenschaftlichen Computersimulationen (VICOM) wird fortgesetzt.
Neue Materialien entdeckt man nicht einfach durch Zufall. Um neue Werkstoffe oder neue Katalysator-Materialien zu entwickeln, muss man heute auf atomarer Ebene verstehen, durch welche Effekte Materialeigenschaften überhaupt zustande kommen. Seit vier Jahren wird an der TU Wien in zwei hochdotierten Spezialforschungsbereichen (gefördert vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF) international höchst angesehene Forschung betrieben. Beide Projekte wurden nun um weitere vier Jahre verlängert: Im SFB VICOM entwickelt und verwendet man Computermethoden zur Berechnung von Materialien auf Quanten-Ebene, im SFB FOXSI werden Metall-Oxide erforscht, insbesondere ihre Oberflächen und die Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Materialien.
Die Oberfläche hat ihre eigenen Regeln
Wenn man weiß, wie ein Material im Inneren aufgebaut ist und auf welche Weise seine Atome aneinandergefügt sind, kann man Materialeigenschaften oft gut verstehen. Doch die Oberflächen des Materials, oder die Grenzflächen zwischen zwei verschiedenen Materialien, sind oft viel schwieriger zu verstehen. Dabei ist gerade das Verhalten an der Oberfläche besonders interessant: Wenn Materialien als Katalysatoren eingesetzt werden, dann geht es genau darum, die Eigenschaften der äußersten Atomschichten zu untersuchen.
Im SFB FOXSI widmet man sich genau dieser ganz besonders schwierigen Aufgabe: Man untersucht funktionale Oxide, wie man sie etwa als Katalysatoren oder Elektrolyte für Brennstoffzellen einsetzt. „In der Industrie ist man in diesem Bereich ständig auf der Suche nach neuen Materialien“, sagt Prof. Günther Rupprechter, der Leiter des Spezialforschungsbereichs. Manchmal gelingen Verbesserungen einfach durch Versuch und Irrtum, aber für substanzielle Fortschritte benötigt man Grundlagenforschung. An der TU Wien versucht man auf ganz fundamentaler Ebene zu verstehen, welche Effekte hier eine Rolle spielen und wie man Materialien gezielt verbessern kann.
Materialeigenschaften am Computer berechnen
International höchst erfolgreich ist auch der SFB VICOM (Vienna Computational Materials Laboratory), an dem sowohl die Universität Wien als auch die TU Wien beteiligt ist. „Sucht man nach neuen Materialien die zum Beispiel ganz besondere magnetische oder thermoelektrische Eigenschaften haben, muss man die Materialphysik auf Quanten-Ebene verstehen und berechnen können“, sagt Prof. Karsten Held, einer der Principal Investigators von VICOM. „Das komplizierte Zusammenspiel der Atome eines Festkörpers und ganz besonders das Verhalten seiner Elektronen legen seine Eigenschaften fest.“
Berechnen kann man das nur mit großem Aufwand. Oft werden für solche Berechnungen besonders leistungsfähige Computercluster wie der Vienna Scientific Cluster mit tausenden Prozessorkernen verwendet. Die Universität Wien und die TU Wien liefern seit Jahren wichtige Beiträge für den Forschungsbereich der computergestützten Materialforschung. Im Rahmen des Spezialforschungsbereichs VICOM werden neue Computermethoden entwickelt, verbessert und angewandt.
FWF-Förderung verlängert
Mit der Schaffung von Spezialforschungsbereichen setzt der Wissenschaftsfonds FWF gezielt Schwerpunkte und baut international erfolgreiche Forschungsnetzwerke in Österreich auf. Dadurch soll das Entstehen von eng vernetzten, oft multidisziplinären Forschungseinheiten gefördert werden. Sowohl VICOM als auch FOXSI konnten in den vergangenen vier Jahren große wissenschaftliche Erfolge vorweisen und wurden vom FWF nun verlängert: Beide Projekte laufen nun weitere vier Jahre weiter.
Mehr dazu: FOXSI und VICOM online
http://foxsi.tuwien.ac.at
http://www.sfb-vicom.at
Doktortitel für das Erklären der Welt
Einigen der fundamentalsten Fragen der Wissenschaft widmet sich das Doktoratskolleg „Particles and Interactions“, das am 10. März an der TU Wien eröffnet wird – mit prominenten Gästen.
[1]
Über die Grundgesetze der Physik weiß man zwar mittlerweile sehr viel, doch noch sind wir weit davon entfernt, die fundamentalen Gesetze des Universums völlig verstanden zu haben. Wie kann man die kleinsten Teilchen unserer Welt genau beschreiben, wie lässt sich dunkle Materie verstehen, was ist unmittelbar nach dem Urknall passiert und was hat die Krümmung von Raum und Zeit damit zu tun? Solche Fragen bietet nach wie vor Stoff für unzählige spannende Forschungsarbeiten.
Einige solche Arbeiten werden in den nächsten Jahren im Rahmen des Doktoratskollegs „Particles and Interactions“ durchgeführt. Das Kolleg wird am 10. März feierlich eröffnet, mit Gastvorträgen des Quantenphysikers Prof. Anton Zeilinger (Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) und des Teilchenphysikers John Ellis vom King’s College in London, der lange Zeit die Theorieabteilung des CERN leitete und weiterhin dort forscht.
TU Wien, Uni Wien und Akademie der Wissenschaften
Das Doktoratskolleg vereint mehrere renommierte Wiener Forschungsinstitutionen: Neben den Instituten für theoretische Physik und dem Atominstitut der TU Wien ist auch die Teilchenphysik-Gruppe der Fakultät für Physik der Universität Wien beteiligt. Mit dem Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) und dem Stefan Meyer Institut für Subatomare Physik sind außerdem zwei Institute der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit dabei.
Das Spektrum der Themen ist breit. Auf experimenteller Seite wird sowohl am Large Hadron Collider des CERN in Genf mitgearbeitet, der im März mit bisher unerreichter Energie wieder in Betrieb gehen soll, als auch mit ultrakalten Neutronen bei extrem niedrigen Energien nach neuer Physik gesucht. Andere Forschungsthemen sind eher theoretischer Natur und beschäftigen sich mit Teilchen-Wechselwirkungen bei extremen Bedingungen oder mit der Quantenstruktur der Raumzeit.
In der modernen Teilchenphysik trifft sich das Allerkleinste mit dem Allergrößten. Um zu verstehen, wie das Universum entstanden ist, wie es sich verhält und warum es seine astronomisch großen Strukturen ausgebildet hat, muss man die Naturgesetze auf den kleinsten Skalen verstehen. Deshalb spielen hier sowohl Messdaten aus Teilchenbeschleunigern genauso eine Rolle wie die Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung.
Prominente Vortragende
Wer sich für Teilchenphysik interessiert oder vielleicht sogar überlegt, selbst eines Tages Forschung in dieser Richtung zu betreiben, ist eingeladen am 10. März um 14:00 im Kuppelsaal der TU Wien prominenten Vortragenden zu lauschen. Zunächst wird Prof. Anton Zeilinger einen Vortrag über Quantenverschränkung halten, danach wird Prof. John Ellis über die Suche nach dem Higgs-Teilchen und darüber hinaus erzählen.
Finanziert wird das neue Doktoratskolleg vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF – auch die FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund gehört zu den Ehrengästen bei der Eröffnung.
Inauguration Ceremony “Particles and Interactions”
Prof. Anton Zeilinger:
Quantum Entanglement: From Einstein via John Bell at CERN to Quantum Information
Prof. John Ellis:
The Long Road to the Higgs Boson and Beyond
The discovery of a Higgs boson was a milestone in our fundamental description of matter. Postulated theoretically in 1964 and the object of major experimental searches at CERN‘s LHC, this particle is vital evidence how other particles acquire their masses. However, there are many open questions in fundamental physics, such as the nature of astrophysical dark matter and the origin of matter itself. Future experiments at the LHC and other accelerators aim at answering these questions.
Das Doktoratskolleg online: www.dkpi.at
Rückfragehinweis:
Prof. Anton Rebhan
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
florian.aigner@tuwien.ac.at
[1]: Simulated particle trajectories © CERN
Ein Swimmingpool im Seminarraum - neuer Boden im SEM-136
Unser alter Teppichboden hatte ausgedient, ab heute zieren TU-blaue Linoleumbahnen den Boden unseres frisch ausgemalten Seminarraums. In den letzten Tagen vor Beginn des Sommersemesters 2015 hat sich im DB10 so einiges abgespielt.
Freitag, 20.2.:
Ausräumen der Kästen. Aufteilung unserer historischen Schätze auf die Destinationen „Archiv 3. Stock“, „TU-Archiv“, „Entsorgung“ und „Später-wieder-zurück-in-den-Seminarraum“. Wow, jede Menge Kisten.
Montag, 23.2.:
Abtransport der Kästen. Überall steht etwas auf dem Gang. Kaum zu glauben, dass all das plus 14 Tische und 70 Sessel in unserem Seminarraum waren.
Dienstag, 24.2.:
Direkt nach der Brandschutzunterweisung Abholung aller Sessel und Tische. Beginn der Abbrucharbeiten. Und siehe da, unter dem Spannteppich ist noch eine Schicht Linoleumfliesen. Nichts wie raus mit all den archäologischen Schichten samt Kleber.
Mittwoch, 25.2.:
Entfernung aller Kleberreste und Aufbringung der Ausgleichsmasse. Dann heißt es trocknen lassen.
Donnerstag, 26.2.:
Ausrichten und Aufkleben unseres neuen Bodens – wirklich gekonnt. Erstaunlich mit wie wenig Kleber man auskommen kann. Unser Boden ist fast so schön wie ein blauer Swimmingpool. Und natürlich brauchen wir Sesselleisten.
Freitag, 27.2.:
Nur noch die Nähte verklebt und schon verleiht der TU-blaue Boden unserem Seminarraum neuen Glanz. Eigentlich wäre Ausmalen auch eine sehr gute Idee – unser Herr Architekt Tamarstin macht es möglich.
Montag, 2.3.:
Das Abdecken und Abkleben dauert mindestens so lange wie der neue Farbauftrag.
Dienstag, 3.3.:
Einmal Bodenreinigung – jetzt ist er schon fast kitschig schön in unserem frisch ausgemalten Seminarraum.
Dann wieder alle Möbel hinein, so schnell, dass sogar das Foto unscharf geworden ist. Nach der Reinigung werden alle Schätze wieder eingeräumt – und schon kann das neue Sommersemester beginnen.
Jetzt brauchen nur noch die Garderoben in unserem Seminarraum eine kleine Überholung. Die G.U.T. ist schon beauftragt.
Ein großes und herzliches Dankeschön allen Helferinnen und Helfern bei dieser ersten großen Aufräum- und Umbauaktion des Jahres 2015!
Als nächstes stehen die Kästen in unserem Faxraum und die Möbellieferungen im dritten und im zehnten Stock an. Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen. Mehr Info bei Heike Höller, Simone Krüger und Sylvia Riedler.
Bildernachweis:
Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien
Feuer aus!
Am 24. Februar 2015 hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Brand- und Katastrophenschutz-Unterweisung durch die G.U.T. die Gelegenheit, ihr Wissen über Brandschutz und das richtige Verhalten im Ernstfall aufzufrischen.
Ruhe bewahren!
Alarmieren
(andere im Bereich, Druckknopfmelder, Feuerwehr: 122, Portierloge: (90) 44 44),
Wo? Was? Wer/wieviele sind verletzt? Wer ruft an?
Retten
(sich selbst und andere, Fenster und Türen schließen, Keile entfernen, das Haus verlassen, Aufzug nicht benützen, am Sammelplatz bleiben)
Löschen
(Feuerlöscher, ohne Selbstgefährdung, Feuerwehr einweisen)
Übung macht Meister – und so konnten wir selbst Feuerlöscher ausprobieren.
Bildernachweis:
Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien
Sicherheitsvertrauensperson:
Sylvia Riedler
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: sylvia.riedler [at] tuwien.ac.at
Georg Kastlunger erhält das Stipendium der Monatshefte für Chemie 2014
Das begehrte Stipendium, gesponsert von der Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft Österreichischer Chemiker und dem Springer Verlag, geht an ein Mitglied des Instituts für theoretische Physik der TU Wien.
Transportmechanismen in molekularen Kontakten
Georg Kastlunger
Georg Kastlunger wird vom Stipendium der Monatshefte für Chemie im kommenden Jahr beim Abschluss seiner Dissertation mit dem Titel "Theory of charge transport through single redox-active transition metal complexes" unterstützt werden. In seiner von Robert Stadler betreuten Doktorarbeit geht es um die theoretische Beschreibung von Ladungstransport im Nanomaßstab. Die Arbeit wird in Zusammenarbeit mit IBM Zürich und dem Imperial College London durchgeführt.
Minituarisierung und wandelbare Moleküle
Georg Kastlunger über seine Doktorarbeit: “Für die fortschreitende Miniaturisierung auf dem Gebiet der Elektronik ergibt sich naturgemäß eine Grenze bei der Annäherung an die Nanowelt. Ein Grund dafür ist, dass Bauteile basierend auf Silizium in einer Größenordnung von einzelnen Nanometern nicht exakt reproduzierbar sind. Durch chemische Synthese erzeugte Moleküle lösen dieses Problem und besitzen zusätzlich die Fähigkeit passiver (Dioden) und aktiver (Schalter, Transistoren) elektronischer Funktionalität. So können Konfigurationsänderungen oder eine Änderung des Redoxzustandes im Molekül verwendet werden, um zwischen stark und schwach leitenden Zuständen zu schalten. Eine besonders vielversprechende Molekülklasse in diesem Zusammenhang sind Übergangsmetallkomplexe, da sich durch die Fähigkeit des Zentralatoms, mehrere Ladungszustände einzunehmen, implizit die Eignung dieser als molekulare Schalter und Transistoren ergibt.“
Verschiedene Wege führen nach Rom
Die Zielsetzungen der Dissertation sind eine Beschreibung der Parameter einer elektronischen Komponente, die einen Übergangsmetallkomplex enthält, und eine Erklärung von gemessenen Strom-Spannungs-Charakteristika auf der Basis von ab initio Simulationen auf Basis der Dichtefunktionaltheorie (DFT).In Zürich und London werden zwei experimentelle Routen im Rahmen der Dissertation analysiert. Georg Kastlunger: „Das Setup, welches bei IBM Zuerich verwendet wird, basiert auf einer mechanisch kontrollierten “Break junction” (MCBJ) im Hochvakuum, wobei vor allem die Art und Stärke der Ankopplung verschiedener Moleküle an die Elektroden und eine implizite aktive Funktionalität dieser theoretisch untersucht wird. Am Imperial College London werden Messungen mithilfe eines elektrochemischen Rastertunnelmikroskops (STM) durchgeführt. Die theoretische Herausforderung dabei besteht in der Beschreibung des Effekts des Lösungsmittels und einer möglichen dritten (“Gate”) Elektrode. Weiters wird in diesem experimentellen Zusammenhang ein Übergang zwischen direktem (kohärentem) und schrittweisem (hopping) Elektronentransport in Abhängigkeit von der Länge der molekulare Brücke zwischen den Elektroden auf Basis von DFT beschrieben. Die Berechnungen der Simulationen werden am Vienna Scientific Cluster (VSC) in Wien durchgeführt.“
Bildernachweis:
Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien
Rückfragehinweis:
Georg Kastlunger
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: georg.kastlunger [at] tuwien.ac.at
Elektronen-Wettrennen: Die kürzeste Sprintstrecke der Welt
Mit Laserpulsen lässt sich die Bewegung von Elektronen in Metall nun mit Attosekunden-Präzision untersuchen. Damit kann man elektronische Effekte verstehen – und vielleicht auch verbessern.
Ein Laserstrahl dringt in eine Struktur ein, die aus zwei verschiedenen Metallen besteht. In beiden Metallen können Elektronen aus ihrem Platz gelöst werden und sich nach außen (oben) bewegen. Die Dynamik dieses Vorgangs kann mit Attosekunden-Präzision gemessen werden.
Elektrischen Strom zu messen ist einfach. Die einzelnen Elektronen zu beobachten, aus denen dieser Strom besteht, ist allerdings äußerst schwierig. Mit einer Geschwindigkeit von mehreren Millionen Metern pro Sekunde rasen die Elektronen durch das Material, und die Distanzen, die sie zwischen zwei benachbarten Atomen zurückzulegen haben, sind äußerst kurz. Dementsprechend muss man winzige Zeitintervalle auflösen können, um den Sprint der Elektronen durchs Material zu studieren. Durch Messungen in Garching (Deutschland) und theoretische Berechnungen der TU Wien ist das nun gelungen. Wie sich zeigt, unterscheidet sich die Bewegung der Elektronen in einem Metall gar nicht besonders stark von der ballistischen Bewegung im freien Raum. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse nun im Journal „Nature“.
Die winzigen Zeitskalen der Quantenwelt
Der sogenannte „photoelektrische Effekt“ wurde bereits 1905 von Albert Einstein erklärt: Licht überträgt Energie auf ein Elektron, das dabei aus dem Material herausgelöst wird. Das geschieht so schnell, dass es lange Zeit völlig unmöglich erschien, den zeitlichen Ablauf dieses Effektes zu untersuchen. In den letzten Jahren hat sich allerdings das Forschungsgebiet der Attosekundenphysik deutlich weiterentwickelt, sodass man heute solche quantenphysikalischen Prozesse tatsächlich zeitaufgelöst analysieren kann.
Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde (10-18 Sekunden). So lange braucht das Licht ungefähr, um in einem Metall den Weg von einem Atom zum nächsten zurückzulegen. Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse kann man heute Messgenauigkeiten in Attosekunden-Größenordnung erreichen.
Die nun veröffentlichten Daten wurden am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching gemessen. Am Experiment beteiligt waren auch die TU München, das Fritz-Haber-Institut in Berlin, das Max-Planck-Institut für die Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg und die LMU München. An der TU Wien wurden dazu die theoretische Modelle und Computersimulationen entwickelt, um die experimentellen Ergebnisse präzise interpretieren zu können.
Wettlauf der Elektronen
„Im Experiment untersucht man ein Wettrennen der Elektronen“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Zwei verschiedene Metalle – Wolfram und Magnesium – werden aufeinandergestapelt und mit einem Laserpuls beschossen. Das Laserlicht kann nun entweder außen im Magnesium oder darunter im Wolfram Elektronen herauslösen, die dann nach kurzer Zeit den Weg an die Oberfläche finden. Nicht mal einen Nanometer legen die Elektronen dabei normalerweise zurück, und trotzdem kann man messen, mit welchem Vorsprung die Elektronen aus dem Magnesium vor den Elektronen aus der Wolfram-Schicht an der Oberfläche ankommen.
Die Länge der Elektronen-Sprintstrecke kann variiert werden: Zwischen einer und fünf Atomlagen Magnesium wurde auf das Wolfram aufgedampft. „Je dicker die Magnesium-Schicht ist, umso größer ist der mittlere zeitliche Vorsprung der Elektronen, die dort herausgelöst werden, gegenüber den Elektronen aus der Wolfram-Schicht“, sagt Christoph Lemell (TU Wien). Der einfache Zusammenhang zwischen Schichtdicke und Ankunftszeit zeigt, dass sich die Elektronen recht ungestört und geradlinig („ballistisch“) durch das Metall bewegen und es nicht zu komplexeren Stoßprozessen kommt.
Scharf gezogene Ziellinie
Entscheidend für die Zeitmessung beim Elektronen-Sprint ist eine wohldefinierte Ziellinie. Dafür wurde im Experiment ein weiterer Laserpuls auf die Metall-Oberfläche geschossen – und zwar so, dass er die aus dem Metall austretenden Elektronen beeinflusst, aber nicht ins Innere des Metalls eindringt. „Innerhalb eines Bereichs der kürzer ist als der Abstand zwischen zwei Metall-Atomen ändert sich die Intensität dieses Laserfeldes ganz extrem“, erklärt Georg Wachter (TU Wien). Schon in der äußersten atomaren Schicht des Metalls wird das Feld praktisch auf null reduziert, unmittelbar oberhalb der Metalloberfläche hingegen geraten die austretenden Elektronen sofort in ein starkes Laserfeld. Erst durch die Schärfe dieses Übergangs wird die präzise Messung möglich.
Die neuen Erkenntnisse sollen bei der weiteren Miniaturisierung von elektronischen und photonischen Bauteilen helfen – und sie sind ein weiterer Beweis für die erstaunlichen Möglichkeiten der Attosekundenphysik, durch deren Techniken atomare Phänomene immer besser studiert werden können. „Dieser Forschungsbereich könnte ganz neue Türen öffnen, neue Methoden für die Quantentechnologie liefern und uns helfen, grundlegende Fragen der Materialwissenschaft und Elektronik zu verstehen“, sagt Joachim Burgdörfer.
Graphikdownload: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Publikation "Nature":
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7534/full/nature14094.html
Rückfragehinweise:
Prof. Christoph Lemell
Institut für Theoretische Physik
christoph.lemell@tuwien.ac.at
Dr. Georg Wachter
Institut für Theoretische Physik
georg.wachter@tuwien.ac.at
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T.: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Jakob Salzer erhält ÖPG-Studierendenpreis
Jakob Salzer
Jakob Salzer erhält den Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit 2014. Seine Arbeit, die unter der Anleitung von Ass. Prof. Daniel Grumiller erstellt wurde, trägt den Titel „The Cosmological Constant as a Thermodynamical Variable in 2d Dilaton Gravity“. Darin beschäftigte er sich mit der Thermodynamik Schwarzer Löcher in einem bestimmten Gravitationsmodell in Anwesenheit einer veränderlichen kosmologischen Konstante.
Thermodynamik und Schwarze Löcher
In mehreren bahnbrechenden Arbeiten zeigten Stephen Hawking und Jacob Bekenstein in den siebziger Jahren, dass bestimmten Raumzeiten – im Besonderen auch Schwarze Löcher – Temperatur und Entropie zugeordnet werden können. Schwarze Löcher folgen also den üblichen Gesetzen der Thermodynamik, die auch das Verhalten gewöhnlicher makroskopischer Systeme bestimmen, z.B.: Wärme fließt vom wärmeren Körper zum kälteren. Bei makroskopischen Objekten jedoch lassen sich die Gesetze der Thermodynamik aus dem kollektiven Verhalten einer großen Anzahl von mikroskopischen Konstituenten (Atome, Moleküle) herleiten, was nahelegt, dass Ähnliches auch für Schwarze Löcher möglich sein sollte. Die Identifizierung dieser mikroskopischen Freiheitsgrade und das damit verbundene Problem einer konsistenten Quantentheorie der Gravitation ist jedoch noch immer Gegenstand intensivster Forschungsbemühungen.
Gravitation in 2 Dimensionen: ein toy-model für die Allgemeine Relativitätstheorie
Jakob Salzer beschreibt die Motivation hinter seiner Masterarbeit so: ”Die Behandlung grundlegender Fragen zu Schwarzen Löchern ist im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie oft erschwert durch das Zusammenspiel von Problemen technischer und konzeptueller Natur. In solchen Fällen ist es oft zielführender, vereinfachte Theorien - so genannte ‘toy-models' - zu betrachten, in denen konzeptuelle Fragen untersucht werden können, während Probleme technischer Natur auf ein Minimum reduziert sind. Ein beliebtes ‘toy-model' für die Allgemeine Relativitätstheorie ist zwei-dimensionale (2d) Dilaton- Gravitation.”
In dieser Gravitationstheorie untersuchte Jakob Salzer das thermodynamische Verhalten Schwarzer Löcher bei Anwesenheit einer veränderlichen kosmologischen Konstante.
Auch in seiner Dissertation beschäftigt sich Jakob Salzer mit Aspekten der Thermodynamik Schwarzer Löcher im Rahmen der 2d Dilaton Gravitation.
Rückfragehinweis:
Jakob Salzer
Institut für Theoretische Physik
T.: +43 (1) 58801-13622
jakob.salzer@tuwien.ac.at
Max Riegler erhält DOC Stipendium
Eines der begehrten DOC Stipendien der Akademie der Wissenschaften geht an ein Mitglied des Instituts für Theoretische Physik an der TU Wien.
Max Riegler
Nach dem Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit im Jahr 2013 konnte Max Riegler 2014 die international besetzte Gutachterkommission des Doktorand(inn)enprogramms der ÖAW von sich und seinem Forschungsschwerpunkt überzeugen. Im Rahmen seiner Dissertation mit dem Titel "Higher-Spin Holography in 2+1 Dimensions" wird Max Riegler von einem der prestigeträchtigen DOC Stipendien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die kommenden 2 Jahre unterstützt werden.
Schematische Darstellung der Berechnung von holographischer Verschänkungsentropie. Die Verschränkungsentropie zwischen den Gebieten A und B ist proportional zur Fläche der Oberfläche F, deren Rand das Gebiet A begrenzt.
Das holographische Prinzip in höheren Dimensionen
Max Riegler arbeitet unter der Anleitung von Associate Prof. Daniel Grumiller an seiner Dissertation, in der er sich im Wesentlichen mit dem so genannten "holographischen Prinzip" auseinandersetzt. Max Riegler, der im Moment einen viermonatigen Forschungsaufenthalt an der Kyoto Universität in Japan absolviert, beschreibt das Thema seiner Dissertation folgendermaßen:
„Im Wesentlichen beschäftige ich mich im Rahmen meiner Dissertation mit der Frage nach einem besseren Verständnis einer möglichen Theorie der Quantengravitation, die Gravitation auf sehr kleinen Längenskalen oder alternativ bei sehr großen Energien, bzw. Massen, korrekt beschreibt. Das so genannte "holographische Prinzip" ist eine Möglichkeit, um einem besseren Verständniss dieses Problems näher zu kommen. Dieses Prinzip besagt, dass man eine Theorie, die Gravitation beschreibt, auch zur Beschreibung einer Quantentheorie nutzen kann, die allerdings eine Dimension weniger besitzt als die Gravitationstheorie. Umgekehrt funktioniert es ebenso.
Besonders interessant ist die Frage, wie dieses holographische Prinzip für Gravitationstheorien funktioniert, die mehr Symmetrie aufweisen als sonst üblich. Im holographischen Kontext kann man diese zusätzlichen Symmetrien als Objekte mit "höherem spin" (mehr als spin=2) auffassen, daher der Name "Higher-Spin".
Von speziellem Interesse für meine Forschungsarbeit ist es im Moment, mich mit Verschränkungsentropie, einem Maß für die Verschränkung von
Quantensystemen, auseinanderzusetzen. Insbesondere Raumzeiten, welche keine Krümmung aufweisen sind ein sehr interessantes Betätigungsfeld für meine Forschung. Besonders reizvoll sind in diesem Zusammenhang auch geometrische Zusammenhänge, die helfen, Theorien mit höherem Spin besser zu verstehen.“
Bildernachweis:
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei
Rückfragehinweis:
Max Riegler
Institut für Theoretische Physik
T.: +43 (1) 58801-13622
rieglerm@hep.itp.tuwien.ac.at
Teilchen, Wellen und Ameisen
Tiere, die nach Futter suchen, oder Elektronen, die sich durch Metall bewegen: Zwischen verblüffend unterschiedlichen Phänomenen wurden an der TU Wien überraschende Gemeinsamkeiten gefunden.
Ameisen und Wellen - gibt es da Ähnlichkeiten? [1]
Werden Teilchen oft gestreut, entstehen komplizierte Wege ...
... werden Teilchen seltener gestreut, ist die Eindringtiefe größer, der durchschnittliche Weg, den die eingedrungenen Teilchen zurücklegen, ist jedoch gleich lang.
Eine Welle dringt in einen Bereich mit vielen Störstellen ein.
Eine Welle dringt in einen Bereich mit wenigen Störstellen ein.
Ein Betrunkener torkelt ziellos auf einen Platz, auf dem Straßenlaternen stehen. Ab und zu wird er an eine Laterne stoßen, seine Richtung ändern müssen und weitertorkeln. Hängt seine Verweildauer auf diesem Platz von der Anzahl der Straßenlaternen pro Fläche ab? Die überraschende Antwort ist: Nein.
Egal ob auf jedem Quadratmeter eine Straßenlaterne im Weg steht, oder ob die Abstände zwischen ihnen groß sind – der Betrunkene braucht auf seiner zufälligen Wanderung vom Betreten bis zum Verlassen des Platzes im Durchschnitt immer gleich lange. Berechnungen der TU Wien zeigen nun, dass diese Konstanz der Verweildauer ein universelles Phänomen ist. Transportphänomene aus ganz unterschiedlichen Bereichen lassen sich so erklären – von der Wanderung von Ameisen bis zu Lichtwellen, die ihren Weg durch diffuses Milchglas suchen.
Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit Forschungteams aus Frankreich erarbeitet (Institut Langevin und Laboratoire Kastler-Brossel, Paris) und wurden nun im Fachjournal PNAS veröffentlicht.
Und wenn ich auch wanderte im finsteren Glas …
Prof. Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) untersucht mit seinem Team, wie sich Wellen in einem ungeordneten Medium ausbreiten. Das können Lichtwellen sein, die durch eine getönte Fensterscheibe dringen, oder auch Quantenteilchen, die sich wellenartig durch ein Material mit einzelnen Störstellen bewegen.
„Solche Transportphänomene charakterisiert man normalerweise mit Hilfe der sogenannten mittleren freien Weglänge“, erklärt Rotter. Das ist die Strecke, die sich eine Welle oder ein Teilchen typischerweise frei bewegen kann, bis sie auf das nächste Hindernis trifft – also der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Straßenlaternen im Fall des torkelnden Wanderers, oder die Distanz zwischen zwei mikroskopischen Partikeln im Glas, an denen eine Lichtwelle gestreut wird.
Die Verweildauer ist immer gleich
Von dieser mittleren freien Weglänge hängen viele wichtige physikalische Größen ab – zum Beispiel legt sie fest, welcher Anteil des Lichts von einer trüben Glasscheibe durchgelassen wird. „Man kann auch berechnen, wie viel Zeit der durchgelassene und der reflektierte Anteil des Lichts jeweils im Glas verbringen. Auch diese Größen, die sogenannte Transmissionszeit und die Reflektionszeit, hängen stark von der mittleren freien Weglänge ab“, erklärt Philipp Ambichl, Doktorand in der Gruppe Rotter und Ko-Autor der Studie.
Betrachtet man diese beiden Anteile aber gemeinsam um insgesamt die durchschnittliche Verweildauer des Lichts im Glas zu berechnen, dann heben sich diese Abhängigkeiten auf. Im Ergebnis kommt die freie Weglänge nicht mehr vor. Licht hält sich also in einer sehr trüben Glasplatte genauso lange auf wie in einer beinahe durchsichtigen.
Beim Betrunkenen und den Straßenlaternen ist es genauso: Stehen viele Laternen im Weg, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich zu Beginn irgendwo anstößt, gleich umkehrt und gar nicht weit in den Platz vordringt – dann ist die Aufenthaltsdauer klein. Wege, die ihn auf die andere Seite des Platzes führen, dauern umso länger, je mehr Straßenlaternen es gibt. Insgesamt heben sich die beiden Effekte auf, sodass die zu erwartende Verweildauer auf dem Platz immer gleich ist.
„Verblüffend ist, dass diese Erkenntnis auf ganz unterschiedliche Systeme zutrifft“, sagt Philipp Ambichl. „Sie trifft etwa auf Kugeln zu, die man über ein Brett rollen lässt, in dem zufällig verteilte Nägel eingeschlagen sind. Es gilt aber auch für Elektronen-Wellen, die sich durch ein ungeordnetes Material bewegen, wo das Elektron zum Beispiel an einzelnen Atomen gestreut wird.“
Sogar in der Biologie lässt sich das Phänomen beobachten: Wenn Ameisen über eine Fläche spazieren, kann man das auch als Zufalls-Wanderung beschreiben und mathematisch abschätzen, wie lange sie auf dieser Fläche verweilen werden. Eine große Ameise braucht für die Reise weniger Schritte als eine kleine, die kleinere Ameise hat daher viel öfter die Möglichkeit, ihre Richtung zu ändern. Trotzdem ist die Verweildauer für beide Ameisen gleich, sie hängt nur von der Größe des betrachteten Areals ab.
„In der Gesamt-Verweildauer haben wir eine feste Größe identifiziert, die von der mittleren freien Weglänge gänzlich unabhängig ist. Dieses erstaunliche Resultat wird uns helfen ganz unterschiedliche Transportphänomene besser zu verstehen die etwa auch in ganz konkreten Anwendungen wie Solarzellen auftreten“, sagt Stefan Rotter. Egal ob Teilchen, Wellen oder Ameisen – vom Studium eines Transportprozesses kann man auch etwas über scheinbar völlig anders gelagerte Vorgänge lernen.
Der Fachartikel wird diese Woche im Journal "PNAS" publiziert. Eine frei zugängliche Vorversion finden Sie hier:
http://arxiv.org/abs/1409.7229
Bildernachweis:
[1] Bild:Fir0002/Flagstaffotos, GNU Free Documentation Licence 1.2
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13618
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Laserpulse und Materie: IMPRS-APS-Meeting in Wien
Die TU Wien kooperiert mit den Max-Planck-Zentren bei der Erforschung ultrakurzer Laserpulse und ihrer Auswirkungen. Von 24. bis 26.11. wird das Thema in einer Vortragsreihe vorgestellt.
Laserpulse und Materie
Den kürzesten und schnellsten Vorgängen, die es in der Natur gibt, versucht man mit Laserpulsen auf die Spur zu kommen. Auf der Zeitskala von Femto- und Attosekunden lassen sich chemische und quantenphysikalische Phänomene beobachten. Die TU Wien kooperiert mit der deutschen Max-Planck-Gesellschaft und ist an der Max-Planck-Research School of Advanced Photon Science (IMPRS-APS) beteiligt. Das Jahrestreffen findet diesmal in Wien statt. Dabei wird es zahlreiche Vorträge über dieses Forschungsgebiet zu hören geben – die meisten davon werden die Doktorandinnen selbst halten. Studierende, die sich einen Eindruck von diesem spannenden Forschungsgebiet verschaffen wollen, sind herzlich eingeladen.
Einblick in internationale Top-Forschung
Gleich zwei Forschungsgruppen der TU Wien aus zwei unterschiedlichen Fakultäten sind Teil der Research School: Das Team von Prof. Joachim Burgdörfer (Institut für Theoretische Physik) und jenes von Prof. Karl Unterrainer (Institut für Photonik, Fakultät für Elektrotechnik). Die zahlreichen Doktorandinnen und Doktoranden der TU Wien, die in den vergangenen Jahren Teil des IMPRS-APS waren, haben davon sehr profitiert: „Diese Research School bietet die Möglichkeit, schon früh internationale Kontakte zu weltweit führenden Forschungsgruppen zu knüpfen. Für eine wissenschaftliche Karriere ist das äußerst nützlich“, sagt Joachim Burgdörfer.
Von Montag, dem 24.11. bis Mittwoch, 26.11., findet die IMPRS-APS-Tagung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Theatersaal, Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien) statt. Wer einen Einblick in die aktuelle Attosekunden-Forschung und die Wechselwirkung ultrakurzer Lichtpulse mit Materie erhalten möchte, ist herzlich eingeladen, die Vorträge zu besuchen.
Detailliertes Programm:
http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/tuwien/fotos/news/IMPRS_Annual_Vienna2014_Program_2.pdf
Gewinnen durch Verlust
Ein scheinbar widersinniges Verhalten von Lasern, das an der TU Wien vorhergesagt worden war, konnte nun in einem neuen Experiment bestätigt werden, wie das Fachjournal „Science“ berichtet.
Zwei kreisförmige Raman-Laser werden aneinander gekoppelt und durch eine Licht-Faser mit Energie versorgt (sh. gelbe Linie). [1]
Fügt man einem der beiden Laser Verluste zu, wie durch den absorbierenden Streuer rechts, beginnt das gekoppelte System zu lasen und emittiert einen kohärenten Lichtstrahl (sh. rote Linie). [1]
Matthias Liertzer (l) und Stefan Rotter (r)
Was zunächst wie eine mathematische Kuriosität aussah ist nun zur neuen Laser-Technologie geworden. Vor zwei Jahren wurde von Physikern der TU Wien ein paradoxer Laser-Effekt vorhergesagt: In bestimmten Situationen kann man einen Laser einschalten, indem man ihm nicht mehr Energie zuführt, sondern ihm stattdessen Energie entnimmt. Erste experimentelle Anzeichen für diesen Effekt wurden vor kurzem an der TU gefunden; nun konnte der paradoxe Laser-Effekt in Zusammenarbeit mit Teams von der Washington University in St. Louis, USA und von RIKEN, Japan auf ein weiteres Laser-System übertragen und dort präzise vermessen werden. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Science“ veröffentlicht.
Einschalten durch Ausschalten
Matthias Liertzer und Prof. Stefan Rotter stießen zunächst in Computersimulationen auf den Effekt: „Wenn man zwei kleine, gleichartig gebaute Laser in engen Kontakt zueinander bringt, dann können sich diese auf eine Weise beeinflussen, die auf den ersten Blick jeder Erwartung widerspricht“, erklärt Stefan Rotter. „Normalerweise leuchtet ein Laser, wenn man ihm mehr Energie zuführt. Doch bei geeigneter Laser-Kopplung kann eine Energiezufuhr die beiden Laser abschalten und ein Energieverlust kann die Laser zum Leuchten bringen.“
In einem Laser werden Lichtteilchen vervielfältigt, es kommt zu einer Kettenreaktion die letztendlich kräftige Strahlung erzeugt. Normalerweise ist dabei jeder Lichtverlust höchst unerwünscht. Wenn zu viel Licht verlorengeht, etwa durch eine schlecht verspiegelte Außenwand des Lasers, dann kann die Lichtproduktions-Kettenreaktion nicht aufrecht erhalten werden und der Laser erlischt.
Paradoxes Verhalten am „Entartungspunkt“
„Die Eigenschaften der Laser kann man durch mathematische Gleichungssysteme sehr gut beschreiben und verstehen“, erklärt Matthias Liertzer. „Wenn man sich diese Gleichungen genau ansieht, mit denen auch die Kopplung zwischen zwei Lasern beschrieben wird, dann stellt man fest, dass hier sogenannte Entartungspunkte auftreten. Befindet sich der Zustand, der den Laser mathematisch charakterisiert, in der Umgebung eines solchen Entartungspunktes, dann zeigt sich paradoxes Verhalten.“
Im Experiment, das von Bo Peng und Dr. Sahin Kaya Ozdemir mit der Gruppe von Prof. Lan Yang in St. Louis, USA durchgeführt wurde, stellte man zwei winzige kreisförmige Laser her, die man in unmittelbarer Nähe zueinander platzierte. Zusätzlich wurde eine feine Spitze aus Chrom in das System eingebracht, die Licht stark absorbiert. Durch genaues Justieren der Spitze kann der Lichtverlust fein dosiert werden. „Die Experimente bestätigten unsere Vorhersagen: Wenn sich das System in der Nähe des Entartungspunktes befindet, führt die Absorption der Spitze dazu, dass sich der Laser einschaltet und zu leuchten beginnt“, sagt Stefan Rotter.
Die Besonderheiten solcher Entartungspunkte zu verstehen wird für ganz unterschiedliche technologische Anwendungen wichtig sein, glaubt Rotter: „Das kann für hochsensible Detektoren nützlich sein, oder für jedes andere System das aus gekoppelten Oszillatoren besteht, wie zum Beispiel in der Opto-Mechanik. Jedenfalls gibt es noch viele interessante Effekte, die man im Zusammenhang mit diesen Entartungspunkten studieren kann“, meint Stefan Rotter.
Originalartikel "Perspective Article" von Science:
http://www.sciencemag.org/content/346/6207/328.full
Bildernachweis:
[1]: J. Zhu, B. Peng, S.K. Ozdemir, L. Yang
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei
Rückfragehinweise:
Dipl.-Ing. Matthias Liertzer
Institut für Theoretische Physik
T.: +43-1-58801-13644
matthias@liertzer.at
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13618
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Laserpuls macht Glas zum Metall
Mit Laserpulsen kann man einem elektrisch isolierenden Material für winzige Sekundenbruchteile Eigenschaften eines Metalls verleihen - das zeigen Rechnungen der TU Wien. Damit könnte man Schaltungen bauen, die um Größenordnungen schneller getaktet sind als heutige Mikroelektronik.
Computersimulationen zeigen, wie Elektronen von einem Atom wegfließen und sich fortbewegen.
Georg Wachter (Bild) berechnet die Materialeigenschaften von Glas, beim Auftreffen von Laserpulsen.
Ein Laserpuls trifft ein Stück Quarzglas zwischen zwei Elektroden.
Quarzglas leitet keinen Strom, es ist ein klassisches Beispiel für einen elektrischen Isolator. Doch mit ultrakurzen Laserpulsen ist es möglich, innerhalb von Femtosekunden (eine fs entspricht 10 hoch -15 Sekunden) die elektronischen Eigenschaften von Glas völlig zu verändern. Ist der Laserpuls stark genug, können sich Elektronen im Material frei bewegen. Das Quarzglas verhält sich dann für einen winzigen Augenblick wie ein Metall, es leitet Strom und wird undurchsichtig. Dieser Wandel der Materialeigenschaften findet auf so kurzen Zeitskalen statt, dass man ihn für extrem schnelle lichtbasierte Elektronik nutzen könnte. Am Institut für Theoretische Physik der TU Wien konnte man diesen Effekt nun mit Hilfe von Computersimulationen erklären.
Wer kleine Dinge beobachten will, muss schnell sein
Ultrakurze Laserpulse mit einer Dauer im Bereich von wenigen Femtosekunden wurden in den letzten Jahren immer wieder dazu benutzt, quantenphysikalische Effekte in Atomen oder Molekülen zu untersuchen. Nun zeigt sich, dass solche Laserpulse auch dazu geeignet sind, Materialeigenschaften blitzschnell zu verändern. Im Experiment (am Max-Planck-Institut in Garching) hatte man festgestellt, dass elektrischer Strom durch Quarzglas fließt, während es vom Laserpuls getroffen wird. Nach dem Ende des Laserpulses kehrt das Material wieder in seinen Ausgangszustand zurück. Wie dieser merkwürdige Effekt genau abläuft, konnten Georg Wachter, Christoph Lemell und Prof. Joachim Burgdörfer von der TU Wien in Zusammenarbeit mit Forschern von der Tsukuba University in Japan nun erstmals berechnen.
Quantenphysikalisch betrachtet kann ein Elektron in einem Festkörper verschiedene Zustände einnehmen. Es gibt Zustände, in denen es fest an ein bestimmtes Atom gebunden ist, bei anderen Zuständen höherer Energie kann es sich zwischen den einzelnen Atomen frei bewegen. Das Elektron verhält sich ähnlich wie eine Kugel auf einer verbeulten Oberfläche: Wenn sie wenig Energie hat, bleibt sie in einem bestimmten Tal liegen. Verhilft man ihr mit einem kräftigen Kick zu mehr Energie, rollt sie frei herum.
„Der Laserpuls ist ein extrem starkes elektrisches Feld, das die Zustände der Elektronen im Quarz dramatisch verändert“, erklärt Georg Wachter. „Der Puls kann nicht nur Energie auf die Elektronen übertragen, er kann die gesamte Struktur der möglichen Elektronen-Zustände im Material verbiegen.“
Dadurch ist es möglich, dass ein Elektron, das sonst fest an ein Sauerstoff-Atom im Quarzglas gebunden ist, plötzlich zu einem anderen Atom überwechselt und sich ähnlich benimmt wie ein frei bewegliches Elektron in einem Metall. Hat es der Laserpuls erst einmal geschafft, Elektronen von den Atomen zu lösen, kann das elektrische Feld des Pulses die Elektronen gezielt in eine bestimmte Richtung treiben und Strom beginnt zu fließen. Bei sehr starken Laserpulsen hält dieser Stromfluss sogar noch für eine kurze Weile an, nachdem der Laserpuls schon wieder abgeklungen ist.
Mehrere Quanten-Prozesse auf einmal
„Die genaue Berechnung solcher Effekte ist sehr aufwändig, weil man viele Effekte gleichzeitig berücksichtigen muss“, sagt Prof. Burgdörfer. Die elektronische Struktur des Materials, die Wechselwirkung der Elektronen mit dem Laser, und auch die Wechselwirkung der Elektronen untereinander muss quantenphysikalisch berechnet werden - eine Aufgabe, die nur mit Supercomputern zu lösen ist. „In unserer Computersimulation können wir den zeitlichen Verlauf wie in Zeitlupe nachverfolgen und verstehen, was hier eigentlich geschieht“, erklärt Burgdörfer.
In den Transistoren, die heute verwendet werden, bewegen sich bei jedem Schaltvorgang eine große Zahl von Ladungsträgern bis sich ein neuer Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Dementsprechend braucht der Schaltvorgang eine gewisse Zeit. Beim vom Laserpuls ausgelösten blitzartigen Ändern der Materialeigenschaften ergibt sich eine neue Situation: der Schaltvorgang erfolgt durch die Änderung der Elektronenzustände und durch die Ionisation der Atome. „Das gehört zu den schnellsten Prozessen, die man in der Festkörperphysik kennt“, sagt Christoph Lemell. Transistoren arbeiten auf einer Zeitskala von einigen Pikosekunden (10 hoch -12 Sekunden), mit Laserpulsen kann man Ströme mehr als tausend mal schneller schalten.
Die Berechnungen zeigten, dass die Kristallstruktur und die chemischen Bindungen im Material einen überraschend großen Einfluss auf den ultraschnellen Stromfluss haben. Es sollen daher nun Experimente mit unterschiedlichen weiteren Materialen folgen, um den Effekt noch besser nutzen zu können.
Die Berechnungen wurden nun im Journal "Physical Review Letters" veröffentlicht (Originalpublikation (frei zugängliche Version)):Bildernachweis:
http://arxiv.org/abs/1401.4357
Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Rückfragehinweis:
Dipl.-Ing. Georg Wachter
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13630
georg.wachter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Eine Flüssigkeit, die nicht gefriert
Neuartige Makromoleküle zeigen völlig überraschende thermodynamische Eigenschaften. Ein Workshop versammelt die Soft-Matter-Community nun an der TU Wien.
Es ist nur eine Frage der Temperatur, irgendwann friert praktisch jede Flüssigkeit. Die einzige bisher bekannte Ausnahme ist das Edelgas Helium, das selbst am absoluten Nullpunkt flüssig bleibt. Doch Helium ist ein Sonderfall – es geht schließlich auch keine stabilen chemischen Verbindungen ein. Alle Substanzen, die atomare oder molekulare Netzwerke ausbilden, wie etwa Kohlenstoff, werden unterhalb einer bestimmten Temperatur fest. Neue Computeranalysen zeigen allerdings, dass es bei dieser Regel ein Schlupfloch gibt: Sogenannte „DNA-Nanosterne“ können Strukturen bilden, die selbst bei niedrigsten Temperaturen nicht zu einer geordneten Struktur gefrieren. Solche und ähnliche Phänomene stehen im Mittelpunkt eines von der TU Wien organisierten Workshops über Materialwissenschaft.
Ordnung hat weniger freie Energie
In einer Flüssigkeit bewegen sich Atome oder Moleküle völlig ungeordnet, in einem Festkörper ordnen sie sich nach einer regelmäßigen Struktur an. „Normalerweise stellt die geordnete Phase bei niedrigen Temperaturen den stabilen Aggregatszustand dar, weil die geordnete Struktur eine geringere freie Energie hat als die ungeordnete, flüssige Phase“, erklärt Prof. Gerhard Kahl (Institut für Theoretische Physik, TU Wien). Nun wurden allerdings von der Forschungsgruppe von Francesco Sciortino (Universität Rom, La Sapienzia) Computersimulationen präsentiert, die zeigen, dass die Sache auch anders aussehen kann.
Sogenannte „DNA-Nanosterne“ sind Makromoleküle, die aus vier speziell synthetisierten DNA-Doppelketten aufgebaut sind. Sie können ungeordnete Strukturen ausbilden, die selbst bei niedrigsten Temperaturen eine geringere freie Energie aufweisen als die konkurrierende geordnete Diamantstruktur. Solche Systeme können also selbst bei extrem niedrigen Temperaturen stabile ungeordnete Phasen ausbilden – energetisch ist es für solche Substanzen auch bei extremer Kälte günstiger, im flüssigen Zustand vorzuliegen und nicht zur Diamantstruktur zu erstarren.
„Die DNA-Nanosterne zeichnen sich durch eine große Flexibilität in ihren Armen aus“, sagt Gerhard Kahl. „Wie Sciortino und Mitarbeiter zeigen konnten, ist gerade diese Eigenschaft dafür verantwortlich, dass die ungeordnete Phase selbst bei tiefen Temperaturen eine niedrigere freie Energie erzielen kann als eine geordnete Kristallstruktur und somit thermodynamisch stabil ist.“ Bisher wurde diese Art von Makromolekülen nur am Computer untersucht, der experimentelle Nachweis steht noch aus.
TU-Workshop
Diese Klasse von Kolloide sind zentrales Thema eines Workshops, der vom 23. bis 26.9.2014 am Danube Center for Atomistic Simulations (DaCAM) an der TU Wien stattfindet. Theoretiker und Experimentalisten aus aller Welt diskutieren aktuelle neueste Entwicklungen auf diesem Gebiet. Organisiert wird diese Veranstaltung von Emanuela Bianchi, Gerhard Kahl (beide TU Wien), Christos N. Likos (Universitaet Wien) und eben Francesco Sciortino (Rom). DaCAM ist der Wiener Knoten des CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire), eines europaeischen Netzwerkes, das sich den Anwendungen und der Weiterentwicklung von atomaren und molekularen Simulationen in einem breiten Themenspektrum (von der Biologie bis zu den Materialwissenschaften) widmet.
Rückfragehinweis:
Dr. Emanuela Bianchi
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13631
emanuela.bianchi@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
"Cavity Protection Effect" macht Quanteninformation langlebig
Hybridsysteme aus Mikrowellenresonatoren und Atom-Spins in Diamant gelten als Hoffnungsträger für zukünftige Quantentechnologien. Durch einen neuartigen Trick gelang es Forschern an der TU Wien, die Speicherdauer in diesem System deutlich zu verbessern.
Das an der TU Wien verwendete Quantensystem: In der Mitte sitzt ein schwarzer Diamant mit Stickstoffatomen, sie koppeln an das Licht eines Mikrowellenresonators.
Das Team: Jörg Schmiedmayer, Johannes Majer, Stefan Putz, Dmitry Krimer und Stefan Rotter (v.l.n.r)
Die Elektronik in unseren Computern kennt nur zwei Zustände: entweder null oder eins. Quantensysteme hingegen können beliebige Überlagerungen von Zuständen annehmen – also null und eins gleichzeitig. Man hofft, basierend darauf in Zukunft superschnelle Quantencomputer bauen zu können, doch bis dahin sind noch schwierige technologische Probleme zu lösen. Insbesondere hat man damit zu kämpfen, dass gespeicherte Quantenzustände durch Wechselwirkungen mit der Umgebung extrem leicht zerstört werden. An der TU Wien ist es nun gelungen, einen speziellen Schutzeffekt zu nutzen, um die Stabilität eines besonders vielversprechenden Quantensystems deutlich zu erhöhen.
Ein Quantenrechner aus zwei Systemen
Es gibt heute ganz unterschiedliche Konzepte für die Speicherung von Quanteninformation. "Wir verwenden ein Hybridsystem aus zwei völlig verschiedenen Quantentechnologien", erklärt Johannes Majer vom Atominstitut der TU Wien. Gemeinsam mit seinem Team koppelt er Mikrowellen und Atome und arbeitet damit an der Verwirklichung eines Quantenspeichers. Die theoretischen Modelle dazu wurden von Dmitry Krimer und Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien entwickelt.
In einem Mikrowellenresonator werden Photonen erzeugt. Sie wechselwirken mit dem Spin von Stickstoffatomen, die in Diamant eingebaut sind. Der Mikrowellenresonator ermöglicht Quanteninformation schnell zu transportieren, die Atomspins im Diamant können diese speichern, zumindest für eine Zeitdauer von einigen hundert Nanosekunden. Das ist lange genug, verglichen mit der extrem kurzen Zeitskala, auf der sich Photonen im Mikrowellenresonator hin und her bewegen.
"Eigentlich sind alle Stickstoffatome zwar völlig gleich, aber wenn sie im Diamant jeweils in eine leicht unterschiedliche Umgebung platziert sind, dann haben sie auch leicht unterschiedliche Schwingungsfrequenzen", sagt Stefan Putz, Doktorand am Atominstitut. Die Atomspins verhalten sich dann wie ein Raum voller Pendeluhren mit leicht unterschiedlich langen Pendeln: Am Anfang schwingen sie ziemlich synchron, aber nachdem sie niemals völlig identisch sind, laufen sie nach einer gewissen Zeit aus dem Takt und übrig bleibt ein wildes Durcheinander.
Ordnung durch Kopplung
"Wenn die Energien der einzelnen Spins auf passende Weise verteilt sind, kann man durch eine starke Kopplung zwischen Atomspins und dem Mikrowellenresonator erreichen, dass die Spins viel länger im Gleichtakt schwingen", erklärt Dmitry Krimer. Die Atomspins haben zwar keinen direkten Einfluss aufeinander, aber die Tatsache, dass sie kollektiv stark an den Mikrowellenresonator gekoppelt sind, verhindert, dass der Quantenspeicher in Zustände übergeht, die für Quanteninformations-Übertragung nicht mehr genutzt werden können. Dieser Quanten-Schutzeffekt gegen den Zerfall der quantenmechanischen Eigenschaften des Systems verlängert die Zeitdauer, in der man Quanteninformation aus den Atomspins auslesen kann erheblich.
"Durch die Verbesserung der Quanten-Kohärenzzeit auf Basis dieses Cavity Protection Effekts eröffnen sich vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten für unsere hybriden Quantenspeicher", sagt Johannes Majer.
Die Arbeit wurde im Journal Nature Physics veröffentlicht:
http://www.nature.com/nphys/journal/v10/n10/full/nphys3050.html
Bildernachweis:
Quantensystem: (Abdruck honorarfrei, Copyright: Dieter Brasch für Terra Mater Magazin)
Team: Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Rückfragehinweis:
Dr. Johannes Majer
Atominstitut
T: +43-1-58801-141838
johannes.majer@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Neues Material ermöglicht ultradünne Solarzellen
An der TU Wien gelang es, zwei unterschiedliche Halbleitermaterialien zu kombinieren, die jeweils aus nur drei Atomlagen bestehen. Dadurch ergibt sich eine vielversprechende neue Struktur für Solarzellen.
Marco Furchi, Thomas Müller, Andreas Pospischil (v.l.n.r.)
Das Schichtsystem der Solarzelle: innen die beiden Halbleiter, darüber und darunter befinden sich elektrische Kontakte.
Durchsichtige, hauchdünne, biegsame Solarzellen könnten bald Wirklichkeit werden. An der TU Wien gelang es Thomas Müller und seinen Mitarbeitern Marco Furchi und Andreas Pospischil, eine neuartige Halbleiterstruktur aus zwei ultradünnen Atomschichten herzustellen, die sich ausgezeichnet für den Bau von Solarzellen eignet.
Schon vor einigen Monaten war es an der TU Wien gelungen, eine ultradünne Schicht des photoaktiven Kristalls Wolframdiselenid zu produzieren. Durch die erfolgreiche Kombination mit einer zweiten Schicht aus Molybdändisulfid entstand nun ein Material, das großflächig als Solarzelle einsetzbar ist. Das Forschungsteam erhofft sich, damit eine neue Solarzellentechnologie zu begründen.
Zweidimensionale Schichten
Ultradünne Materialien, die nur aus einer oder wenigen Atomlagen bestehen, sind in der Materialwissenschaft derzeit ein blühendes Hoffnungsgebiet. Begonnen hat es mit Graphen, das aus einer einzelnen Lage von Kohlenstoff-Atomen besteht. Wie auch zahlreiche andere Forschungsgruppen auf der Welt hat auch der Elektrotechniker Thomas Müller und sein Team am Institut für Photonik der TU Wien durch die Arbeit mit Graphen herausgefunden, wie man mit ultradünnen Schichten umgeht, sie bearbeitet und verbessert. Dieses Wissen lässt sich nun auch auf andere Materialien übertragen.
„Solche zweidimensionalen Kristalle haben oft völlig andere elektronische Eigenschaften als eine dickere, dreidimensionale Version desselben Materials“, erklärt Thomas Müller. Seinem Team gelang es ihm nun erstmals, zwei verschiedene ultradünne Halbleiterschichten aneinanderzufügen und ihre Eigenschaften zu untersuchen.
Zwei Schichten mit unterschiedlichen Aufgaben
Wolframdiselenid ist ein Halbleiter, der aus drei Atomschichten besteht. In der Mitte befindet sich eine Lage von Wolfram-Atomen, die oberhalb und unterhalb der Schicht durch Selen-Atome verbunden sind. „Dass Wolframdiselenid geeignet ist, elektrischen Strom aus Licht zu erzeugen, konnten wir bereits vor einigen Monaten zeigen“, sagt Thomas Müller. Allerdings müsste man beim Bau einer Solarzelle aus reinem Wolframdiselenid in Mikrometer-engen Abständen winzige Elektroden in das Material einbauen. Durch die Kombination mit einem weiteren Material (Molybdändisulfid, das ebenso aus drei Atomlagen besteht) ist das nun nicht mehr nötig. Somit lässt sich das Schichtsystem als großflächige Solarzelle einsetzen.
Wenn Licht auf ein photoaktives Material fällt, dann werden einzelne Elektronen von ihrem Platz gelöst. Übrig bleibt ein bewegliches Elektron und ein Loch an der Stelle, wo sich das Elektron vorher befunden hat. Sowohl das Elektron als auch das Loch kann im Material herumwandern, zum Stromfluss können beide allerdings nur dann beitragen, wenn sie voneinander getrennt werden, sodass sie sich nicht wieder miteinander vereinen.
Um diese Rekombination von negativ geladenen Elektronen mit positiv geladenen Löchern zu verhindern, kann man entweder Elektroden verwenden, über die man die Ladungsträger absaugt, oder man benutzt dafür eine zweite Materialschicht. „Die Löcher bewegen sich im Wolframdiselenid, die Elektronen hingegen wandern über das Molybdändisulfid ab“, sagt Thomas Müller. Damit ist die Rekombinations-Gefahr gebannt.
Um diesen Effekt zu ermöglichen, müssen die Energien der Elektronen in den beiden Schichten optimal angeglichen werden, was im Experiment durch ein elektrostatisches Feld geschieht. Florian Libisch und Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien konnten mit Computersimulationen berechnen, wie sich die Energie der Elektronen in den beiden Materialien ändert und bei welchen Spannungen eine optimale Ausbeute an elektrischer Leistung zu erwarten ist.
Atom an Atom: enger Kontakt durch Hitze
„Eine der größten technischen Herausforderungen war es, die beiden Materialien atomar flach aufeinander aufzubringen“, sagt Thomas Müller. „Wenn sich zwischen den beiden Schichten noch andere Moleküle verstecken, sodass kein direkter Kontakt gegeben ist, dann funktioniert die Solarzelle nicht.“ Gelungen ist dieses Kunststück schließlich, indem man beide Schichten zunächst in Vakuum ausheizte und dann in gewöhnlicher Atmosphäre zusammenfügte. Wasser zwischen den beiden Lagen konnte durch nochmaliges Ausheizen aus dem Schichtsystem entfernt werden.
Das neue Material lässt einen großen Teil des Lichts durch, der absorbierte Anteil wird in elektrische Energie umgewandelt. Man könnte es etwa auf Glasfassaden einsetzen, wo es Licht durchlassen und trotzdem Strom erzeugen würde. Weil es nur aus wenigen Atomlagen besteht, ist das Material extrem leicht (300 m2 des Films wiegen etwa ein Gramm) und sehr flexibel. Um eine höhere Energieausbeute auf Kosten reduzierter Transparenz zu erreichen arbeitet das Team gegenwärtig daran, mehr als zwei Schichten aufeinander zu stapeln.
Die Arbeit ist nun im Fachjournal „Nano Letters“ erschienen: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl501962c?
Frei zugängliche arxiv-Version: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1403/1403.2652.pdf
Rückfragehinweis:
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
burg@concord.itp.tuwien.ac.at
Prof. Thomas Müller
Institut für Photonik
Technische Universität Wien
thomas.mueller@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Zwei TU-Forscher im Direktorium der Jungen ÖAW-Kurie
Mit Thorsten Schumm und Daniel Grumiller ist die TU Wien im fünfköpfigen Direktorium der Jungen Kurie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nun doppelt vertreten.
Thorsten Schumm, Daniel Grumiller (v.l.n.r.)
Neben der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse und der philosophisch-historischen Klasse ist die Junge Kurie die dritte Säule der österreichsichen Akademie der Wissenschaften. Ihre Aufgabe ist es, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen, insbesondere mit solchen, die den wissenschaftlichen Nachwuchs betreffen. Die Junge Kurie hat 70 Mitglieder und wird von einem fünfköpfigen Direktorium geleitet. Thorsten Schumm vom Atominstitut und Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik wurden nun in das Direktorium gewählt.
Präzisionsuhren und das Universum
Thorsten Schumm beschäftigt sich in erster Linie mit Atom- und Kernphysik. So untersucht er etwa Anregungszustände von Thoriumkernen mit extrem niedriger Energie. Gelingt es, sie technologisch nutzbar zu machen, könnte man sie für Hochpräzisionsmessungen benutzen, etwa für Kern-Uhren, die noch deutlich präziser wären als Atom-Uhren. Thorsten Schumm ist START- und ERC-Preisträger.
Daniel Grumiller forscht an der Schnittstelle zwischen Quantenphysik, Gravitationsphysik und Kosmologie. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Physik Schwarzer Löcher und mit holographischen Beziehungen zwischen Gravitation und Teilchenphysik. Grumiller wurde mit einem europäischen Marie-Curie-Fellowship sowie mit dem START-Preis ausgezeichnet.
Webtipps:
http://www.thorium.at
http://quark.itp.tuwien.ac.at/~grumil/research.shtml
Neue Theorie ermöglicht Blick ins Innere der Erde
Unter extremem Druck kann es zu Phasenübergängen kommen, die sich mit herkömmlichen Methoden nicht berechnen lassen. Durch eine neue Theorie, entwickelt an der TU Wien und der Universität Wien, wird eine genauere Analyse seismischer Wellen und ein Einblick in die innersten Eigenschaften unserer Erde möglich.
In der Erde herrscht gewaltiger Druck - die Phasenübergänge, die sich dadurch ergeben, können nun endlich berechnet werden.
Computerberechnung der Valenzelektronendichte in Strontiumtitanat. Inset: Die Perovskit-Struktur
Oben: Andreas Tröster, Wilfried Schranz; unten: Peter Blaha, Ferenc Karsai (jeweils v.l.n.r)
Ins Innere unseres Planeten zu gelangen ist eine schwierige Aufgabe – das hat schon Jules Verne in seinem berühmten Roman "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" beschrieben. Auch heute noch können wir nur indirekt durch seismische Messungen Information über Struktur und Zusammensetzung der Erde gewinnen. Um solche Daten allerdings richtig interpretieren zu können, braucht man eine exakte Beschreibung der Materialien im Erdinneren. Einem Team von Wissenschaftlern der TU Wien und der Universität Wien unter Führung des theoretischen Physikers Andreas Tröster (TU Wien) gelang es nun mit Hilfe quantenphysikalischer Berechnungen, bestimmte Phasenübergänge, wie sie bei hohem Druck im Erdinneren stattfinden, mit bisher noch nie dagewesener Präzision zu beschreiben. Die neue Theorie wurde nun im Fachjournal „Physical Review X“ publiziert.
Hochdruckphasenübergänge geben Einblick ins Erdinnere
Das Innere unserer Erde ist bis heute noch nicht vollständig erforscht. Bekannt ist, dass rund 60 Prozent der Erde aus siliziumhaltigen Materialien – sogenannten Perowskit-Strukturen – bestehen, der mächtige untere Mantel sogar zu 93 Prozent. Diese Mineralien sind in der Erde einem enorm großen Druck ausgesetzt. Der im Zentrum herrschende Druck von 360 Giga-Pascal entspricht einem Gewicht von zehn Millionen Elefanten auf einer Fläche von einem Quadratmeter. "Dadurch kann es unter bestimmten Bedingungen zu Hochdruckphasenübergängen kommen, bei denen sich die innere Struktur der Mineralien ändert" erklärt Trösters einstiger Doktorvater, der Materialphysiker Wilfried Schranz von der Arbeitsgruppe "Physik Funktioneller Materialien" der Universität Wien.
Die Struktur des Erdkörpers wird untersucht, indem man seismische Wellen analysiert. Ihr Ausbreitungsverhalten wird durch die elastischen Eigenschaften der Materialien im Erdinneren festgelegt. "Diese elastischen Eigenschaften können sich in der Nähe von strukturellen Phasenübergängen als Funktion von Druck und Temperatur stark ändern", erklärt Schranz. „Bis heute gibt es aber leider keinen veröffentlichten experimentellen Datensatz zu den elastischen Eigenschaften der Materialien im Erdmantel bei realistischen Druck- und Temperaturbedingungen, geschweige denn von Materialien im tiefen Erdinneren." Man ist daher auf Berechnungen angewiesen.
Eine Erweiterung der Landau-Theorie
„Quantenmechanische ab-initio-Computersimulationen erlauben zwar die Berechnung von elastischen Eigenschaften von Materialien bis zu extremen Drücken, die Einbeziehung von Temperatureffekten ist dabei aber nur beschränkt möglich“, erklärt der theoretische Chemiker Peter Blaha. Phasenübergänge in Kristallen werden seit vielen Jahren mit Hilfe der „Landau-Theorie“ beschrieben. Sie erweist sich bei Drücken, mit denen wir normalerweise zu tun haben, als äußerst nützlich. „Bei hohem Druck kommt es aber zwangsläufig zu nichtlinearen Effekten, die man in der bisherigen Landau-Theorie vernachlässigen muss“, sagt Andreas Tröster. Das bedeutet zwar mathematisch eine enorme Vereinfachung, kann aber rasch zu Fehlern von sage und schreibe 100 Prozent führen. Einige Vorhersagen von Materialeigenschaften bei hohem Druck, die mit den bisher verwendeten Methoden berechneten wurden, müssen daher vermutlich auch einer gründlichen Revision unterzogen werden.
Lange wurde daher nach einer mathematisch konsistenten Erweiterung der Landau-Theorie auf Hochdruckphasenübergänge gesucht. „Uns gelang das nun mit Hilfe von Gruppentheorie, nichtlinearer Elastizitätstheorie und quantenmechanischen Dichtefunktionalberechnungen am Computer“, erklärt Tröster: „In dieser lange gesuchten Erweiterung der Landau-Theorie wird erstmals auch der bei hohen Drücken entscheidende nichtlineare Beitrag zur elastische Energie eines Kristalls mathematisch konsistent berücksichtigt.“
Um die neue Theorie zu testen, wandte man sie auf Strontiumtitanat an, einen Perowskit, dessen Eigenschaften bereits gut bekannt sind. „Anhand dieses Schlüssel-Materials konnten wir demonstrieren, dass unsere Theorie exzellent mit den gemessenen Daten übereinstimmt“, sagt Wilfried Schranz. Das zeigt, welch hohe Qualität bei der Beschreibung von Hochdruckphasenübergängen mit Hilfe von quantenmechanischen Dichtefunktionalberechnungen erreicht werden kann. „In Zukunft werden wir durch ein enges Zusammenspiel von experimenteller Arbeit, Computersimulationen und analytischer Theorie die gewonnenen Daten in große geophysikalische bzw. seismologische Modelle integrieren können. Damit werden wir zu einem immer besseren Verständnis des Aufbaus und der Eigenschaften unserer Erde gelangen", freut sich Andreas Tröster.
Publikation in "Physical Review X":
Andreas Tröster, Wilfried Schranz, Ferenc Karsai and Peter Blaha: "Fully consistent finite-strain Landau theory for high-pressure phase transitions", Phys. Rev. X (2014):
http://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.031010
PRX-Editorial dazu:
http://journals.aps.org/prx/edannounce/PhysRevX.4.030001
Rückfragehinweis:
Dr. Andreas Tröster
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
andreas.troester@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Der Computer kann auch nicht alles
Um Materialeigenschaften Atom für Atom verstehen zu können, braucht man nicht bloß Rechenpower, sondern auch neue kreative Ideen. Egal wie leistungsfähig ein Computer ist – in der Wissenschaft ist er niemals gut genug.
Der gelbe Bereich der Oberfläche hat einen stärkeren Einfluss auf das herannahende Molekül (blau), und muss anders in die Rechnung einbezogen werden als der Rest der Oberfläche (grau).
Florian Libisch
Wenn man mit einem neuen, schnelleren Modell nämlich endlich die Rechnungen durchführen kann, an denen das Vorgängermodell gescheitert ist, hat man sofort die nächste Idee für eine noch komplexere Rechnung. Besonders ausgeprägt ist dieses Problem in der Materialwissenschaft auf quantenmechanischem Niveau. Manche Rechenaufgaben kann man allerdings lösen, indem man nicht einfach immer mehr Rechenpower anwendet, sondern stattdessen die vorhandenen Ansätze klug verknüpft.
30 Atome sind ziemlich viel
Als Erwin Schrödinger 1926 mit Hilfe seiner berühmten Schrödingergleichung erstmals quantenphysikalische Berechnungen veröffentlichte, betrachtete er ein denkbar einfaches System: ein einzelnes Wasserstoffatom. Doch man möchte natürlich auch andere, kompliziertere Objekte quantenphysikalisch studieren. Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit oder Festigkeit eines Materials können auf atomarer Ebene verstanden, erklärt und auch verbessert werden – dafür ist es unerlässlich, eine große Anzahl von Atomen gleichzeitig am Computer zu simulieren.
"Solche Rechnungen werden sehr schnell ungeheuer aufwändig", erklärt Florian Libisch vom Institut für theoretische Physik. "Wo die Grenzen des Möglichen liegen, hängt von der ausgewählten Methode ab, aber in vielen Fällen ist man heute schon sehr zufrieden, wenn man 30 Atome exakt berechnen kann."
Doch eine Hand voll Atomen bildet noch kein Objekt mit makroskopischen Eigenschaften. Es kann sein, dass sich ein solcher Mini-Cluster völlig anders benimmt, als eine ausgedehnte Fläche desselben Materials. Wichtig ist das beispielsweise, wenn man Katalysatoren verstehen möchte: Einzelne Moleküle treffen etwa auf ein Metalloberfläche, die einen ganz bestimmten Effekt auf das eintreffende Molekül hat. Einige wenige Metall-Moleküle hätten eine ganz andere Wirkung als eine ausgedehnte Metalloberfläche.
1998 wurde der Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung quantenchemischer Berechnungsmethoden vergeben, die es ermöglichen, der Chemie auf Quantenebene auf die Spur zu kommen. Heute steht ein bunter Baukasten aus verschiedenen Rechenmethoden zur Verfügung, die von unterschiedlichen Näherungsannahmen ausgehen. Man braucht viel Wissen und Erfahrung, um zu entscheiden, welche Methode für ein bestimmtes Problem die richtige ist. Bei komplizierten Problemen kann es allerdings sein, dass keine einzelne Methode zum Ziel führt. Dann ist es am besten, verschiedene Bausteine zu etwas ganz Neuem zusammenzusetzen. Florian Libisch entwickelt mathematische Verfahren, um vorhandene Theorie-Bausteine zu neuen Methoden zusammenzufügen und dadurch Rechnungen zu ermöglichen, die man mit keiner einzelnen Methode durchführen könnte.
Zerlegen und zusammenfügen
So gelang es Florian Libisch etwa, das Verhalten eines Sauerstoffmoleküls zu berechnen, das sich einer Aluminiumoberfläche nähert. "Wir teilen die Aluminiumoberfläche auf in ein kleines Stück, das den stärksten Einfluss auf das Sauerstoffmolekül hat, und einen großen Rest", erklärt Libisch. "Für das kleinere Stück verwenden wir eine sehr genaue und sehr aufwendige Methode, für den großen Rest eine einfachere." Die genaue Methode ist zu aufwendig um das ganze System zu behandeln. Es reicht aber auch nicht, nur die einfachere Methode anzuwenden, weil dann die Resultate nicht zum Experiment passen. Erst durch die Kombination der beiden Methoden erhält man Ergebnisse, die auch zu entsprechenden Messungen passen.
Solche Vorgangsweisen sind nicht bloß eine zeitlich befristete Hilfsmaßnahme, die man heute ergreift, bis noch bessere Computer zur Verfügung stehen. Bei vielen Methoden steigt der Rechenaufwand exponentiell mit der Anzahl der beteiligten Teilchen an. Auch wenn sich die Fähigkeiten moderner Computer rasant weiterentwickeln, werden sie mit der Simulation großer Objekte auf Quantenniveau immer überfordert sein. Kreative Näherungsmethoden, wie man sie an der TU Wien entwickelt, werden also auch in Zukunft eine große Bedeutung haben.
Im Fokus der TU-Forschungsschwerpunkte
Die Untersuchung von Materialien mit quantenphysikalischen Computermethoden steht am Schnittpunkt von gleich drei Forschungsschwerpunkten der TU Wien: "Quantum Physics and Quantum Technologies", "Computational Science and Engineering" und "Materials and Matter". An der Verbindung unterschiedlicher Rechenmethoden arbeitete Florian Libisch intensiv während eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes an der US-amerikanischen Princeton University. Danach kehrte er nach Wien zurück. Mit dem Know-How aus den USA fühlt er sich nun an der TU Wien am richtigen Platz: "Es gibt hier viele Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen, sowohl auf theoretischer Seite als auch experimentell. Das hilft natürlich sehr und ermöglicht spannende Kooperationen."
Florian Libisch wurde kürzlich eingeladen, über das Zusammenfügen verschiedener Rechentechniken ("Embedding-Verfahren") einen Review-Artikel für das Fachjournal "Accounts of Chemical Research" zu schreiben. Der Artikel ist nun erschienen.
Originalpublikation:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ar500086h
Rückfragehinweis:
Dr. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-13608
florian.libisch@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Laserphysik auf den Kopf gestellt
Ein System aus gekoppelten Lasern wurde an der TU Wien hergestellt, das sich völlig paradox verhält: Bei verstärkter Energiezufuhr schaltet sich das Laserlicht aus und bei weniger Energie schaltet es sich ein.
Simulation der Lasermoden, die in diesem System angeregt werden.
Elektronenmikroskopische Aufnahme der gekoppelten Quantenkaskadenlaser. Durch die beiden Drähte wird den Lasern die nötige Energie zugeführt.
Stefan Rotter (Theoretische Physik), Martin Brandstetter (Photonik), Matthias Liertzer (Theoretische Physik), Christoph Deutsch (Photonik), Joachim Schöberl (Mathematik), Karl Unterrainer (Photonik) (v.l.n.r)
Schallwellen verhallen, Wasserwellen verebben, ein Lichtstrahl wird von einer Wand verschluckt. Dass Wellen absorbiert werden ist ein ganz alltägliches Phänomen. Trotzdem erkannte die Physik erst in den letzten Jahren, welche neuen Möglichkeiten sich ergeben, wenn man diesen Verlust von Energie nicht als lästiges Ärgernis, sondern als erwünschten Effekt betrachtet. An der TU Wien wurde nun ein System aus zwei gekoppelten Lasern hergestellt, bei dem die Balance aus Energiezufuhr und Verlust zu einem paradoxen Verhalten führt: Zusätzliche Energie kann den Laser ausschalten, oder eine Reduktion der Energie den Laser einschalten. Auf diese Weise könnte man logische Schaltungen bauen, die mit Licht funktionieren. Im Fachjournal „Nature Communications“ wurde das entsprechende Experiment nun präsentiert.
Gewöhnliche Laser und paradoxe Laser
„Normalerweise hängt die Lichtintensität eines Lasers auf recht einfache Weise von der Energie ab, die man hineinsteckt“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Führt man zu wenig Energie zu, geschieht gar nichts. Überschreitet man eine kritische Schwelle, beginnt der Laser zu leuchten, und je mehr Energie man zuführt, umso stärker leuchtet er.“
Doch es geht auch anders. Zwei mikroskopisch kleine kreisförmige Laser wurden an der TU Wien miteinander gekoppelt, sodass ein Gesamtsystem entsteht, in dem die komplizierte Balance von Energiezufuhr und Energieverlust erstaunliche physikalische Effekte hervorruft: Zwei Laser, die sonst leuchten würden, schalten sich gegenseitig aus, wenn man sie koppelt. Mehr Energie führt dann nicht zu mehr Licht, sondern zu völliger Dunkelheit. Umgekehrt kann auch eine Reduktion der Energiezufuhr dazu führen, dass plötzlich das Licht angeht.
„Zunächst stießen wir in einer Computersimulation auf diesen Effekt, und waren ziemlich verblüfft von unseren Ergebnissen“, erzählt Stefan Rotter. Nun ist es gelungen, das vor zwei Jahren vorhergesagte Phänomen experimentell zu bestätigen – in einem Gemeinschaftsprojekt zwischen den Fachrichtungen Physik, Elektrotechnik und Mathematik der TU-Wien und der Universität Princeton (USA). Für das Experiment wurden sogenannte Terahertz-Quantenkaskadenlaser mit einem Durchmesser von weniger als einem Zehntelmillimeter verwendet. „Diese Mikro-Laser sind für solche Experimente besonders gut geeignet, weil ihre optischen Eigenschaften genau angepasst werden können und ihre Wellenlänge recht groß ist“, sagt Martin Brandstetter vom Institut für Photonik der TU-Wien. Dadurch gelangt die Lichtwelle leicht von einem Laser in den anderen.
Gewünschte Imperfektion
Die Absorption von Wellen wird in der Physik meist als unerwünschter Nebeneffekt betrachtet. „Man geht bei theoretischen Berechnungen meist vom perfekten Fall aus, in dem es keine Dissipation gibt“, erklärt Rotter. Es rechnet sich einfach leichter mit Spiegeln, die 100% des Lichtes reflektieren, mit Lichtleitungen, die 100% des Lichts leiten, oder mit Schallwellen, die bei ihrer Ausbreitung keine Energie verlieren. Doch Perfektion ist manchmal einfach langweilig – die interessanten Kopplungseffekte der beiden Laser werden nur sichtbar, wenn man auf ihnen eine speziell absorbierende Metallschicht anbringt, die einen Teil des Lichts absorbiert. Für das paradoxe Verhalten der Laser ist ein kompliziertes mathematisches Phänomen verantwortlich: Das Auftreten sogenannter „Ausnahmepunkte“ – spezielle Schnittpunkte von Flächen in komplexen Räumen, die bei der Berechnung der Zustände des Laser-Systems auftreten. Immer wenn die mathematischen Gleichungen solche Ausnahmepunkte hervorbringen, treten physikalisch recht merkwürdige Phänomene auf.
Solche Kopplungen von Lasern könnten zu neuen elektro-optischen Schaltungen führen. Ähnlich wie heute elektronische Bauteile Input-Signale zu einem Output-Signal verarbeiten, könnte man das auch mit optischen Bauteilen tun. Gekoppelte Mikro-Laser wären dafür ideal: Sie sind leicht auf einem kleinen Chip unterzubringen, und wie sich nun zeigt, bieten sie ein breites Repertoire an nicht-trivialen Schaltungsmöglichkeiten.
Originalpublikation in Nature Communications:
http://www.nature.com/ncomms/2014/140613/ncomms5034/full/ncomms5034.html
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-13618
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Mit Neutronen auf der Suche nach der Dunklen Energie
Nicht nur am großen Teilchenbeschleuniger, sondern auch am Labortisch macht man sich heute auf die Suche nach neuen Teilchensorten: Die Gravitations-Resonanz-Methode, entwickelt an der TU Wien, erweitert den Gültigkeitsbereich der Newton’schen Gravitationstheorie und schränkt Parameterbereiche für hypothetische Teilchen hunderttausendfach stärker ein als bisher.
Neutronen zwischen parallelen Platten geben Aufschluss über mögliche Kräfte im Universum.
Das Gravitations-Resonanz-Spektrometer an der TU Wien
Alle Teilchen, die wir heute kennen, machen nur fünf Prozent der Masse und Energie im Universum aus. Der große Rest – die „Dunkle Energie“ und die „Dunkle Materie“ – bleibt bis heute mysteriös. Ein Team der TU Wien führte gemeinsam mit dem ILL (Institut Laue-Langevin, Grenoble) hochsensitive Untersuchungen von Gravitations-Effekten auf winzigen Abständen durch. Damit lässt sich nun der Bereich, in dem man neue Teilchensorten oder zusätzliche Naturkräfte vermuten könnte, hunderttausend mal stärker einschränken als bisher.
Unentdeckte Teilchensorten?
Die Dunkle Materie kann man zwar nicht sehen, sie wirkt aber durch ihre Gravitationskraft auf die bekannte Materie ein, etwa auf die Rotation von Galaxien. Die dunkle Energie hingegen ist dafür verantwortlich, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt.
Dunkle Energie kann man mit einer zusätzlichen physikalischen Größe beschreiben, mit Albert Einsteins Kosmologischer Konstante. Eine Alternative dazu sind sogenannte Quintessenz-Theorien: „Vielleicht ist der leere Raum gar nicht leer, sondern erfüllt von einem bisher unbekannten Feld, vergleichbar mit dem Higgs-Feld“, sagt Prof. Hartmut Abele vom Atominstitut der TU Wien. Benannt wurden diese Theorien nach der von Aristoteles postulierten Quintessenz, einem hypothetischen fünften Element neben den vier antiken Urstoffen.
Als "Chamäleon-Felder" werden bestimmte hypothetische physikalische Felder bezeichnet, nach denen nun gesucht wird.
Andersartige Teilchensorten und zusätzlichen Naturkräfte müssten sich allerdings auch in Experimenten auf der Erde nachweisen lassen. Tobias Jenke und Hartmut Abele von der TU Wien entwickelten ein extrem sensitives Instrument, mit dem an der Neutronenquelle des ILL in Grenoble die Gravitationskraft vermessen werden konnte. Neutronen sind dafür optimal geeignet: Sie sind elektrisch neutral und kaum polarisierbar. Auf sie kann im Experiment bloß die Gravitation wirken – und allenfalls auch neue, bisher unbekannte Zusatzkräfte. Umfangreiche theoretische Berechnungen zum Verhalten der Neutronen wurden von Larisa Chizhova, Prof. Stefan Rotter und Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für theoretische Physik der TU Wien durchgeführt. U. Schmidt von der Universität Heidelberg und T. Lauer von der TU München steuerten zur Polarisationsanalyse bei.
Kräfte zwischen zwei Platten
Die Neutronen werden abgekühlt und zwischen zwei parallelen Platten hindurchgeschickt. Nach den Gesetzen der Quantenphysik kann sich das Neutron dabei nur in ganz bestimmten Zuständen mit ganz bestimmten Energien befinden, die von der Stärke der Kraft abhängt, die von der Gravitation auf das Teilchen ausgeübt wird. Indem man die untere Platte vibrieren lässt, kann man die Neutronen zwischen den Zuständen hin und her wechseln lassen. So lassen sich die Abstände der Energieniveaus vermessen.
„Das Experiment ist ein wichtiger Schritt zur Modellierung gravitativer Wechselwirkungen bei sehr kleinen Distanzen. Die Neutronen am ILL und die Messinstrumente aus Wien bilden zusammen das beste Werkzeug, um nach winzigen Abweichungen von der Newton‘schen Gravitationstheorie zu suchen, die von manchen Theorien vorhergesagt werden“, sagt Peter Geltenbort vom ILL Grenoble.
Wie leicht eine solche Abweichung aufzufinden ist, hängt von verschiedenen Parametern ab – zum Beispiel von der Stärke der Kopplung eines hypothetischen neuartigen Feldes an die bekannte Materie. Bestimmte Wertebereiche für diese Parameter gelten längst als ausgeschlossen: Gäbe es eine „Quintessenz“ mit solchen Kopplungsstärken, hätte man sie bereits in anderen Präzisions-Experimenten finden müssen. Doch noch immer blieb ein großer „erlaubter“ Parameterbereich, in dem sich neue physikalische Phänomene verstecken könnten.
Hunderttausend mal besser als bisher
Mit der Neutronen-Methode lassen sich nun allerdings Theorien in diesem Bereich testen: „Bisher konnten wir bei unseren Messungen keine Abweichungen zum bekannten Newton’schen Gravitationsgesetz finden“, sagt Hartmut Abele. „Dadurch können wir nun einen weiten Bereich von Parametern ausschließen.“ Die Messergebnisse legen nun ein Limit für den Kopplungsparameter fest, das hunderttausendmal unterhalb der Grenzen liegt, die sich aus anderen Messmethoden ergaben.
Auch wenn sich auf diese Weise bestimmte hypothetische Teilchen ausschließen lassen ist es freilich noch immer möglich, dass sich unterhalb dieser verbesserten Nachweisgrenze neuartige Physik versteckt. Die Gravitations-Resonanz-Methode soll daher nun noch weiterentwickelt werden. Einige Größenordnungen an Genauigkeits-Verbesserung scheinen noch möglich. Wenn sich auch dann keine Hinweise auf Abweichungen von den bekannten Kräften ergeben, könnte Albert Einstein schließlich noch Recht behalten: Seine Kosmologische Konstante erscheint dann immer plausibler.
arxiv-Version des Papers:
http://arxiv.org/abs/1404.4099
Rückfragehinweise:
Dr. Larisa Chizhova
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
larisa@dollywood.itp.tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Teilchenmuster, erzeugt durch Oberflächenladung
Aus Unordnung entsteht Ordnung: An der TU Wien konnte gezeigt werden, wie erstaunlich einfach wohlstrukturierte Teilchenmuster entstehen können.
Regelmäßige Strukturen, wie in einem Kristall
Unregelmäßigere Strukturen, mit unterschiedlich großen, ineinander verwobenen Ringen.
Emanuela Bianchi
Winzige Nanostrukturen zu erzeugen hat sich als extrem schwierig herausgestellt – doch was geschieht, wenn man sich kleine Teilchen ganz von selbst zur gewünschten Struktur zusammenbauen? An der TU Wien wird das Phänomen einer derartigen Selbstorganisation anhand von Partikeln untersucht, deren Oberfläche eine ungleichmäßig verteilte elektrische Ladung trägt. Abhängig von verschiedenen externen Parametern können diese Partikel ungeordnete, gel-artige oder kristallähnliche Strukturen bilden. Für die Nanotechnologie sind solche, von außen induzierte Selbstorganisations-Effekte ganz entscheidend.
Mikro-Partikel mit ganz besonderer Oberfläche
Die Partikel, die Emanuela Bianchi im Team von Prof. Gerhard Kahl (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) und in Zusammenarbeit mit Prof. Christos N. Likos (Universität Wien) in ihren Computersimulationen analysiert, sind höchstens einige Mikrometer groß, vergleichbar mit Viren oder kleinen Bakterien. Besonders interessant sind solche Nano-Partikel, wenn sie an ihrer Oberfläche verschiedene Regionen mit unterschiedlichen Wechselwirkungseigenschaften aufweisen.
In einem Forschungsprojekt (das im Rahmen eines Elise Richter Stipendiums des FWF gefördert wird) wurden nun Partikel untersucht, deren elektrische Ladung an der Oberfläche ungleich verteilt ist (siehe Abbildung 1): Der Großteil des Partikels ist negativ geladen, an den Polen oben und unten sind allerdings Bereiche mit positiver Ladung zu finden. „Nachdem die Pol-Bereiche alle gleich geladen sind, stoßen sie einander ab“, sagt Emanuela Bianchi. „Bringt man zwei solche Teilchen in Kontakt, dann richten sie sich so aus, dass der Pol des einen Partikels genau zum Äquator des anderen Partikels zeigt.“ Wenn allerdings viele solche Partikel miteinander wechselwirken, wird die Sache komplizierter.
In Computersimulationen wurde untersucht, wie sich die Teilchen verhalten, wenn man sie zwischen zwei horizontalen Platten einsperrt, sodass sie dazwischen eine quasi zwei-dimensionale Struktur bilden können. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass ganz unterschiedliche Konfigurationen möglich sind: Manchmal fügen sich die Teilchen in sauber geordneten Flächenstücken zusammen und ergeben eine dichte, hexagonal gepackte Struktur, die man auch von Kristallen kennt. Manchmal hingegen entstehen ungeordnete, gel-artige Strukturen, die aus aneinanderhängenden Ringen aus fünf oder sechs Teilchen gebildet werden.
„Mit unserem Modell lässt sich untersuchen, wie die entstehenden Strukturen von den externen Parametern abhängen“, sagt Emanuela Bianchi. Ganz entscheidend ist dabei die Größe der positiv geladenen Polarregion der Partikel: Kügelchen, bei denen die Grenze zwischen negativer und positiver Ladung am 45. Breitengrad verläuft, ergeben deutlich besser geordnete planare Strukturen als solche, bei denen diese Grenze näher am Pol, beim 60. Breitengrad gezogen wird. Beeinflussen kann man das Ergebnis der Selbstorganisation auch dadurch, indem man die Bodenplatte, auf der die Teilchen zum Liegen kommen, elektrisch auflädt – ein Eingriff, der sich im Experiment ganz leicht umsetzen lässt.
Nanomaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften
Wenn man die Selbstorganisation von Mikropartikeln versteht, kann man die Teilchen so synthetisieren, dass sie sich in maßgeschneiderten makroskopische Strukturen selbstorganisieren. Je nach mikroskopischer Anordnung der Teilchen hat die aus ihnen entstehende Fläche eine unterschiedliche Dichte und reagiert somit unterschiedlich auf externe Einflüsse (wie etwa elektromagnetische Felder). Mit selbstorganisierenden Strukturen könnte man also beispielsweise Filter mit einstellbarer Porosität herstellen. „Gerade für biomedizinische Anwendungen gibt es hier viele Anwendungsmöglichkeiten“, sagt Emanuela Bianchi.
Die Forschungsergebnisse des Forschungsteams wurden im angesehenen Fachjournal „ACS Nano“ veröffentlicht:
Self-Assembly of Heterogeneously Charged Particles under Confinement:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn401487m?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bbianchi%255D
Rückfragehinweis:
Dr. Emanuela Bianchi
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
emanuela.bianchi@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Motiv: Regelmäßige Strukturen, wie in einem Kristall
Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Motiv: Unregelmäßigere Strukturen, mit unterschiedlich großen, ineinander verwobenen Ringen.
Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Motiv: Emanuela Bianchi
Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Wenn das Licht im Verkehrsstau steckt
Dass wir durch ein Glas Milch nicht hindurchsehen können, liegt an der Lichtstreuung. Sie ist meist schwer zu berechnen, doch im Falle von besonders starker Streuung plötzlich verblüffend einfach, wie man an der TU Wien nun nachweisen konnte.
Aluminiumkugeln, in Styropor verpackt, in einer Kupferröhre:
So wird Wellenstreuung im Labor gemessen.
(Bild: University of Texas at San Antonio)
Komplizierte Wege:
Zwei verschiedene Licht-Zustände, die durch das Medium gelangen. Die Welle wird in Pfeilrichtung eingeschossen.
Warum ist Milch weiß und für uns undurchsichtig? Lichtwellen werden in Substanzen wie Milch zwischen unzähligen Tröpfchen immer wieder hin und her gestreut. Solche Wellen-Ausbreitungs-Phänomene spielen auch in der Technik eine sehr wichtige Rolle, zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik. Mit aufwändigen Computersimulationen und Mikrowellen-Experimenten gelangte man nun zu einem überraschenden Ergebnis: Wenn man Wellen durch immer komplexere Strukturen schickt, benehmen sie sich irgendwann ganz einfach und folgen einem einzigen, ganz bestimmten Streumuster. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.
Viele Wege führen durch die Stadt
Wie lange dauert es, von einem Ende einer Stadt zum anderen zu gelangen? Diese Frage hat keine eindeutige Antwort, denn das hängt vom Weg ab, den man wählt. Manche Verkehrsteilnehmer sind besonders schnell, manche quälen sich durch einen Verkehrsstau, wieder andere verirren sich und kommen gar nicht ans Ziel. „Mit Licht ist das so ähnlich“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Schickt man es durch ein kompliziertes, inhomogenes Material, dann kann es auf viele verschiedene Arten hindurch gelangen und im Medium viele verschiedene Streumuster einnehmen.“
Je größer die Stadt und je stärker der Verkehr, umso schwieriger wird es, einen Weg hindurch zu finden. Je dicker ein Material und je stärker die Lichtstreuung, umso geringer ist seine optische Durchlässigkeit. Das verblüffende Ergebnis der nun vorgelegten Arbeit zeigt sich, wenn man Wellen durch ein sehr dickes, rein zufällig strukturiertes Medium schickt, in dem die Wellen sehr stark gestreut werden: In diesem Fall gibt es nur noch eine einzige Variante, um durch das Medium zu gelangen. Anstatt das komplizierte Gesamtsystem mit seinen unzähligen inneren Wellenzuständen zu beschreiben, lässt es sich dann mit einem einzigen Streumuster vollständig charakterisieren. „Das ist als ob man zur Zeit des morgendlichen Verkehrsstaus eine riesige Stadt nur mehr auf einem einzigen Weg durchqueren kann“, so Rotter.
Mit modernen Computern alten Rätseln auf der Spur
Die theoretischen Überlegungen darüber gehen zurück bis in die Fünfzigerjahre, als der Physiker Philip W. Anderson solche Phänomene theoretisch untersuchte und 1977 dafür den Nobelpreis erhielt. Seine Theorie der Wellenausbreitung kann Lichtwellen genauso erklären wie Schall, und auch in der Quantenphysik, in der Teilchen als Welle beschrieben werden, treffen dieselben Überlegungen zu.
Lange Zeit war es aber nicht möglich, die hochkomplizierte Ausbreitung von Wellen in ungeordneten Medien adäquat zu berechnen. Doch mittlerweile kann man mit Hilfe von Großcomputern und klugen Berechnungsmethoden solchen Phänomenen mit großer Präzision auf die Spur kommen. Adrian Girschik, Florian Libisch und Stefan Rotter von der TU Wien entwickelten Computersimulationen, an der University of Texas in San Antonio wurden Experimente durchgeführt: Aluminiumkugeln wurden in Styropor gepackt, in eine Röhre gefüllt und dann mit Mikrowellen bestrahlt. Die Styropor-Hüllen dienen als Abstandhalter, sind jedoch für die Mikrowellen „unsichtbar“. Die Alukugeln bilden dadurch zufällig angeordnete Streu-Hindernisse für die Mikrowellenstrahlung, ähnlich wie Öltröpfchen in der Milch das sichtbare Licht ablenken.
Wie kompliziert die Wellenausbreitung ist, hängt von der Beschaffenheit des Mediums ab: „Man könnte erwarten, dass das System immer komplizierter wird, je länger die Röhre ist, und je mehr Aluminiumkugeln die Mikrowellen ablenken“, sagt Stefan Rotter. „Doch in Wirklichkeit zeigt sich: Ab einer gewissen Länge, ab einer gewissen Komplexität des Streusystems, spielt nur noch ein einziger Übertragungskanal eine Rolle.“ Am Ende der Röhre kommt dann immer dasselbe Wellenmuster heraus – nur ein einziger Wellen-Zustand gelangt durch das System, alle anderen werden bis zur Unsichtbarkeit abgedämpft.
Gemeinsam publizierten nun die Forschungsteams der TU Wien und der University of Texas ihre Ergebnisse im Fachjournal „Nature Communications“. Dass Untersuchungen von Wellenausbreitung durch ungeordnete Materialien auf so großes Interesse stoßen, ist kein Zufall: Solche Wellenphänomene sind in Wissenschaft und Technik allgegenwärtig. In der medizinischen Diagnostik, in der Geophysik, bei der Erzeugung von Laserstrahlung mit speziellen Zufallslasern – in vielen ganz unterschiedlichen Bereichen hat man es mit Wellenausbreitung zu tun, die von der Umgebung stark gestört wird. Diese Phänomene immer besser zu verstehen ist daher eine Aufgabe, die für viele verschiedene Bereiche relevant ist.
Link zur Originalpublikation:
The single-channel regime of transport through random media
http://staging-www.nature.com/ncomms/2014/140321/ncomms4488/full/ncomms4488.html
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Aluminiumkugeln, in Styropor verpackt, in einer Kupferröhre:
So wird Wellenstreuung im Labor gemessen.
(Bild: University of Texas at San Antonio)
Abdruck honorarfrei, Copyright: University of Texas at San Antonio
Komplizierte Wege:
Zwei verschiedene Licht-Zustände, die durch das Medium gelangen. Die Welle wird in Pfeilrichtung eingeschossen.
Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Kochrezept für ein Universum
Erhitzen und ein bisschen rühren: Ein expandierendes Universum kann auf erstaunlich einfache Weise entstehen, sagen Berechnungen an der TU Wien.
Kochrezept für ein Universum: Erhitzen und umrühren.
Daniel Grumiller erhitzt die Raumzeit - zumindest am Papier.
Der indische Physiker Arjun Bagchi (rechts) besucht derzeit die TU Wien und hat kürzlich ein Lise-Meitner Fellowship vom FWF erhalten, um in Zusammenarbeit mit Daniel Grumiller (links) die neuen holographischen Zusammenhänge in flachen Raumzeiten zu erforschen.
Wenn man Suppe erhitzt, beginnt sie zu kochen. Wenn man Raum und Zeit erhitzt, kann ein expandierendes Universum entstehen – ganz ohne Urknall. Diesen Phasenübergang zwischen einem langweiligen leeren Raum und einem expandierenden Universum, das Masse enthält, konnte ein Forschungsteam der TU Wien gemeinsam mit Kollegen aus Harvard, dem MIT und Edinburgh nun berechnen. Dahinter liegt ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen Quantenfeldtheorie und Einsteins Relativitätstheorie.
Kochen mit Raum und Zeit
Aus dem Alltag kennen wir Phasenübergänge nur von Stoffen, die zwischen festem, flüssigem und gasförmigem Zustand wechseln. Allerdings können auch Raum und Zeit selbst solche Übergänge durchmachen, wie die Physiker Steven Hawking und Don Page schon 1983 zeigten. Sie berechneten, dass aus leerem Raum bei einer bestimmten Temperatur plötzlich ein Schwarzes Loch werden kann.
Lässt sich bei einem ähnlichen Prozess aber auch ein ganzes Universum erzeugen, das sich kontinuierlich ausdehnt, so wie unseres? Diese Frage stellte sich Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien gemeinsam mit Kollegen aus Harvard, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Universität Edinburgh. Das Ergebnis: Tatsächlich scheint es eine kritische Temperatur zu geben, bei der aus einem völlig leeren, flachen Raum ein expandierendes Universum mit Masse wird. „Die leere Raumzeit beginnt gewissermaßen zu kochen, es bilden sich Blasen, eine von ihnen expandiert und nimmt schließlich die gesamte Raumzeit ein“, erklärt Daniel Grumiller.
Das Universum muss dabei rotieren – das Kochrezept für ein expandierendes Universum lautet also: Erhitzen und umrühren. Diese Rotation kann allerdings beliebig gering sein. Bei den Berechnungen wurden vorerst nur zwei Raumdimensionen berücksichtigt. „Es gibt aber nichts, was dagegen spricht, dass es in drei Raumdimensionen genauso ist“, meint Grumiller.
Unser eigenes Universum ist allerdings wohl nicht auf diese Weise entstanden: Das Phasenübergangs-Modell ist nicht als Konkurrenz zur Urknalltheorie gedacht. „In der Kosmologie weiß man heute sehr viel über das frühe Universum – das zweifeln wir nicht an. Aber für uns ist die Frage entscheidend, welche Phasenübergänge in Raum und Zeit möglich sind und wie die mathematische Struktur der Raumzeit beschrieben werden kann“, sagt Grumiller.
Auf der Suche nach der Struktur des Universums
Die Theorie ist die logische Fortsetzung der sogenannten „AdS-CFT-Korrespondenz“, einer 1997 aufgestellten Vermutung, die seither die Forschung an den fundamentalen Fragen der Physik stark beeinflusst hat: Sie beschreibt einen merkwürdigen Zusammenhang zwischen Gravitationstheorien und Quantenfeldthorien – zwei Bereiche, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben müssten. In bestimmten Grenzfällen, so sagt die AdS-CFT-Korrespondenz, lassen sich Aussagen der Quantenfeldtheorie in Aussagen von Gravitationstheorien überführen und umgekehrt. Das klingt zunächst ähnlich merkwürdig, als würde man das Herunterfallen eines Steins studieren, indem man die Temperatur heißer Atome in einem Gas berechnet. Zwei ganz unterschiedliche physikalische Gebiete werden in Verbindung gebracht – aber es funktioniert.
Die Quantenfeldtheorie kommt dabei immer mit einer Dimension weniger aus als die dazugehörige Gravitationstheorie – das bezeichnet man als „holographisches Prinzip“. Ähnlich wie ein zweidimensionales Hologramm ein dreidimensionales Objekt darstellen kann, kann eine Quantenfeldtheorie mit zwei Raumdimensionen eine physikalische Situation in drei Raumdimensionen beschreiben.
Korrespondenz auch für flache Raumzeit
Die Gravitationstheorien müssen dafür allerdings in einer Raumzeit mit einer exotischen Geometrie definiert werden - in sogenannten „Anti-de-Sitter-Räumen“, deren Geometrie von der flachen Geometrie unserer Alltagserfahrung deutlich abweicht. Es wurde schon seit langem vermutet, dass es eine ähnliche Version dieses „holographischen Zusammenhangs“ auch für flache Raumzeiten geben könnte, aber es mangelte bisher an konkreten Modellen, die diesen Zusammenhang belegten.
Letztes Jahr wurde von Daniel Grumiller und Kollegen erstmals so ein Modell aufgestellt (der Einfachheit halber in bloß zwei Raumdimensionen). Das führte schließlich zur aktuellen Fragestellung: Dass es in den Quantenfeldtheorien einen Phasenübergang gibt, wusste man. Doch das bedeutete, dass es aus Konsistenzgründen auch auf der Gravitatations-Seite einen Phasenübergang geben muss.
„Das war zunächst ein Rätsel für uns“, sagt Daniel Grumiller. „Das würde einen Phasenübergang zwischen einer leeren Raumzeit und einem expandierenden Universum bedeuten, und das erschien uns zunächst äußerst unwahrscheinlich.“ Die Rechenergebnisse zeigten dann aber, dass genau diesen Übergang tatsächlich gibt. “Wir beginnen erst, diese Zusammenhänge zu verstehen“, meint Daniel Grumiller. Welche Erkenntnisse über unser eigenes Universum wir dadurch ableiten können, ist heute noch gar nicht absehbar.
Originalpublikation:
A. Bagchi, S. Detournay, D. Grumiller qnd Joan Simon, Phys. Rev. Lett. 111, 181301 (2013):
http://arxiv.org/abs/arXiv:1305.2919
siehe auch: A. Bagchi, S. Detournay and D. Grumiller, Phys. Rev. Lett. 109, 151301 (2012):
http://arxiv.org/abs/arXiv:1208.1658
Rückfragehinweis:
Dr. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
daniel.grumiller@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Award of Excellence an Dominik Steineder
BM Karlheinz Töchterle, Dominik Steineder
Als einer von vier AbsolventInnen des Doktoratsstudiums an der TU Wien wurde Dominik Steineder mit dem "Award of Excellence" ausgezeichnet.
Dominik Steineder hatte seine Doktorarbeit mit dem Titel "Holographic descriptions of anisotropic plasma" bei Prof. Anton Rebhan am Institut für Theoretische Physik im November 2012 abgeschlossen. Diese beinhaltet unter anderem neue Resultate zur Viskosität des Quark-Gluon-Plasma, die zeigten, dass die bislang vermutete untere Schranke für die Viskosität einer Quantenflüssigkeit durch Anisotropien unterboten werden kann, was in der internationalen Fachwelt auf großes Interesse stieß. (Siehe dazu die Pressemitteilung
http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7355/.)
Die Preisverleihung fand am 12. Dezember 2013 durch Dr. Karlheinz Töchterle im Palais Harrach statt (und war eine der letzten Amtshandlungen des Wissenschaftsministers Dr. Karlheinz Töchterle).
Rückfragehinweis:
Dr. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Logik und Teilchen
Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien wurden vom Wissenschaftsfonds FWF genehmigt: „Logik in der Informatik“ und „Teilchen und Wechselwirkungen“. Das bestehende Kolleg „Wasserwirtschaftliche Systeme“ wurde verlängert.
Logische Methoden in der Computerwissenschaft und Teilchenphysik: Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien
Die TU Wien darf sich über zwei der fünf neuen Doktoratskollegs freuen, die nun vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert werden. Prof. Helmut Veith wird das Kolleg „Logical Methods in Computer Science“ leiten, Prof. Anton Rebhan das Kolleg „Particles and Interaction“. In den beiden Doktoratsprogrammen können insgesamt 25 junge Doktoratsstudierende angestellt werden. Zusätzlich wird eine größere Anzahl assoziierter Mitglieder von den neuen Kollegs profitieren.
Außerdem läuft das interdisziplinäre Doktoratsprogramm „Wasserwirtschaftliche Systeme“ weiter, das 2009 an der TU Wien unter der Leitung von Prof. Günter Blöschl gestartet wurde: Nach erfolgreicher Evaluierung wurde es nun verlängert. Verlängert wurde auch das Doktoratskolleg CoQuS ("Complex Quantum Systems"), an dem die TU Wien ebenfalls stark beteiligt ist.
“Particles and Interactions“: Ausrechnen, wie die Welt funktioniert
Auf die Suche nach den fundamentalen Gesetzen des Universums macht man sich im Doktoratskolleg „Teilchen und Wechselwirkungen“. „Das Forschungsgebiet steht heute an der Schwelle zu einer neuen Ära, mit bahnbrechenden Experimenten bei bisher unerreicht hohen Energien, bei hohen Dichten oder auch mit extrem hoher Präzision im Niedrigenergiebereich“, sagt Anton Rebhan.
Offene Fragen gibt es in der Physik noch genug: Wie können wir die Dunkle Materie oder den Ursprung der Masse verstehen? Wie lassen sich exotische Materiezustände erklären, wie sie Augenblicke nach dem Urknall auftraten, oder bei hochenergetischen Teilchenkollisionen zu beobachten sind? Was geht im Zentrum extrem dichter Sterne vor sich?
In den letzten Jahren gab es – nicht zuletzt durch die Experimente am CERN – große Fortschritte in diesem Forschungsbereich. Das Doktoratskolleg soll nun weitere Hinweise zu grundlegenden Problemen rund um die Vereinheitlichung der Grundkräfte, der Theorie der Quantengravitation und den fundamentalen Symmetrien der Natur liefern. Neben der TU Wien werden auch theoretische und experimentelle Forschungsgruppen der Universität Wien und der Akademie der Wissenschaften (Institut für Hochenergiephysik und Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik) eingebunden, um eine wienweite fruchtbare wissenschaftliche Umgebung für Doktoratsstudenten zu schaffen.
“Logical Methods in Computer Science“: Die Grundlagen für die Computerindustrie von morgen
Für die Softwaretechnik wird Logik in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Computer, die selbstständig argumentieren und urteilen können, werden in ganz verschiedenen Bereichen Einzug halten – etwa in der Medizin, in der Wirtschaft, aber auch in Alltagsanwendungen zu Hause.
„Ähnlich wie die Differential- und Integralrechnung völlig neue Möglichkeiten für die Physik und die Ingenieurswissenschaften eröffnet hat, ist die Logik eine Schlüsseldisziplin für neue Entwicklungen in den Computerwissenschaften“, meint Helmut Veith, der gemeinsam mit Stefan Szeider das Doktoratsprogramm leitet.
Durch das Vienna Center for Logic and Algorithms (VCLA) wurde in den vergangenen Jahren ein international sichtbares Kompetenzzentrum für Logik in der Informatik aufgebaut, das nun durch das Doktoratskolleg noch weiter gestärkt wird.
In drei Forschungsbereichen der Logik wurde in den letzten zwei Jahrzehnten an der TU Wien eine besonders gute internationale Sichtbarkeit erreicht, diese Bereiche werden auch im neuen Doktoratskolleg eine wichtige Rolle spielen: Erstens die Computationale Logik, ganz besonders Beweistheorie, Komplexitätstheorie und automatische Beweisführung, zweitens die Anwendung von Logik auf Datenbanken und künstliche Intelligenz, und drittens „Computer Aided Verification“ bzw. „Model Checking“, wo man mit Hilfe von Computerprogrammen Algorithmen auf Fehler untersucht.
Neben der Fakultät für Informatik der TU Wien sind auch die Fakultät für Mathematik und Geoinformation, die Universität Linz und die Technische Universität Graz mit je einer Doktorandenstelle im Doktoratskolleg vertreten. Die Zusammenarbeit mit Graz und Linz verstärkt die bestehenden Synergien im Nationalen Forschungsnetzwerk Rigorous Systems Engineering.
Verlängerung für Wasserwirtschafts-Projekt
Viele wissenschaftliche Erfolge brachte auch das Doktoratskolleg „Wasserwirtschaftliche Systeme“, geleitet von Prof. Günter Blöschl. Nach vier Jahren Laufzeit wurde das Kolleg nun evaluiert und darf in die nächste Runde gehen – es gehört zu den zehn laufenden Kollegs, die vom FWF verlängert werden.
Auch das Doktoratskolleg CoQuS wurde verlängert. In diesem Kolleg geht es um Quantentechnologie, Quantenoptik und Quanteninformation. Koordiniert wird es von der Unviersität Wien, aber auch hier ist die TU Wien stark vertreten.
Rückfragehinweis:
Dr. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Videotipp: Phasenübergänge, visualisiert am Computer
Eine an der TU Wien entwickelte Simulationsmethode vereinfacht die Berechnung, ob ein Material bei bestimmten äußeren Bedingungen fest oder flüssig ist. Dieses Video erklärt, wie dieses Verfahren funktioniert.
Fest? Flüssig? Gasförmig? In vielen praktischen Anwendungen spielen Phasendiagramme eine ganz zentrale Rolle: Sie sind gewissermaßen Landkarten, die genau anzeigen, in welchem Aggregatszustand ein Material bei bestimmten äußeren Bedingungen vorliegt. So kann etwa eine Flüssigkeit erstarren, wenn man den Druck erhöht, oder aber auch, wenn man die Temperatur senkt. In einem Druck-Temperatur-Phasendiagramm kann man auf einen Blick sehen, wie die Grenzen zwischen fester und flüssiger Phase verlaufen.
Schmelzen und Erstarren am Computer
Diese Grenzen rechnerisch vorherzusagen ist allerdings schwierig. Man kann das Material am Computer simulieren, die Rechnung entweder im flüssigem oder im festen Zustand starten und hoffen, dass sich nach überschaubarer Zeit der tatsächliche Endzustand eingestellt hat. Man kann die Rechnung aber auch gleich mit einem Gemisch aus fester und flüssiger Phase beginnen und beobachten, ob sich im Laufe der Simulation der Festköper oder die Flüssigkeit über das Simulationsvolumen ausbreitet. All diese Methoden haben aber Nachteile: sie sind aufwändig und nicht unbedingt zuverlässig.
Die entscheidende thermodynamische Größe, die eindeutig Antwort darüber gibt, ob das Material bei bestimmten äußeren Parametern in fester oder flüssiger Form vorliegt, ist die Gibbs-Energie (auch freie Enthalpie). Der Zustand mit der niedrigeren Gibbs-Energie ist der stabile Endzustand. Auch bei chemischen Reaktionen spielt diese Größe eine wichtige Rolle: Die Gibbs-Energie ist ein Maß für die „Verfügbarkeit“ der Energie, die in einem System bei bestimmter Temperatur und bestimmtem Druck steckt. Wenn im Laufe einer chemischen Reaktion die Gibbs-Energie sinkt, dann läuft sie von selbst ab, hat aber der Endzustand eine höhere Gibbs-Energie als der Ausgangszustand, so muss von außen Energie zugeführt werden, um die Reaktion zu ermöglichen.
Neue Rechenmethode
Ulf Rørbæk Pedersen, „post-doc“ Miarbeiter am Institut für Theoretische Physik (gefördert im Rahmen des FWF-SFBs „ViCoM“) entwickelte eine neue Methode, die es erlaubt, den Unterschied in der Gibbs-Energie zwischen fester und flüssiger Phase sehr genau zu berechnen. Somit kann man eindeutig schließen, welche der beiden konkurrierenden Phasen die stabilere ist – ob sich also das Phasengleichgewicht eher zum festen oder eher zum flüssigen Zustand verschiebt, und zwar von selbst, also ohne Energiezufuhr von außen.
In diesem Video erklärt der Wissenschafter, wie die von ihm entwickelte „Interface-Pinning Method“ funktioniert: Er simuliert ein Gemisch aus einem geordneten Festkörper und einer Flüssigkeit und führt eine hypothetische Kraft ein, die bewirkt, dass die Mischung aus den beiden Aggretatszuständen bestehen bleibt. Diese Zusatzkraft, die nur als Rechengröße in der Computersimulation eingeführt wurde, sorgt also dafür, dass das Gemisch weder vollständig erstarren noch vollständig schmelzen kann. Aus der Stärke dieser Kraft lässt sich der Unterschied in der Gibbs-Energie der beiden konkurrierenden Phasen berechnen.
Video unter:
http://www.youtube.com/watch?v=YP_fyY-vGYc
Originalpublikation unter: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/139/10/10.1063/1.4818747
Rückfragehinweis:
Dr. Ulf Rørbæk Pedersen
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13651
ulf.pedersen@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
OePG-Studierendenpreis an Max Riegler
Max Riegler erhält den Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit. Im Zuge dieser Arbeit hat Max Riegler sich damit auseinandergesetzt, wie man eine bestimmte Klasse von Theorien, welche Gravitation beschreiben, auf eine andere, äquivalente Weise, konsistent beschreiben kann.
Max Riegler (3. von links) und Richard Wollhofen (2. von links) erhalten den geteilten Preis der OePG für ihre Masterarbeiten
Max Riegler versucht in seiner Masterarbeit durch Anwendung des holographischen Prinzips ein besseres Verständnis von Gravitation in 2+1 Dimensionen zu gewinnen. Das „holographische Prinzip“ erlaubt uns, physikalische Beschreibungen von einer Theorie in eine andere, äquivalente Theorie zu übersetzen. Theorien beschreiben die Wirklichkeit oft nur in einem bestimmten Bereich einer Kenngröße exakt, in anderen Größenordnungen werden ihre Vorhersagen zu ungenau, bzw. liefern offensichtliche Widersprüche. Eine andere Theorie vermag die gesuchte Kenngröße aber in genau diesem bisher unzureichend beschriebenen Bereich genau darzustellen, ist aber dafür in anderen Bereichen unzuverlässig. Eine Übersetzung zwischen diesen beiden Theorien ermöglicht es, die gewünschte Kenngröße und die von ihr beschriebene Physik in allen Bereichen exakt zu beschreiben. Max Riegler nutzt eine spezielle Form des holographischen Prinzips, die „Höhere-Spin-Holographie“, welche zwischen einer bestimmten Raumzeit, welche mehr Symmetrien als sonst üblich besitzt , beschrieben von der Theorie A, und einer zugehörigen Quantenfeldtheorie, Theorie B, übersetzt.
Schematische Darstellung des holographischen Prinzips für eine Raumzeit mit der Topologie eines Zylinders
Besonders ist Max Riegler an Bereichen interessiert, in den die Räume besonders starke Krümmung aufweisen und die Gravitation besonders groß wird. Dies ist zum Beispiel in schwarzen Löchern der Fall. Max Riegler konnte in seiner Masterarbeit einen effizienten Algorithmus entwickeln, welcher zum Finden von passenden Randbedingungen der untersuchten Raumzeit verwendet werden kann, um die hier vorliegende Gravitationstheorie zu beschreiben.
1+1 dimensionale Anti-de-Sitter Raumzeit in flachem 2+1 dimensionalem Raum eingebettet
Max Riegler bleibt seinem Forschungsgebiet und seinem Betreuer Daniel Grumiller, Institut für Theoretische Physik, TU Wien, auch in seiner Dissertation treu. Ziel der Dissertation ist es nun, ein besseres Verständnis der Mechanismen und dualen Feldtheorien dieser Höheren-Spin-Holographie für Raumzeiten zu erlangen, welche nicht Anti-de-Sitter (i.e. Raumzeiten mit konstant negativer Krümmung) sind.
Mehr Information zur Arbeit von Max Riegler finden Sie unter:
http://www.teilchen.at/kdm/437
Foto: S. Albietz (OePG)
Grafiken: Andreas Krassnigg
Rückfragehinweis:
Max Riegler MSc
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rieglerm@hep.itp.tuwien.ac.at
Autorin:
Sylvia Riedler M.A.
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
sylvia.riedler@tuwien.ac.at
Unendlich ist ungefähr zwei
An der TU Wien wird untersucht, wie die Relativitätstheorie aussieht, wenn man unendlich viele Raumdimensionen annimmt. Erstaunlicherweise ergeben sich daraus Resultate einer 2D-Stringtheorie. Diese Entdeckung soll nun helfen, Schwarze Löcher besser zu verstehen.
Zwei Dimensionen oder unendlich viele Dimensionen? Im Umgang mit Schwarzen Löchern ist das eine komplizierte Frage [1].
Daniel Grumiller
Immanuel Kant hätte sich gewundert. Er betrachtete den dreidimensionalen Raum als etwas a priori Vorgegebenes, als feststehende Voraussetzung für die Erkennbarkeit der Dinge. Doch in der modernen Physik ist längst der Raum selbst zum Forschungsobjekt geworden – und wie viele Dimensionen er hat, ist alles andere als klar.
Um Schwarze Löcher zu untersuchen rechnet Daniel Grumiller von der TU Wien mit unendlich vielen Raumdimensionen – und stößt dabei auf eine erstaunliche Verbindung zwischen Relativitätstheorie und Stringtheorie. Für seine bisherigen Forschungen erhielt er nun den Förderungspreis für Wissenschaft der Stadt Wien.
Das Wichtigste zuerst – kleine Störungen später
Um in der Physik möglichst exakte Ergebnisse zu bekommen, geht man oft von einem einfachen Fall aus und fügt dann kleinere zusätzliche Störungen mit ins Modell ein: Die Bewegung der Erde um die Sonne lässt sich grob berechnen, indem man zuerst alle anderen Himmelskörper ignoriert, danach fügt man die Störungen durch die großen Planeten hinzu. In der Teilchenphysik berechnet man die Wechselwirkung von wenigen Teilchen und bezieht erst dann weitere Teilchen-Interaktionen als kleine Störung mit ein.
Statt der Anzahl von Himmelskörpern oder Teilchen-Interaktionen kann man auch die Anzahl der Raumdimensionen als Störungs-Größe annehmen. Dort funktioniert das allerdings umgekehrt: Man geht nicht von einer möglichst kleinen Anzahl aus sondern nimmt zunächst unendlich viele Raumdimensionen an, und von diesem Extremfall ausgehend kann man sich dann mathematisch wieder einem realistischeren Fall (etwa mit unseren wohlbekannten drei Raumdimensionen) annähern.
Stringtheorie als Ergebnis der Relativitätstheorie
Gemeinsam mit Kollegen aus Spanien untersuchte Daniel Grumiller die Physik Schwarzer Löcher und verwendete dabei den Trick einer unendlichen Dimensionsanzahl. Allerdings hielt die unendlich-dimensionale Relativitätstheorie eine Überraschung bereit: „Wenn wir damit den Raum in der Nähe eines Schwarzen Loches beschreiben, dann ergibt sich aus den Gleichungen plötzlich eine zweidimensionale Stringtheorie – obwohl wir nirgendwo Strings in unsere Rechnungen eingefügt haben“, erklärt Grumiller.
Dieser Zusammenhang erinnert die sogenannte „AdS-CFT-Korrespondenz“: Diese 1997 aufgestellte Vermutung besagt, dass sich ganz unterschiedliche Theorien (Quanten-Gravitationstheorien und Quantenfeldtheorien) in bestimmten Grenzfällen aufeinander abbilden lassen – vorausgesetzt man nimmt jeweils die passende Anzahl von Raumdimensionen an. Warum es solche Querverbindungen zwischen scheinbar ganz unterschiedlichen Bereichen der Physik gibt, ist bis heute nicht ganz verstanden.
Ein neuer Rechentrick für Schwarze Löcher
Dass die unendlichdimensionale Relativitätstheorie gerade auf eine zweidimensionale Stringtheorie führt, ist für Daniel Grumiller ganz besonders erfreulich: Seine Forschungsgruppe an der TU Wien beschäftigt sich nämlich schon seit vielen Jahren mit zweidimensionalen Quanten-Gravitationstheorien. „Unsere bereits bestehenden Ergebnisse aus der zweidimensionalen Stringtheorie können wir nun aufgrund dieses neuentdeckten Zusammenhangs verwenden, um Aussagen über Schwarze Löcher abzuleiten“, ist Grumiller zuversichtlich.
Solche zweidimensionalen Theorien sind besonders dort interessant, wo der Raum als kugelsymmetrisch angenommen werden kann – etwa rund um ein nichtrotierendes Schwarzes Loch. Um diese physikalische Situation zu beschreiben, benötigt man nur zwei Dimensionen: Den räumlichen Abstand vom Zentrum des Schwarzen Lochs und die Zeit.
Förderungspreis der Stadt Wien
Für seine bisherigen Forschungen im Grenzgebiet zwischen Gravitations- und Quantentheorien erhielt Daniel Grumiller den Förderungspreis für Wissenschaft der Stadt Wien. Er wird einmal jährlich an Personen vergeben, die bereits ein hervorragendes Gesamtwerk vorweisen können, das 40. Lebensjahr allerdings noch nicht vollendet haben.
Grumillers Publikation in Physical Review Letters
Frei zugänglicher Artikel in Arxiv
[1] Creative Commons 2.0, Bild: TU Wien, Ute Kraus, Axel Mellinger
Rückfragehinweis:
Dr. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13634
daniel.grumiller@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Steuerbare Zufallslaser
Zufallslaser sind winzige Körnchen, die ihr Licht unkontrolliert in verschiedene Richtungen abstrahlen. An der TU Wien konnte nun gezeigt werden, dass man dem Zufall auf die Sprünge helfen kann um diese exotischen Lichtquellen präzise zu steuern.
Zufallslaser werden durch einen Lichtstrahl von oben mit Energie versorgt. Zufällige Unregelmäßigkeiten im Inneren (gelbe Punkte) sorgen dafür, dass das Laserlicht in ganz unterschiedliche Richtungen ausgestrahlt wird.
Hier wird der Lichtstrahl zuerst durch eine Maske geschickt, sodass nicht jeder Punkt im Zufallslaser (weißer Kreis) im selben Maß mit Energie versorgt wird. Durch dieses gezielte Pumpen emittiert der Zufallslaser einen Lichtstrahl genau in die gewünschte Richtung.
Das Licht, das sie ausstrahlen, ist ebenso individuell wie ein Fingerabdruck: Zufallslaser sind winzige Strukturen, deren Abstrahlverhalten durch chaotische Lichtstreuung in ihrem Inneren festgelegt ist. Erst seit wenigen Jahren kann man ihr Verhalten erklären, nun wurde an der TU Wien eine Methode präsentiert, mit der sich die Richtung ihrer Strahlung nach Belieben steuern lässt. Was als kuriose Idee begann, wird damit zu einer neuen Art von Lichtquelle.
Chaos statt Spiegel
In gewöhnlichen Lasern wird Licht zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert. Dabei wird das Licht von den Atomen des Lasers immer weiter verstärkt, bis ein Laserstrahl entsteht und aus dem Laser austritt. „Ein Zufallslaser hingegen kommt ohne Spiegel aus“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Er besteht aus einem körnigen Material, in dem das Licht immer wieder abgelenkt und auf komplizierte Bahnen gezwungen wird.“ Entlang dieser Bahnen wird das Licht verstärkt – an welchen Stellen das Licht schließlich aus dem Laser austritt, hängt von der zufälligen inneren Struktur des Lasermaterials ab.
Pumpen mit Licht
Die Energie, die der Laser zur Verstärkung des Lichtstrahls benötigt, muss von außen in Form von Licht zugeführt werden – man spricht von „optischem Pumpen“. Gewöhnliches, ungeordnetes Licht wird in den Laser gepumpt und liefert Energie, im Laser wird daraus geordnetes, kohärentes Laserlicht erzeugt, in dem Lichtteilchen exakt im gleichen Takt schwingen.
„Beim Zufallslaser ist ganz entscheidend, auf welche Weise man ihn pumpt“, sagt Stefan Rotter. Licht wird von oben auf einen scheibenförmigen Zufallslaser gestrahlt, sein Laserlicht sendet er dann radial in alle Richtungen aus. „Unsere Grundidee ist, den Zufallslaser nicht gleichförmig zu pumpen, sondern ihn mit einem ganz bestimmten Lichtmuster zu beleuchten, das dann genau die Laserstrahlung hervorruft, die wir uns wünschen“, sagt Rotter. Durch eine genau passende Beleuchtung regt man verschiedene Regionen des Zufallslasers in unterschiedlichem Maß zur Lichtverstärkung an und kann dadurch erreichen, dass der Laser sein Licht nur in einer ganz bestimmten Richtung aussendet.
Schritt für Schritt zum richtigen Lichtmuster
Wie man nun das richtige Bestrahlungsprofil finden kann, mit dem sich genau das gewünschte Laserlicht hervorrufen lässt, wird an der TU Wien in Computersimulationen untersucht. „Man beginnt mit einem zufällig gewählten Bestrahlungsmuster und beobachtet, welches Laserlicht man dadurch bekommt. Dann passt man gezielt, Schritt für Schritt, dieses Muster an, bis der Laser sein Licht genau in die gewünschte Richtung abstrahlt“, erklärt Rotter.
Nachdem keine zwei Zufallslaser genau gleich sind, muss man diesen Optimierungsprozess für jeden einzelnen Laser individuell durchführen – doch ist die Lösung erst einmal bekannt, kann man damit immer wieder dieselbe Laserstrahlung hervorrufen. Hat man einen Zufallslaser also erst einmal genau analysiert, kann man nach Belieben einstellen, in welche Richtung er strahlt – oder seinen Strahl durch eine zeitliche Abfolge unterschiedlicher Bestrahlungsmuster im Raum herumführen.
Das Team von Stefan Rotter arbeitet derzeit mit einer Forschungsgruppe in Paris zusammen, die Zufallslaser im Labor herstellt und untersucht. Gemeinsam sollen die Ergebnisse der Computersimulationen nun experimentell realisiert werden. Wenn es auch in den bevorstehenden Messungen gelingt zu zeigen, dass in Zufallslasern nichts mehr dem Zufall überlassen werden muss, würde dies einen großen Schritt in Richtung Anwendung für diese exotischen Lichtquellen bedeuten.
Rückfragehinweise:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-680-3063161
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Dipl.-Ing. Matthias Liertzer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13644
matthias.liertzer@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Ehrenmedaille für Prof. Maria Ebel
Maria Ebels jahrzehntelanger Einsatz für die Fakultät für Physik wurde mit der Ehrenmedaille der Fakultät gewürdigt.
Prof. Maria Ebel
Dekan Gerald Badurek übergibt die Medaille
Die Ehrenmedaille der Fakultät für Physik
Prof. Maria Ebel kann auf viele arbeitsintensive und ereignisreiche Jahre an der Fakultät für Physik zurückblicken: Ihr Einsatz galt nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern in ganz bemerkenswertem Ausmaß auch der internationalen Vernetzung der Studierenden. Am 11. Juni wurde ihr die Ehrenmedaille der Fakultät für Physik überreicht. Sie ist erst die zweite Person, der diese Auszeichnung zugesprochen wurde.
Hunderte Auslandskontakte
Auslandssemester sind für Studierende heute etwas beinahe Alltägliches geworden – doch das war nicht immer so. Maria Ebel ist es zu verdanken, dass der internationale Austausch von Studierenden an der TU Wien schon seit langer Zeit so fest etabliert ist. Mehr als hundert ausländische Studierende unterstützte sie dabei, an die TU Wien zu kommen, und 332 Studierende der TU Wien konnten durch ihre Mithilfe Auslandsaufenthalten absolvieren. Zu Beginn knüpfte Maria Ebel in erster Linie Austausch-Kontakte zu Universitäten innerhalb Europas, später kamen dann auch noch die USA und Kanada hinzu.
Auch wissenschaftlich hat Maria Ebel große Erfolge vorzuweisen: 1982 habilitierte sie sich für Photoelektronenspektroskopie, zahlreiche Publikationen und Vorträge im In- und Ausland verhalfen ihr zu hohem Ansehen im Fachbereich der Oberflächenanalyse.
Eine Grußbotschaft der Rektorin Sabine Seidler wurde von Dekan Gerald Badurek überbracht. "Die Verdienste von Maria Ebel sind ganz unglaublich, aufwiegen kann man das gar nicht. Die Ehrenmedaille ist bloß eine winziges Anerkennung für eine Person, der unsere Fakultät enorm viel zu verdanken hat", sagt Gerald Badurek. Die Ehrenmedaille erhielt Maria Ebel in Anwesenheit von zahlreichen WeggefährtInnen, unter ihnen auch der ehemalige Rektor Peter Skalicky.
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Standing Ovations für den TU Chor
Der neue TU Chor hat sein erstes großes Konzert mit – im bildlichen Sinn – fliegenden Fahnen bestanden. Im vollbesetzten Prechtlsaal wurde dem begeisterten Publikum ein buntes Programm von Johann Strauß bis Pink geboten.
Der TU Chor ist das jüngste Kind der Künstlerfamilie der TU Wien und wurde im Oktober 2012 aus der Taufe gehoben. Nach zwei kleineren Auftritten im Dezember und Jänner wagten sich die sangesfreudigen TechnikerInnen aus 10 Studienrichtungen an ihr erstes großes Konzert. Eine Stunde lang erfreuten sie ihre überaus zahlreich erschienenen ZuhörerInnen mit Klassikern wie „Oh, Happy Day“ und „Somewhere over the rainbow“. Neben österreichischen Weisen wie „Is scho still uman See“ und dem „Champagnerlied“ aus der Fledermaus bot der TU Chor auch Gustostücke wie „The Lion sleeps tonight“ und „Only you“ in der Acapella-Version der Flying Pickets. Die 35 Sängerinnen und Sänger überzeugten nicht nur durch ihre stimmlichen Qualitäten, sondern auch mit Choreographie und Ausdrucksstärke. Unterstützung in Form von Percussion, Bass und Ukulele rundete das farbenreiche Klangbild harmonisch ab.
Der Chorleiter Andreas Ipp führte launig und fachkundig durch den Abend. Haben Sie gewusst, dass Johann Strauß am k. & k. polytechnischen Institut, der Vorgängerin der TU Wien, studierte und hinaus geworfen wurde, weil er immerzu komponierte und laut sang? „Das Konzert selber hat viel Spaß gemacht, und es war sehr schön, vor so einem begeisterten Publikum singen zu können.“ zieht er ein zufriedenes Fazit über die gelungene Darbietung von 10 Liedern (plus einer Zugabe) vor 250 enthusiastischen ZuhörerInnen.
Von der durchschlagenden Qualität der Protagonisten waren die Sponsoren bereits im Vorfeld überzeugt; die TU Wien, die Mensa der TU Wien und die Bäckerei Ströck unterstützen der TU Chor.
Wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben, mitzusingen, mehr Information und Bilder finden Sie unter: chor.tuwien.ac.at/mitsingen
Und wenn man in die leuchtenden Gesichter der Sängerinnen und Sänger schaut, weiß man: Singen ist gut für die Seele.
Autorin:
Sylvia Riedler
Institut für Theoretische Physik
E: sylvia.riedler@tuwien.ac.at
TU Chor: Frühlingskonzert
23. Mai 2013, 19:30 Uhr
Prechtlsaal
TU-Hauptgebäude | Erdgeschoss
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Foto:
© Matthias Muggli
TU Chor: Frühlingskonzert
Am 23. Mai 2013 gibt der TU Chor sein erstes öffentliches Konzert – ganz im Zeichen des Frühlings.
Seit Oktober 2012 probt der neue TU Chor und erarbeitet eine breite Palette von Liedern, von Johann Strauss bis Pink. Eine Auswahl dieser Lieder wird am 23. Mai 2013 beim ersten Konzert präsentiert.
Zeit & Ort:
23. Mai 2013, 19:30 Uhr | Einlass: 19:00 Uhr
Prechtlsaal
TU-Hauptgebäude | Erdgeschoss
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Eintritt frei - freiwillige Spenden
Sitzplatzreservierung unter chor@tuwien.ac.at
Webtipp: http://chor.tuwien.ac.at
Fotos:
Sonnenblume © Petra Schmidt/Pixelio.de;
Tulpen © Bernd Kasper/Pixelio.de,
Noten © Pambieni/Pixelio.de
Autorin:
Nicole Schipani
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
nicole.schipani@tuwien.ac.at
Möchten Sie Ihr schwarzes Loch mit Milch?
Zwischen dem Verhalten ultraheißer Teilchen und dem Kollaps eines schwarzen Loches gibt es erstaunliche mathematische Verbindungen. An der TU Wien nutzt man das, um mehr über die rätselhafte Physik des Quark-Gluon-Plasmas herauszufinden.
Schwarze Löcher, Teilchenphysik und thermischer Ausgleich: eine Melange aus unterschiedlichen physikalischen Gebieten
Stefan Stricker (l) und Dominik Steineder (r)
Fast mit Lichtgeschwindigkeit lässt man am CERN Atomkerne miteinander kollidieren. Dabei werden sie in ihre elementaren Bestandteile aufgelöst und bilden ein Quark-Gluon-Plasma, einen ultraheißen Materiezustand, in dem sich kurz nach dem Urknall die gesamte Materie des Universums befand. Dieses Plasma überrascht mit unerwarteten Eigenschaften: Es scheint dünnflüssiger zu sein als jede gewöhnliche Flüssigkeit und strebt erstaunlich schnell in ein Temperatur-Gleichgewicht – ein Prozess, den man als „Thermalisierung“ bezeichnet. An der TU Wien wird diese Thermalisierung mit Methoden berechnet, die nicht aus der Teilchenphysik, sondern aus der Gravitationstheorie kommen.
Die flüssigste Flüssigkeit der Welt
Wenn man Milch in heißen Kaffee leert, dann vermischen sich die Flüssigkeiten und gleichen ihre Temperatur an. Das bunte Gewirr an Quarks und Gluonen, das sich nach einer Kollision von schweren Atomen am CERN ungeordnet durcheinanderbewegt, verhält sich ähnlich. „Ursprünglich dachte man, die Teilchen würden sich verhalten wie Atome in einem Gas“, sagt Stefan Stricker, doch Messungen zeigen, dass die Sache viel komplizierter ist. In einem Gas stoßen Atome aneinander, abgesehen davon beeinflussen sie sich kaum. Die Teilchen im Quark-Gluon-Plasma hingegen sind stark aneinander gekoppelt und verhalten sich wie eine extrem dünne Flüssigkeit – das Plasma ist gewissermaßen die flüssigste Flüssigkeit der Welt.
Warum das Quark-Gluon-Plasma so extrem dünnflüssig ist und warum es so extrem schnell einem thermischen Gleichgewichtszustand zustrebt, gehört noch immer zu den großen Geheimnissen der modernen Physik. „Teilchen, die nur schwach wechselwirken, sind mathematisch recht einfach zu beschreiben“, erklärt Stefan Stricker. Bei starken Kopplungen versagen allerdings die gängigen Rechenmethoden.
Schwarze Löcher als Rechentrick
Der Trick, mit dem die Forschungsgruppe an der TU Wien dieses Problem umgeht, wurde in den Neunzigerjahren entdeckt, seither bewährt er sich immer wieder aufs Neue. „Es zeigt sich, das Quantentheorien, die man zur Beschreibung des Quark-Gluon-Plasmas braucht, sehr eng in Verbindung mit Gravitationstheorien stehen“, erklärt Stefan Stricker, „und zwar mit einer höherdimensionalen Erweiterung der Gravitationstheorie.“ Genau wie ein zweidimensionales Quadrat als Randfläche eines dreidimensionalen Würfels betrachtet werden kann, lässt sich auch unsere Welt mit drei Raumdimensionen als Rand eines größeren Raumes betrachten, der vier Raumdimensionen hat. „Die Teilchenphysik in drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension lässt sich in Gravitationsphysik in vier Raumdimensionen und einer Zeitdimension übersetzen“, sagt Stricker.
Anstatt zu berechnen, wie das Plasma thermisch ins Gleichgewicht strebt, übersetzt man daher das Problem auf eine ganz andere physikalische Situation im höherdimensionalen Raum: Man berechnet den Kollaps einer Kugelschale, die sich zu einem schwarzen Loch zusammenzieht. Das Ergebnis lässt sich dann wieder auf die Physik des Quark-Gluon-Plasmas zurückübertragen. Dieses Vorgehen, ganz unterschiedliche Gebiete der Physik mathematisch ineinander überzuführen, ist höchst ungewöhnlich. Vollständig verstanden ist diese Symmetrie zwischen Quantenfeldtheorien und Teilchen auf der einen Seite und Stringtheorie, Gravitation und schwarzen Löchern auf der anderen Seite bis heute nicht. „Es gibt keinen mathematischen Beweis, der diese Symmetrie zwischen zunächst ganz unterschiedlichen Theorien erklärt“, sagt Stefan Stricker, „doch mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von korrekten Rechenergebnissen, die auf diese Weise gewonnen wurden.“
Gleichgewicht auf verschiedenen Ebenen
Mit Hilfe von Computersimulationen versuchten Stefan Stricker und Dominik Steineder von der TU Wien gemeinsam mit Aleksi Vuorinen von der Universität Bielefeld den Geheimnissen der Quark-Gluon-Plasma-Thermalisierung auf die Spur zu kommen. Dabei erkannten sie, dass zwei entgegengesetzte Prozesse an dieser Thermalisierung beteiligt sind. „Das System strebt nicht auf jeder Energie- oder Größenskala gleich schnell ins Gleichgewicht“, sagt Stefan Stricker. Temperaturen gleichen sich normalerweise zuerst auf mikro-Skala, dann erst auf großer Skala an – man spricht dann von einer „top-down-Thermalisierung“. Eng benachbarte Punkte haben sehr rasch fast dieselbe Temperatur, weit entfernte Regionen können hingegen zunächst noch ganz unterschiedliche Temperaturen haben. Beim Quark-Gluon-Plasma kann das allerdings auch umgekehrt ablaufen.
Dass das Streben in ein Gleichgewicht auf unterschiedlichen Größenskalen unterschiedlich aussehen kann, kennt man vom Mischen verschiedener Flüssigkeiten: So wird Milchkaffee zwar sehr rasch homogen und gleichmäßig braun, doch auf mikroskopischer Ebene kann man Kaffee und Milchtröpfchen noch immer unterscheiden. Umgekehrt sieht die Sache aus, wenn man zähe Substanzen mischt – etwa Honig und Schokomousse. Dann sieht das Gemisch auf mikroskopischer Skala zwar lokal zunächst noch gleichmäßig aus, doch im Großen sind unterschiedliche Komponenten sichtbar.
„Dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Größenskalen sehen wir auch bei der Thermalisierung des Quark-Gluon-Plasmas: Abhängig davon, wie stark die Teilchen miteinander gekoppelt sind, strebt das System entweder auf großer oder auf kleiner Längenskala rascher ins Gleichgewicht“, erklärt Stricker. Um die bemerkenswerten Eigenschaften des Quark-Gluon-Plasmas verstehen zu können muss man beide diese Sichtweisen gleichzeitig in die Berechnungen einbeziehen, ist das Forschungsteam nun sicher. Doch vielleicht sind bis zur endgültigen Klärung der Geheimnisse des Quark-Gluon-Plasmas noch einige ähnlich phantasievolle Tricks nötig, wie jene, die bereits in den letzten Jahren unser Verständnis über das Quark-Gluon-Plasma so sehr erweitert haben.
Nähere Informationen:
Dr. Stefan Stricker
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T +43 1 58801 13637
stefan.stricker@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Stefan Nagele - Promotio Sub Auspiciis Praesidentis Rei Publicae
Drei TU-Absolventen erreichen am 12. April den vorläufigen Höhepunkt ihrer außergewöhnlichen akademischen Karriere: Die Sub auspiciis Promotion. Die Bestleistungen in Schule und Studium werden von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer mit der Überreichung des Goldenen Ehrenringes der Republik gewürdigt.
Promoventen mit Bundespräsident Fischer und Rektorin Seidler
[Foto: Copyright: TU Wien | Foto: Thomas Blazina]
DI Stefan Nagele [Foto: Privat]
Promotio Sub Auspiciis Praesidentis Rei Publicae
Freitag, 12. April 2013, 11:00 Uhr
Festsaal der TU Wien
Karlsplatz 13, Stiege 1, 1. Stock
1040 Wien
Den akademischen Grad "Doktor der technischen Wissenschaften" erhalten:
Dipl.-Ing. Thomas Wannerer
Dissertationsthema: "SO(n) equivariant Minkowski Valuations"
Fakultät für Mathematik und Geoinformation
Dipl.-Ing. Manuel Friedrich Weberndorfer
Dissertationsthema: "Reverse Affine Isoperimetric Inequalities"
Fakultät für Mathematik und Geoinformation
Dipl.-Ing. Stefan Nagele
Dissertationsthema: "Ultrafast electronic dynamics in one- and two-electron atoms"
Fakultät für Physik
Goldener Ehrenring der Republik
Der gebürtige Salzburger Dipl.-Ing. Stefan Nagele absolvierte nach dem Privatgymnasium Borromäum das Diplomstudium Technische Physik an der TU Wien (2001-2007). In das Diplomstudium integrierte er auch einen Auslandsaufenthalt an der KTH Stockholm. Mit dem ausgezeichneten Diplom in der Tasche startete Nagele 2007 in das Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften an der TU Wien, parallel dazu war er bis 2012 Fellow der International Max Planck Research School of Advanced Photon Science. Bewusst auf eine Sub auspiciis Promotion hingearbeitet hat der Physiker nicht. "Das Physik-Studium war für mich außerordentlich interessant, und ich habe immer schon gerne gelernt - bei den Prüfungen eben solange, bis ich den Stoff verstanden habe. Die guten Noten haben sich dann eigentlich daraus ergeben", so Nagele. Gegen Studienende war die Möglichkeit einer Sub auspiciis Promotion aber doch ein zusätzlicher Ansporn.
Direkte Vorteile – z.B. bei künftigen Arbeitgebern - erwarte er nicht, es sei aber eine sehr schöne Geste der Anerkennung durch die Republik. Eine konkrete Anwendung für den mit der Promotion verbundenen Würdigungspreis und das mögliche Exzellenzstipendium des Wissenschaftsministeriums sieht Nagele in der Finanzierung von Forschungsaufenthalten im Ausland. Der Sub auspiciis Promovend bleibt der TU Wien vorerst als Universitätsassistent am Institut für Theoretische Physik erhalten. Befragt nach seinen Zukunftsplänen antwortet Nagele: "Die berufliche Vision für die nächste zehn Jahre ist aus jetziger Sicht das Erreichen einer Professur. Wenn die Bedingungen an den Universitäten aber nicht passen, kann ich mir auch eine Karriere abseits der Universität sehr gut vorstellen."
Rückfragehinweis:
Stefan Nagele
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13607
stefan.nagele[@]tuwien.ac.at
Aussender:
Herbert Kreuzeder
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
pr@tuwien.ac.at
Zwischen Physik und Chemie
Stefanie Gräfe forschte an der TU Wien an kleinen Molekülen und ihrer Wechselwirkung mit Laserlicht. Nun tritt sie eine Professur in Jena an.
Stefanie Gräfe
Wer ein einzelnes Atom untersucht, macht Physik. Sind zwei Atome bereits Chemie? Gerade anhand kleiner Moleküle lassen sich interessante Phänomene untersuchen. „Manche Chemiker betrachten solche Systeme als zu klein um für die Chemie relevant zu sein, für die Physik hingegen sind sie schon fast zu groß, um sie exakt berechnen zu können“, sagt Stefanie Gräfe. Seit 2008 forschte sie am Institut für Theoretische Physik der TU Wien, nun tritt sie eine Professur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena an.
Grenzgängerin zwischen den Wissenschaften
Stefanie Gräfe ist studierte Chemikerin, hatte aber schon bei ihrer Doktorarbeit in Würzburg viel mit Physik zu tun: „In der physikalische Chemie spielen bei der Charakterisierung verschiedener Moleküle physikalische Methoden eine sehr wesentliche Rolle, zum Beispiel die Spektroskopie“, erklärt sie. Sie untersuchte damals, wie man mit Lasern Einfluss auf das Verhalten von Molekülen nehmen kann. Als Postdoc arbeitete sie dann zunächst in Ottawa, Kanada, in einer Physik-Gruppe. Dort forschte man an Atomen in starken Laserfeldern. Gräfe erweiterte die Rechenmethoden, sodass mit ihnen auch Moleküle berechnet werden konnten.
„Der Schritt zur Physik war zunächst schon eine große Umstellung“, meint Stefanie Gräfe heute. „Es gibt doch deutliche Unterschiede in der Mathematik- und der Quantentheorie-Ausbildung zwischen einem Physik- und einem Chemiestudium.“ Doch gerade das präzise Arbeiten mit den fundamentalen Grundgleichungen der Quantenmechanik fand Gräfe immer spannend.
2008 kam Stefanie Gräfe mit einem Lise Meitner Stipendium an die TU Wien – gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Daniil Kartashov, den sie in Kanada kennengelernt hatte. Gräfe arbeitete am Institut für Theoretische Physik. Kartashov, ein Experimentalphysiker, ging ans Institut für Photonik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. 2011 wurde Stefanie Gräfe mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet und verlängerte ihren Aufenthalt in Wien, nachdem sie durch eine Vertretungsprofessur bereits Kontakte mit der Universität Jena geknüpft hatte.
Chemie-Professorin nach Physik-Postdoc
Nach fünf Jahren an der TU Wien erhielt Stefanie Gräfe nun einen Ruf auf eine Professur für Theoretische Chemie in Jena, auch ihr Ehemann wird ihr in wenigen Monaten an die Universität Jena nachfolgen. „Ehepartner, die beide in der Wissenschaft tätig sind, haben es immer extrem schwer, Jobs in der selben Stadt zu finden“, sagt Gräfe. „Ich bin sehr froh, dass uns das in Jena gelungen ist.“
Stefanie Gräfe wird in Jena ihre Arbeit im Bereich der Wechselwirkung von Laserlicht und Molekülen fortsetzen, auch weitere Kooperationen mit der TU Wien sind geplant. „Die Universität Jena will ausdrücklich die fakultätsübergreifenden Verbindungen zwischen Chemie und Physik stärken, das kommt mir natürlich sehr gelegen“, sagt Gräfe. Zusätzlich wird sie an klassischeren materialchemische Forschungsprojekten mitarbeiten, etwa im Bereich der Solarzellenforschung.
Rückfragehinweis:
Dr. Stefanie Gräfe
Institut für Physikalische Chemie
Universität Jena
Helmholtzweg 4
07743 Jena
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Quanteneffekte in Super-Zeitlupe
Mit Hilfe von Laserpulsen lassen sich immer kürzere Zeiträume auflösen. Dadurch eröffnen sich ganz neue Einblicke in die Physik der Atome und Moleküle.
Ultrakurze Laserpulse und ihre Wechselwirkung mit Atomen und Molekülen: Auf ungeheuer kurzen Zeitskalen laufen Quanten-Phänomene ab.
v.l.n.r.: Joachim Burgdörfer, Stefan Nagele, Renate Pazourek
Haben Sie schon einmal versucht, eine vorbeifliegende Libelle zu fotografieren? Schnelle Bewegungen, rasche Prozesse sind schwer zu beobachten. Ganz besonders trifft das auf Vorgänge in der Quanten-Welt zu: Mit Millionen Kilometern pro Stunde bewegen sich Elektronen rund um den Atomkern. Die Zeitskala, auf der atomare Prozesse ablaufen, ist so kurz, dass sie mit unserer menschlichen Vorstellung kaum fassbar ist. Trotzdem gelingt es heute, in diesen Bereich vorzudringen. Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse lässt sich der zeitliche Ablauf von Quanten-Prozessen beobachten. Am Institut für Theoretische Physik der TU Wien wird daran seit Jahren erfolgreich geforscht.
Attosekunden: Der Takt, in dem die Quanten tanzen
Elektronen, die aus dem Atom herausgerissen werden oder Moleküle, die auseinanderbrechen – Quantenphänomene laufen meist sehr schnell ab. Sogar die Zeitskala moderner Mikroelektronik, die mit Gigahertz-Taktfrequenzen arbeitet, wirkt dagegen noch recht gemächlich. Untersucht werden diese Phänomene, indem man ultrakurze Laserpulse auf einzelne Atome oder Moleküle abfeuert.
Mittlerweile lassen sich Laserpulse in der Größenordnung von Attosekunden herstellen. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel eines Milliardstels einer Sekunde, also 10 hoch minus 18 Sekunden. Verglichen mit den Zeitskalen, mit denen wir im täglichen Leben zu tun haben, ist das unvorstellbar kurz: „Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde etwa so wie eine Sekunde zum Alter des Universums“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer, Vorstand des Instituts für Theoretische Physik. Die Lichtwelle des Attosekunden-Laserpulses hat nur Zeit für einige wenige Schwingungen, bevor der Laserpuls wieder vorüber ist.
Mit Papier, Bleistift und Supercomputern
Experimentelle und theoretische Forschung arbeiten in der Attosekundenphysik meist eng zusammen. Um die experimentellen Daten wirklich verstehen zu können, sind quantenphysikalische Computersimulationen notwendig – dafür nützt die Gruppe am Institut für theoretische Physik einige der leistungsfähigsten Computercluster der Welt. Auch der hauseigene Supercomputer VSC2, der seit 2011 für die Forschung zur Verfügung steht, ist für die Attosekunden-Forschungsgruppe ein wichtiges Werkzeug geworden. Viele der Quantenphänomene, mit denen man am Institut für Theoretische Physik beschäftigt, werden nur wenige hundert Meter weiter, am Institut für Photonik (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik) experimentell untersucht. Auch mit anderen weltweit führenden Experimentalgruppen gibt es enge Zusammenarbeit – etwa zum Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.
Kontrolle über Quantenteilchen
Die Attosekundenphysik ist heute ein boomendes Forschungsgebiet, das auf der ganzen Welt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Das liegt nicht nur daran, dass man durch neue Attosekunden-Forschung einen tieferen Einblick in die fundamentalen Konzepte der Quantenphysik erhält, sondern auch an den technologischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. „Letzten Endes sollen ultrakurze Laserpulse dazu verwendet werden können, genau zum richtigen Zeitpunkt in atomare und molekulare Prozesse eingreifen zu können, zum Beispiel um gezielt chemische Bindungen aufzubrechen oder gewünschte Reaktionen zu beschleunigen“, sagt Renate Pazourek vom Institut für Theoretische Physik. „Dazu muss man allerdings das Zusammenspiel zwischen Licht und Materie noch besser verstehen und viele technologische Probleme besser in den Griff bekommen.“ So könnten sich etwa eines Tages Moleküle mit Hilfe von Laserpulsen in genau definierte Bruchstücke aufspalten lassen – doch bis das tatsächlich möglich wird, muss sich die Attosekundenphysik wohl noch einige Zeit lang ähnlich dynamisch weiterentwickeln, wie sie das auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan hat.
Rückfragehinweis:
Dr. Renate Pazourek
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13633
renate.pazourek[@]tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
EUR 400.000 für Schwarze Löcher und das holographische Prinzip
Internationale Projekte bewilligt - Argentinien, Korea, Deutschland
Im Jaenner 2013 wurde vom oesterreichischen akademischen Austauschdienst ein bilaterales Projekt zwischen Argentinien und dem Institut fuer Theoretische Physik an der TU Wien bewilligt. Mit den kuerzlich bewilligten bilateralen FWF-Projekten mit der LMU Muenchen und der Seoul National University stehen unserem Institut neue Forschungs- und Reisemittel im Umfang von ueber 400.000 (vierhunderttausend) Euro zur Verfuegung. Daniel Grumiller, der diese Mittel eingeworben hat, kann damit seine Forschungsgruppe zu Schwarzen Loechern und Quantengravitation weiter ausbauen.
Das holographische Prinzip
Wissenschaftlich beschaeftigen sich diese Projekte mit neuen Aspekten des holographischen Prinzips, das eine erstaunliche Relation zwischen Quantengravitationstheorien in z.B. drei Dimensionen und Quantenfeldtheorien in zwei Dimensionen herstellt. Aehnlich wie bei einem Hologramm wird 3-dimensionale Information auf 2 Dimensionen abgebildet (siehe [| Dreidimensional? Vierdimensional? Völlig egal!]).
Vielfältige Verwendung
Anwendungen hat dieses Prinzip in zwei verschiedene Richtungen, die beide an unserem Institut vertreten sind. Anton Rebhans Gruppe verwendet es, um sehr komplexe Probleme in Quantenfeldtheorien auf vergleichsweise einfache in Gravitationstheorien abzubilden und damit z.B. die Physik von Schwerionenstoessen am LHC und RHIC besser zu verstehen. Daniel Grumillers Gruppe verwendet es, um sehr schwierige Probleme in Quantengravitation auf vergleichsweise einfache in Quantenfeldtheorie abzubilden und damit konzeptuelle Fragen der Quantengravitation zu diskutieren, z.B. ein mikroskopisches Verstaendnis der Entropie von Schwarzen Loechern.
Einer der innovativen Aspekte dieser Projekte ist die Verwendung von Theorien mit hoeherem Spin (siehe [| Wenn Quanten und Gravitation Walzer tanzen]), die das Aufstellen von neuen holographischen Korrespondenzen erlaubt.
Rückfragehinweis:
Dr. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13634
grumil[@]hep.itp.tuwien.ac.at
Gefrorenes Chaos
Iva Březinová gelang es, mit Hilfe der Chaostheorie das Verhalten von ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten zu erklären. Dafür erhält sie den Hannspeter-Winter-Preis der TU Wien.
Hannspeter-Winter-Preisträgerin Iva Březinová
Es ist wohl der exotischste aller Materiezustände: Bei extrem niedrigen Temperaturen, knapp über dem absoluten Nullpunkt, können Atome zu einem Bose-Einstein-Kondensat zusammenfrieren. Sie befinden sich dann gemeinsam im gleichen Energiezustand und bewegen sich im Gleichtakt – ein Effekt der beispielsweise auch für die Supraleitung verantwortlich ist. Dass bei der Bewegung von Bose-Einstein-Kondensaten die Chaostheorie eine wichtige Rolle spielt, hatte man nicht vermutet. Iva Březinová vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien verknüpfte in ihren Computersimulationen allerdings Quantenphysik und Chaostheorie um den Rätseln des Bose-Einstein-Kondensats auf den Grund zu gehen. Sie bekommt dafür am 25. Jänner den Hannspeter-Winter-Preis der TU Wien.
Ultrakalte Quanten-Wellen
In der Quantenphysik wird jedes Teilchen als Welle beschrieben. Je niedriger die Temperatur ist, umso langsamer bewegen sich die Teilchen und umso größer wird die Wellenlänge. Knapp über dem absoluten Nullpunkt übersteigt die Länge der Teilchenwellen den durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Teilchen – die Wellen überlappen, ein Bose-Einstein-Kondensat entsteht. Die einzelnen Teilchen verlieren ihre Individualität, sie können nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden und vereinen sich zu einem einzigen großen Quantenobjekt. Das Bose-Einstein-Kondensat kann eine Größe von mehreren Mikrometern haben – in quantenphysikalischen Maßstäben betrachtet sind das gigantische Ausmaße.
Das Chaos in den Wellen
„Eigentlich ist das Bose-Einstein-Kondensat der geordnetste Zustand, den man sich vorstellen kann“, sagt Iva Březinová. „Und trotzdem zeigt sich in unseren Berechnungen, dass Chaos wichtige Hinweise über den Zustand des Kondensats geben kann.“ In Computersimulationen lässt sich nämlich berechnen, wie die Quanten-Wellen des Bose-Einstein-Kondensats durch winzige Unregelmäßigkeiten der Umgebung beeinflusst werden.
Bereits kleinste Störungen – etwa unregelmäßige elektromagnetische Felder – können die Bewegung der Quanten-Welle dramatisch verändern. „Zwei Quanten-Wellen, die zu Beginn fast völlig gleich aussehen, entwickeln sich chaotisch auf ganz unterschiedliche Weise, und nach einer gewissen Zeit ergeben sich völlig unterschiedliche End-Zustände“, erklärt Březinová. Genau das ist das entscheidende Kennzeichen chaotischen Verhaltens: Winzige Unterschiede in den Anfangsbedingungen können riesige Auswirkungen haben und zu völlig unterschiedlichen Endzuständen führen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Schmetterlingseffekt: Die kaum wahrnehmbaren Änderungen der Luftströmung, die der Flug eines Schmetterlings verursacht, können theoretisch den Verlauf des Wetters drastisch verändern, und letzten Endes vielleicht sogar darüber entscheiden, ob ein Wirbelsturm entsteht oder nicht.
Chaos dampft Atome fort
Das chaotische Verhalten der Quanten-Wellen hat eine wichtige Bedeutung für die Stabilität des Bose-Einstein-Kondensats: „Ein wesentliches Problem bei Experimenten entsteht, wenn die Atome aufhören sich im Gleichtakt zu bewegen. Das passiert genau dann, wenn einzelne Atome des Kondensats plötzlich mehr Energie bekommen, aus dem gemeinsamen Quanten-Zustand ausbrechen und das Kondensat verlassen“, sagt Iva Březinová. „Unsere Berechnungen zeigen, dass dieser Effekt dann eine wichtige Rolle spielt, wenn sich die Quanten-Welle des Bose-Einstein-Kondensats chaotisch verhält.“
Hannspeter-Winter-Preis für herausragende Dissertation
Jedes Jahr wird der Hannspeter-Winter-Preis an eine Absolventin des Doktoratsstudiums der TU Wien vergeben. Er ist mit € 10.000 dotiert und wird gemeinsam von der TU Wien und der BA/CA-Stiftung finanziert. Der Forschungspreis wurde im Gedenken an TU-Professor Hannspeter Winter gestiftet, der sich stets für die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen eingesetzt hat. Iva Březinová verfasste ihre Dissertation unter Anleitung von Prof. Joachim Burgdörfer am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Sie promovierte am 8. Juni 2012 sub auspiciis, in Anwesenheit von Bundespräsident Heinz Fischer.
Iva Březinovás Dissertation entstand im Rahmen des Doktoratsprogrammes CoQus (Complex Quantum Systems), das von der TU Wien und der Universität Wien gemeinsam betrieben wird.
Rückfragehinweis:
Dr. Iva Březinová
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13625
iva.brezinova[@]tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Ultrakurze Laserpulse kontrollieren chemische Prozesse
Wie kann man Moleküle gezielt zerbrechen? Ein neues Experiment an der TU Wien zeigt, wie die Forschung an ultrakurzen Laserpulsen mit der Chemie verknüpft werden kann.
Ein kurzer Laserpuls trifft auf ein Molekül (hier: Butadien), das in zwei Bruchstücke zerfällt.
Apparatur für die Vermessung der im Laserpuls erzeugten Molekülfragmente
Laseroptik am Institut für Photonik der TU Wien
Chemische Reaktionen laufen so schnell ab, dass es mit herkömmlichen Methoden völlig unmöglich ist, ihren Verlauf zu beobachten oder gar zu steuern. Doch immer wieder ermöglichen neue Entwicklungen in der Elektrotechnik und der Quantentechnologie, ein genaueres Verständnis und eine bessere Kontrolle über das Verhalten von Atomen und Molekülen zu erzielen. An der TU Wien gelang es nun, mit ultrakurzen Laserpulsen Einfluss auf das Zerbrechen großer Moleküle mit bis zu zehn Atomen auszuüben.
Der Lichtblitz, der Moleküle bricht
Der Bruch eines Moleküls ist ein Beispiel für eine elementare chemische Reaktion. Molekulare Bindungen mit einem Laserpuls zu zerbrechen ist relativ einfach. Viel schwieriger ist es allerdings, den Bruch einer bestimmten Bindung gezielt zu beeinflussen, also kontrolliert herbeizuführen oder zu unterdrücken. Um das zu erreichen, muss man in die komplexen Vorgänge auf atomarer Ebene eingreifen. Am Institut für Photonik der TU Wien macht man das mit speziell geformten Laserpulsen, mit einer Dauer von nur wenigen Femtosekunden. Eine Femtosekunde (10^-15 Sekunden) ist ein Millionstel einer Milliardstelsekunde.
Schnelle Elektronen, träge Atomkerne
Ein Kohlenstoffatom hat rund 22000 mal mehr Masse als ein Elektron. Daher ist es auch verhältnismäßig träge und nicht so leicht von seinem Aufenthaltsort fortzubewegen. Ein Laserpuls kann die Bewegung der kleinen, leichten Elektronen daher viel rascher verändern als die der Atomkerne: Ein Elektron kann aus dem Molekül herausgerissen werden, dann durch das Feld des Laserpulses zum Umkehren gebracht werden und wieder mit dem Molekül zusammenstoßen. Bei diesem Zusammenstoß kann das Elektron dann zusätzlich noch ein zweites Elektron aus dem Molekül reißen. So entsteht ein doppelt geladenes Molekül, das dann unter Umständen in zwei einfach geladene Bruchstücke aufbrechen kann.
„Bis sich die Atomkerne ausreichend weit voneinander entfernen und das Molekül in zwei Teile bricht, vergehen normalerweise viele Femtosekunden“, sagt Markus Kitzler vom Institut für Photonik der TU Wien. Der Zusammenstoß des Elektrons mit dem Molekül dauert hingegen nur einige hundert Attosekunden (10^-18 Sekunden). „Wir haben es also mit zwei verschiedenen Zeitskalen zu tun“, erklärt Kitzler. „Unsere speziell geformten ultrakurzen Laserpulse beeinflussen die rasch beweglichen Elektronen. Dadurch, dass die Elektronen durch den Zusammenstoss kontrolliert in einen anderen Zustand versetzt werden, beginnen sich dann auch die großen, trägen Atomkerne zu bewegen.“
Mit dieser Technik konnte das TU-Forschungsteam nun erstmals zeigen, dass bestimmte elementare chemische Reaktionen bei verschiedenen Kohlenwasserstoffmolekülen auch kontrolliert initiiert oder unterdrückt werden können, wenn die Bewegung der Atomkerne indirekt über die viel schnelleren Elektronen beeinflusst wird. Entscheidend dafür ist die genaue Form der Laserpulse.
Die Rolle der Elektronenbewegung für die Chemie
Um die experimentellen Daten richtig deuten zu können und um zu verstehen, was bei diesen unglaublich schnellen Vorgängen auf atomarer und elektronischer Ebene eigentlich passiert, sind auch theoretische Berechnungen und Computersimulationen nötig. Diese wurden ebenfalls an der TU Wien durchgeführt – am Institut für Theoretische Physik, das mit dem Institut für Photonik in Attosekunden-Projekten zusammenarbeitet. Mit der nun vorgestellten Methode kann man nicht nur beobachten ob und wie ein Molekül zerbricht. „Die Experimente und Simulationen zeigen, wie man durch präzises Kontrollieren des Laserpulses nun auch gezielt in den Ablauf chemischer Prozesse eingreifen kann“, sagt Katharina Doblhoff-Dier vom Institut für Theoretische Physik.
Originalpublikation:
X. Xie et al.: | Attosecond-Recollision-Controlled Selective Fragmentation of Polyatomic Molecules, PRL 109, 243001 (2012).
Rückfragehinweis:
Dr. Markus Kitzler
Institut für Photonik
Technische Universität Wien
Gußhausstraße 25-29, 1040 Wien
T: +43-1-58801-38772
markus.kitzler@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Schwingende Saiten zwischen zwei Buchdeckeln
Wichtige Beiträge zur Stringtheorie leistete der verstorbene Prof. Maximilian Kreuzer an der TU Wien. Nun wird ein Buch über sein Werk präsentiert.
Maximilian Kreuzer: 1960 – 2010
Ein Schnitt durch eine 6-dimensionale Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit, dargestellt durch Einbettung in unseren 3-dimensionalen Raum.
Vor fast genau zwei Jahren starb Prof. Maximilian Kreuzer, im Alter von erst 50 Jahren. Als Grenzgänger zwischen Physik und Mathematik hinterließ er bemerkenswerte Beiträge zur Stringtheorie, die auch in Zukunft weiterleben werden – in stringtheoretischer Forschungsarbeit auf der ganzen Welt. Im Gedenken an Maximilian Kreuzer wird nun ein Buch herausgegeben, das einen Einblick in die Stringtheorie gewährt und in Kreuzers Forschungsleistungen einführt. Präsentiert wurde das Buch "Strings, Gauge Fields, and the Geometry Behind - The Legacy of Maximilian Kreuzer" bei einer prominent besetzten wissenschaftlichen Veranstaltung, dem "Vienna Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory".
Stringtheorie: Quanten und Relativität
Mit Hilfe der Stringtheorie hofft man, eines der großen naturwissenschaftlichen Rätsel unserer Zeit zu lösen: Wie hängen Quantentheorie und Einsteins Gravitationstheorie zusammen? Kann man sie innerhalb einer einzigen, gemeinsamen Theorie verstehen? In der Stringtheorie gibt es neben den uns vertrauten drei Raumdimensionen noch sechs weitere, die allerdings nur auf winzigsten Abmessungen eine Rolle spielen.
Die Geometrie des Universums
"Max Kreuzer wurde besonders durch zwei große Leistungen bekannt", sagt sein langjähriger Weggefährte Prof. Anton Rebhan: "Erstens klassifizierte er Anomalien in Feldtheorien und Gravitation, und zweitens gelang es ihm, die sogenannten vierdimensionalen reflexiven Polyeder vollständig zu klassifizieren." Diese vierdimensionalen geometrischen Objekte spielen in der Stringtheorie eine große Rolle. Mit ihrer Hilfe lässt sich beschreiben, auf welche Weise die überzähligen, uns unzugänglichen Raumdimensionen zusammengeknüllt sind und dadurch unsichtbar bleiben. Bereits in der Antike studierte man Polyeder – doch in vier Dimensionen ist die Sache recht kompliziert: Max Kreuzer gelang es durch eigens entwickelte Computerprogramme, alle 473,800,776 vierdimensionalen reflexiven Polyeder aufzulisten und als Datenbank der Forschungs-Community zur Verfügung zu stellen.
Beiträge für das Buch "Strings, Gauge Fields, and the Geometry Behind - The Legacy of Maximilian Kreuzer" lieferten prominente Stringtheoretiker aus der ganzen Welt, die mit Maximilian Kreuzer zusammengearbeitet hatten – etwa Joseph Polchinski (USA) oder Philip Candelas (Großbritannien). Friedemann Brandt und Norbert Dragon steuern bisher unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen über die Klassifikation von Anomalien bei, TU-Dozent Harald Skarke erarbeitete gemeinsam mit anderen Weggefährten Kreuzers eine umfassende Beschreibung des Softwarepaketes PALP, das von Kreuzer und Skarke für die Klassifikation reflexiver Polyeder entwickelt wurde.
Näheres zum Buch: http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8561
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Die schnellste Stoppuhr der Welt – bald am CERN?
An der TU Wien wurde eine Methode vorgeschlagen, millionenfach kürzere Lichtblitze zu vermessen als bisher – und zwar mit Geräten, die schon in wenigen Jahren am CERN aufgebaut werden sollen.
Zwei Blei-Atome kollidieren. Dabei entsteht ein Quark-Gluon-Plasma, das ultrakurze Lichtpulse aussenden kann.
Peter Somkuti (l) und Andreas Ipp (r)
Bei der Kollision schwerer Atomkerne am CERN sollten sich die kürzesten Lichtblitze der Welt erzeugen lassen, das konnte ein Forschungsteam der TU Wien in Computersimulationen zeigen. Doch was nützen die kürzesten Lichtpulse, wenn sie zu schnell vorüber sind, um von heutigen Geräten überhaupt vermessen werden zu können? Nun wurde im Journal „Physical Review Letters“ eine Methode präsentiert, für die ultrakurzen Lichtpulse die genaueste Stoppuhr der Welt herzustellen – mit Hilfe eines Detektors, der im Jahr 2018 in die Anlage des LHC-Beschleunigers am CERN eingebaut werden soll.
Klein, kurz und heiß
Ultrakurze Lichtpulse werden verwendet, um physikalische Vorgänge zu untersuchen, die auf extrem kurzen Zeitskalen ablaufen. Mit speziellen Lasern sind heute Pulse in der Größenordnung von Attosekunden möglich – Milliardstel einer Milliardstelsekunde (10 hoch -18 Sekunden). „Bei Kern-Kollisionen in Teilchenbeschleunigern wie dem LHC am CERN oder am RHIC in den USA können aber Lichtpulse erzeugt werden, die noch einmal millionenfach kürzer sind“, sagt Andreas Ipp vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Beim Experiment ALICE am CERN werden Blei-Atomkerne fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann zur Kollision gebracht. Aus Bestandteilen der Atomkerne und vielen weiteren Teilchen, die durch die Wucht des Aufpralls direkt beim Zusammenstoß erzeugt werden, entsteht ein Quark-Gluon-Plasma – ein Materiezustand, der so heiß ist, dass selbst Protonen und Neutronen aufgeschmolzen werden. Die elementaren Bestandteile der Materie – Quarks und Gluonen – bewegen sich wirr durcheinander. Dieses Quark-Gluon-Plasma existiert nur für die unvorstellbar kurze Zeitspanne von einigen Yoktosekunden (10 hoch -24 Sekunden).
Ideen aus der Astronomie
Im Quark-Gluon-Plasma nach einer Teilchenkollision können auch Lichtblitze entstehen, in denen wertvolle Information über das Plasma steckt. Doch herkömmliche Messmethoden sind viel zu langsam, um die Blitze auf der Yoktosekunden-Zeitskala aufzulösen. „Wir greifen daher auf den Hanbury Brown-Twiss-Effekt zurück, der ursprünglich für astronomische Messungen entwickelt wurde“, erklärt Andreas Ipp.
Bei Hanbury Brown-Twiss-Experimenten werden die Daten von zwei verschiedenen Licht-Detektoren miteinander verknüpft, daraus lässt sich beispielsweise der Durchmesser eines Sterns genau berechnen. „Anstatt räumliche Abstände zu studieren kann man diesen Effekt aber ebenso nutzen, um zeitliche Abstände zu vermessen“, sagt Peter Somkuti, Dissertant an der TU Wien, der einen großen Teil der Computersimulationen durchführte. Wie die Berechnungen nun zeigen, könnten die Yoktosekunden-Pulse durch ein Hanbury Brown-Twiss-Experiment aufgelöst werden. „Das wäre experimentell zwar recht aufwändig, aber es ist machbar“, sagt Ipp. Dafür würde man gar keine teuren zusätzlichen Detektoren benötigen: Die Messungen können mit dem „Forward Calorimeter“ durchgeführt werden, das 2018 am CERN in Betrieb gehen soll. Damit würde das ALICE-Experiment zur höchstauflösenden Stoppuhr der Welt werden.
Viele offene Fragen
Die Physik des Quark-Gluon-Plasmas ist nach wie vor voller ungelöster Rätsel: Es hat eine extrem niedrige Viskosität – ist also dünnflüssiger als alle Flüssigkeiten, die wir kennen. Außerdem strebt es extrem schnell in ein thermisches Gleichgewicht, auch wenn es anfangs in einem Zustand extremen Ungleichgewichts war. Die Vermessung der Lichtpulse aus dem Quark-Gluon-Plasma könnte wichtige neue Daten liefern, um diesen Materiezustand besser zu verstehen.
In Zukunft könnten die Lichtblitze vielleicht sogar verwendet werden, um Fragestellungen aus der Kernphysik zu untersuchen. „Experimente mit zwei Lichtpulsen hintereinander sind in der Quantenphysik sehr verbreitet“, sagt Andreas Ipp. „Der erste Lichtblitz ändert den Zustand des untersuchten Objektes, der zweite wird kurz darauf verwendet, um diese Veränderung zu messen.“ Mit Yoktosekunden-Lichtpulsen könnte man diese wohlerprobte Technik in Bereichen einsetzen, die der Forschung bisher noch völlig unzugänglich waren.
Originalpublikation:
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i19/e192301
Rückfragehinweis:
Dr. Andreas Ipp
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstr. 8-10, 1040 Wien
T: +43 1 58801 13635
ipp@hep.itp.tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Der Molekül-Baukasten: Strukturen, die sich selbst zusammenbauen
Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi: Sie untersucht Partikel, die sich automatisch zu kristallartigen Strukturen zusammenfügen – ein neues Hoffnungsgebiet für die Materialforschung.
Sternförmige Kolloide: Sie können sich aneinander andocken - über "Patches", die nicht starr sind, sondern ihre Position ändern können.
Emanuela Bianchi
Geladene Polymer-Sterne bilden veränderliche Patches auf der Oberfläche von Kolloiden mit entgegengesetzter Ladung. Sie sind winzig, sie sind vielseitig, sie könnten in der Materialwissenschaft bald eine besonders wichtige Rolle spielen: „Patchy Colloids“ sind mikroskopisch kleine Partikel, die aneinander andocken und sich ganz von selbst zu komplizierten Strukturen formieren können. Nun zeichnet sich eine völlig neue Methode ab, solche Partikel herzustellen. Emanuela Bianchi forscht seit Jahren an diesem Thema, sie wurde dafür heuer mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet.
Mikroskopisch kleine Partikel docken aneinander an
Welche faszinierenden Möglichkeiten die Patchy Colloids bieten könnten, wird schon seit Jahren theoretisch untersucht. „Man kann sich diese Partikel wie winzige Kügelchen vorstellen, die an ihrer Oberfläche eine bestimmte Anzahl klebriger Andockstellen haben“, erklärt Emanuela Bianchi. Je nach Art und der Anzahl der Andockstellen (den sogenannten„Patches“), durch die sich die Partikel miteinander verbinden können und abhängig von äußeren Bedingungen können sich die Teilchen zu einer geordneten Struktur zusammenfügen – ähnlich wie einzelne Atome, die gemeinsam einen Kristall bilden.
Besonders interessant sind solche Strukturen für die Optik: „Wenn es gelingt, aus Kolloiden diamantartige Strukturen zu erzeugen, dann könnte man sogenannte photonische Kristalle herstellen“, sagt Emanuela Bianchi. Mit solchen photonischen Kristallen könnte man Lichtwellen ganz gezielt manipulieren.
Das Problem der Herstellung
Die Synthese solcher Patchy Colloids ist allerdings schwierig. Das Ausgangsmaterial dafür sind normalerweise gewöhnliche Kolloide: Partikel (in der Größe von wenigen Nano- bis Mikrometern), die in einem mikroskopischen Trägermedium fein verteilt sind, etwa die winzigen Fetttröpfchen, die Milch undurchsichtig weiß erscheinen lassen, oder die Pigmentpartikel in farbiger Tinte. Um aus kleinen Partikeln Patchy Colloids zu machen, müssen sie an ihrer Oberfläche mit Andockstellen versehen werden. „Für diesen Prozess gibt es unterschiedliche Ideen, doch sie alle haben gemeinsam, dass sie sehr aufwändig sind und nur eine recht geringe Anzahl von Patchy Colloids hervorbringen“, sagt Emanuela Bianchi.
Sternförmige Moleküle
Doch wenn sich Kolloide durch Selbstorganisation zu großen kristallartigen Strukturen zusammenfügen können – warum sollte man dann das Prinzip der Selbstorganisation nicht auch benutzen können, um die winzigen Kolloide selbst zu erzeugen? Gemeinsam mit Barbara Capone von der Fakultät für Physik der Universität Wien forscht Bianchi nun an sogenannten Stern-Polymeren. Diese Strukturen bestehen aus vielen einzelnen Molekülketten, die sternförmig von der Mitte nach außen ragen. Wenn man Molekülketten mit passenden chemischen Eigenschaften wählt, dann fügen sie sich ganz von selbst zu Bündeln mit klebrigen Endpunkten zusammen. So werden sie zu Patchy Colloids, ohne dass man ihre Oberfläche von außen speziell manipulieren müsste.
Wie sich diese Polymerketten aneinanderkleben und wie die sternförmigen Strukturen zu diesen speziellen Kolloidteilchen werden, wird nun in Computersimulationen untersucht.
Diese neue Klasse von Patchy Colloids weist zwei spezielle Charakteristika auf: Im Gegensatz zu traditionellen Patchy Colloids sind die Teilchen nunmehr weich - sie können also in einem erheblichen Ausmaß überlappen - und die Patches sind in ihren Positionen nicht mehr fixiert - sie können also aus ihrer Gleichgewichtslage ausgelenkt werden. “Die Konsequenzen dieser neuen Eigenschaften könnten bei der Bildung kristalliner Strukturen sehr wichtig sein“, sagt Emanuela Bianchi. Das Gesamtproblem muss also auf unterschiedlichen Längenskalen betrachtet werden – von der molekularen Ebene bis hin zu makroskopischen Abmessungen. Das ist zwar wissenschaftlich höchst kompliziert, doch die Aussicht auf eine ganze Klasse neuartiger Materialien lässt die große Mühe heute jedenfalls lohnenswert erscheinen.
Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi
Emanuela Bianchi wird ihre Forschung in den nächsten Jahren, finanziert durch das Elise Richter Stipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, in der Arbeitsgruppe „Soft Matter Theory“ des Instituts für Theoretische Physik der TU Wien fortsetzen. Mit diesem Stipendium möchte der FWF junge Wissenschaftlerinnen an eine internationale akademische Karriere heranführen.
Mehr über Patchy Colloids: http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7657
Rückfragehinweis:
Dr. Emanuela Bianchi
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
emanuela.bianchi@tuwien.ac.at
T: +43-1-58801-13631
http://smt.tuwien.ac.at/index.html
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Nano-Hillocks: Wenn statt Löchern Berge wachsen
Elektrisch geladene Teilchen dienen als Werkzeug für die Nanotechnologie. Die TU Wien und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf konnten nun wichtige Fragen über die Wirkung von Ionen auf Oberflächen klären.
Robert Ritter am Atomkraftmikroskop
Kalziumfluorid-Oberfläche, beschossen mit Xenon-Ionen. Nach dem Ätzen werden dreieckige Löcher sichtbar (oben).
Niedrig geladene Ionen (links oben) führen nur zu kleinen Defekten in der Oberfläche, höher geladene Ionen stören das Material so stark, dass Teile weggeätzt werden können (Mitte) und hochgeladene Ionen tragen so viel Energie, dass das Material lokal aufgeschmolzen wird und Hügel ausbildet (unten rechts).
Prof. Aumayrs Geburtstagstorte: Die Y-förmige Figur links trennt den Energiebereich, der nicht zu sichtbaren Veränderungen führt (links) vom Bereich, in dem Löcher sichtbar werden (oben) und dem Bereich, in dem Nano-Hillocks entstehen (rechts).
Ionenstrahlen werden schon lange eingesetzt um Oberflächen zu manipulieren. An der TU Wien werden Ionen mit so hoher Energie untersucht, dass bereits ein einziges der Teilchen drastische Veränderungen auf der damit beschossenen Oberfläche hervorruft. Nach aufwändigen Forschungen konnte nun erklärt werden, warum sich dabei manchmal Einschusskrater, in anderen Fällen hingegen Erhebungen bilden. Die Untersuchungen wurden kürzlich im Fachjournal "Physical Review Letters" publiziert.
Ladung statt Wucht
"Will man möglichst viel Energie auf einem kleinen Punkt der Oberfläche einbringen, bringt es wenig, die Oberfläche einfach mit besonders schnellen Atomen zu beschießen", erklärt Prof. Friedrich Aumayr vom Institut für Angewandte Physik der TU Wien. "Schnelle Teilchen dringen tief in das Material ein und verteilen ihre Energie daher über einen weiten Bereich."
Wenn man den einzelnen Atomen allerdings zuerst viele Elektronen entreißt und die hochgeladenen Teilchen dann mit der Materialoberfläche kollidieren lässt, sind die Auswirkungen dramatisch: Die Energie, die man vorher aufwenden musste um die Atome zu ionisieren wird dann in einer Region von wenigen Nanometern Durchmesser freigesetzt.
Das kann bewirken, dass ein winziger Bereich des Materials schmilzt, seine geordnete atomare Struktur verliert und sich ausdehnt. Das Resultat sind sogenannte Nano-Hillocks, kleine Hügel auf der Materialoberfläche. Die hohe elektrische Ladung, die in Form des Ions in das Material eingebracht wird, hat einen starken Einfluss auf die Elektronen des Materials. Das führt dazu, dass sich die Atome aus ihren Plätzen lösen. Reicht die Energie nicht aus um das Material lokal zum Schmelzen zu bringen, können zwar keine Nano-Hillocks, aber kleine Löcher in der Oberfläche entstehen.
Um so ein detailliertes Bild von den Vorgängen an der Materialoberfläche zu bekommen, waren nicht nur aufwändige Experimente sondern auch Computersimulationen und theoretische Arbeit nötig. Friedrich Aumayr und sein Dissertant Robert Ritter arbeiteten daher eng mit Prof. Joachim Burgdörfer, Christoph Lemell und Georg Wachter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien zusammen. Die Experimente wurden in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf durchgeführt.
Potentielle und Kinetische Energie
"Wir haben zwei verschiedene Formen von Energie zur Verfügung", erklärt Friedrich Aumayr: "Einerseits die potentielle Energie der Ionen, die sie aufgrund ihrer elektrischen Ladung besitzen, andererseits die Bewegungsenergie, die sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit haben." Abhängig von diesen beiden Energie-Größen hinterlassen die Ionen unterschiedliche Spuren auf der Oberfläche.
Lange Zeit schien die Vorstellung, die man von diesen Prozessen hatte allerdings nicht so recht mit den Messungen übereinzustimmen. Verschiedene Materialien schienen sich unter Ionenbeschuss ganz unterschiedlich zu verhalten, manchmal war überhaupt keine Veränderung der Oberfläche zu sehen, auch wenn man eigentlich deutliche Löcher erwartet hätte.
Säure macht Oberflächen-Verletzungen sichtbar
"Das Rätsel konnte allerdings gelöst werden, in dem wir die Oberflächen kurz mit Säure behandelten", sagt Friedrich Aumayr. "Dabei zeigte sich, dass manche Oberflächen durch den Ionenbeschuss zwar verändert worden waren, die Atome hatten sich aber noch nicht völlig von der Oberfläche gelöst. Die mit einem Atomkraftmikroskop erstellten Bilder zeigten daher keine Veränderung." Durch Säurebehandlung wurden genau diese getroffenen Stellen allerdings viel stärker angegriffen als die feste, unverletzte Struktur – die Löcher wurden sichtbar.
Vermutung bestätigt
"Für uns war das der letzte große Puzzlestein für das Verständnis der Wechselwirkung zwischen den Ionen und der Oberfläche", sagt Aumayr. "Durch die Untersuchung mit Hilfe der Säure können wir nun viel besser nachweisen, bei welchen Energien die Oberfläche wie stark verändert wird – damit ergibt sich für uns nun endlich ein geschlossenes Bild." Das Entstehen der Hillocks hängt stark vom Ladungszustand, aber kaum von der Geschwindigkeit der Ionen-Geschoße ab. Das Auftreten von Löchern hingegen wird maßgeblich durch die Bewegungsenergie der Ionen bestimmt. "Vermutet hatten wir das schon lange. Meine Studenten haben mir sogar vor drei Jahren schon eine Geburtstagstorte geschenkt, die genau diesen Zusammenhang darstellte – in Schokolade und Zuckerguss", verrät Aumayr. Damals war das noch Spekulation – doch nun, nach aufwändigen Messungen, wurde ein beinahe identisches Diagramm im Fachjournal "Physical Review Letters" publiziert.
Publikation: A.S. El-Said, R.A. Wilhelm, R. Heller, S. Facsko, C. Lemell, G. Wachter, J. Burgdörfer, R. Ritter, F. Aumayr: | Phase diagram for nanostructuring CaF2 surfaces by slow highly charged ions, Physical Review Letters 109 (2012) 117602 (5 pages)
Rückfragehinweis:
Prof. Friedrich Aumayr
Institut für Angewandte Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13430
friedrich.aumayr@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Neues Center für atomistische Simulationen in Wien
Kooperation zwischen Universität Wien, Technischer Universität Wien und Universität für Bodenkultur
Simulationsschnappschuss eines Kristalls, gebildet aus 192 Polymerketten: Die jeweils 10 solvophilen („lösungsmittelliebenden“) Teilchen sind weiß, die jeweils 10 solvophoben („lösungsmittelmeidenden“) Teilchen sind grün gefärbt; Bindungen zwischen den Monomeren sind durch Stäbchen dargestellt.
Am kommenden Freitag, 14. September 2012, wird das "Danube Center for Atomistic Modelling" (DaCAM) in Wien eröffnet, das sich atomistischen und molekularen Simulationen in Forschung und Ausbildung widmet. Dieses Center bildet den 14. Knoten eines europäischen Netzwerkes (CECAM), der von der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur sowie dem "Center for Computational Materials Science" getragen wird. Ziel ist es, die wissenschaftliche Exzellenz der Wiener Forschungsgruppen auf diesem Gebiet zu bündeln und damit zu stärken. Darüber hinaus ermöglicht die geographische Lage Wiens einen wissenschaftlichen Brückenschlag zu Forschungsgruppen in zentral- und osteuropäischen Ländern.
Das "Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire" (CECAM) ist ein europäisches Netzwerk, das sich seit mehr als 50 Jahren intensiv der Grundlagenforschung von atomistischen und molekularen Simulationsmethoden und deren Anwendungen in wissenschaftlichen und technologischen Problemstellungen widmet. Innerhalb des europäischen Netzwerkes können die wissenschaftlichen Institutionen nationale CECAM-Knoten errichten. Somit werden die jährlich knapp 100 wissenschaftlichen Aktivitäten des CECAM (Tutorien, Workshops, Schulen, Diskussionsforen) dezentral an den mittlerweilen 14 nationalen Knoten durchgeführt.
Wien als weltweit führendes Zentrum der computerunterstützen Materialwissenschaften
Wiener Forschungsgruppen können auf eine lange und überaus erfolgreiche Tradition in atomistischen und molekularen Simulationen zurückblicken. Dabei reicht das thematische Spektrum von der Festkörperphysik über die Weiche Materie bis hin zur Chemie und Molekularbiologie. Beachtliche methodische Entwicklungen und deren Anwendungen in der akademischen und industriellen Forschung haben dazu beigetragen, dass Wien nunmehr zu den weltweit führenden Zentren der computerunterstützen Materialwissenschaften gehört. Um diese Expertise zu bündeln und sie im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen besser verbreiten zu können, haben Forschungsgruppen der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur in Zusammenarbeit mit dem "Center for Computational Materials Science" die Initiative zur Schaffung eines Wiener CECAM-Knotens ergriffen.
Durch den neuen DaCAM-Knoten können die wissenschaftlichen Aktivitäten von Wiener Forschungsgruppen im Bereich der atomistischen Simulationen akkordiert und somit gestärkt werden; eine Tatsache, die zu einer verbesserten internationalen Sichtbarkeit des Forschungsstandortes Wien beiträgt. Darüber hinaus ermöglichen die geplanten wissenschaftlichen Veranstaltungen die direkte Weitergabe der vorhandenen Expertise – ein wichtiger Beitrag im Rahmen der Ausbildung zukünftiger Wissenschafter. Schließlich sollen über das Wiener Center gezielt Kontakte mit verwandten Arbeitsgruppen in den zentral- und osteuropäischen Ländern gefördert werden.
Ein Workshop zum Thema "Design of self-assembling materials", der letzte Woche an der Universität Wien stattgefunden hat, und eine Sommerschule zum Thema "Bandstructure meets many-body theory", die kommende Woche an der Technischen Universität abgehalten wird, stellen die ersten wissenschaftlichen Veranstaltungen des jüngsten CECAM-Knotens in Wien dar. Für die Eröffnungsveranstaltung des DaCAM-Knotens konnten mit Wilfred F. van Gunsteren (ETH Zürich), Kurt Binder (JGU Mainz) und Jürgen Kübler (TU Darmstadt) drei hochkarätige Vortragende gewonnen werden.
Eröffnung des DaCAM-Knotens:
Zeit: Freitag, 14. September 2012, 13:30 Uhr
Ort: Kuppelsaal der Technischen Universität Wien,
Karlsplatz 13,
1040 Wien
Programm
Anmeldung erbeten: gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Nähere Informationen:
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Kahl
Direktor des DaCAM-Knotens
Institut für Theoretische Physik
Center for Computational Materials Science
Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
T: +43-1-58801-13632
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Dellago
Österreichischer Vertreter im CECAM
Fakultät für Physik
Center for Computational Materials Science
Universität Wien
1090 Wien, Boltzmanngasse 5
T: +43-1-4277-512 60
christoph.dellago@univie.ac.at
Das Institut für Theoretische Physik trauert um sein früheres Mitglied,
wiss. Oberrat Dipl.-Ing. Dr. Gerhard ADAM
(8.12.1932 - 30.12.2012)