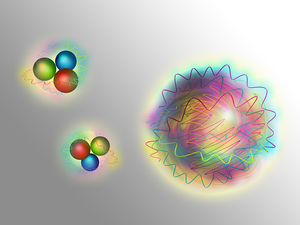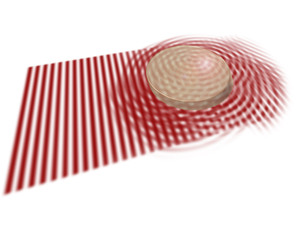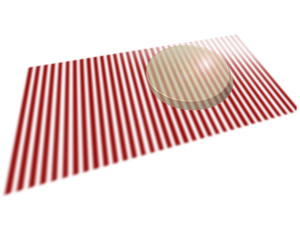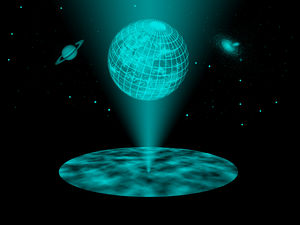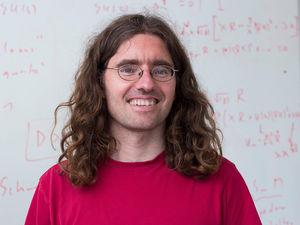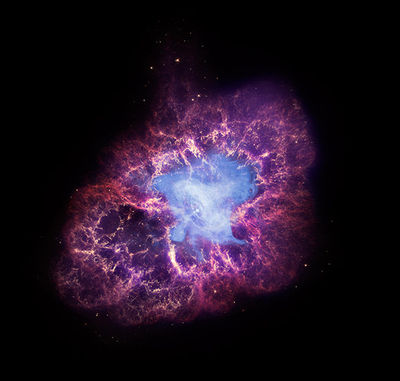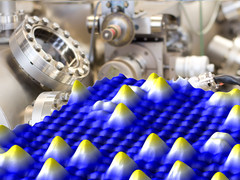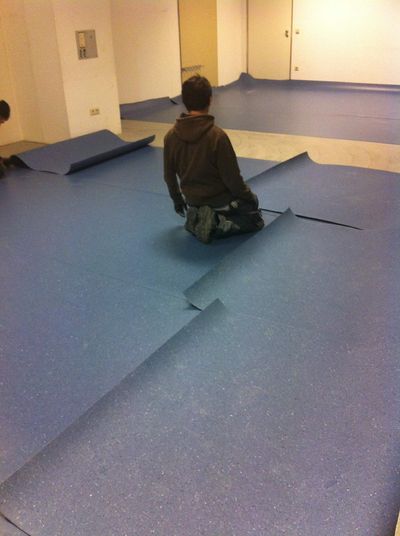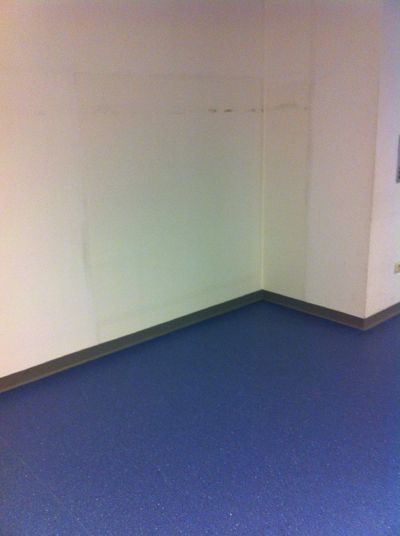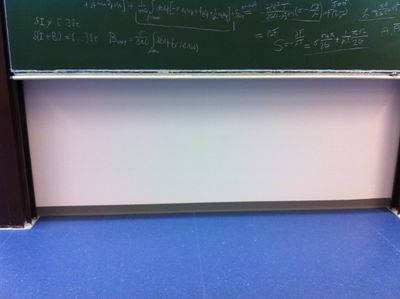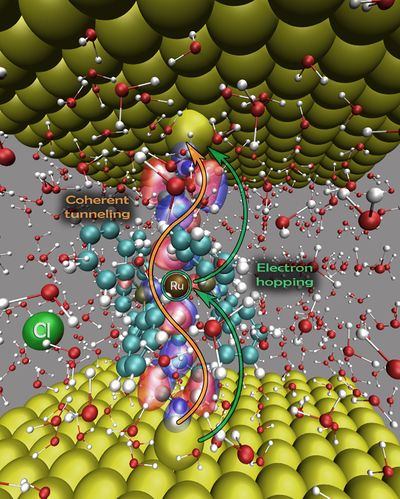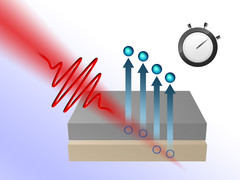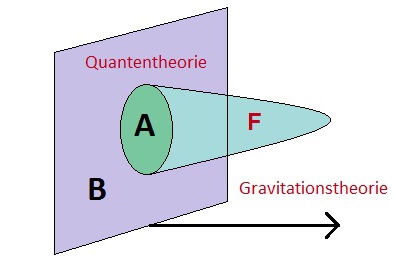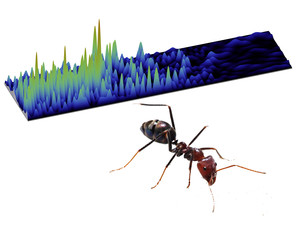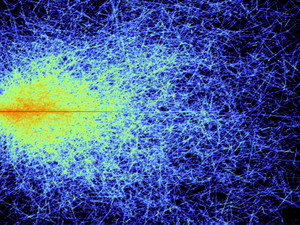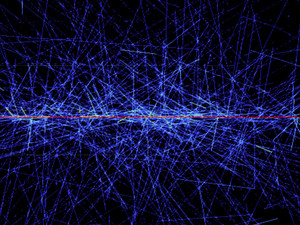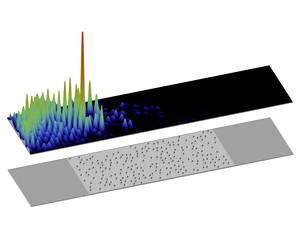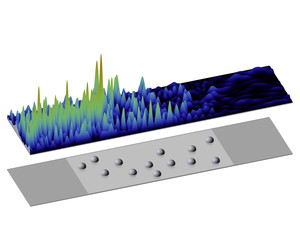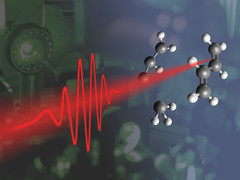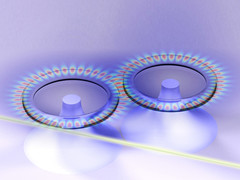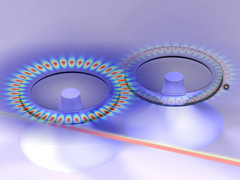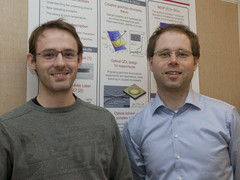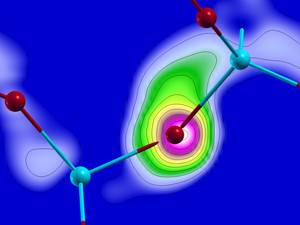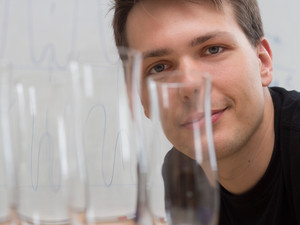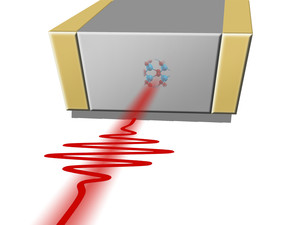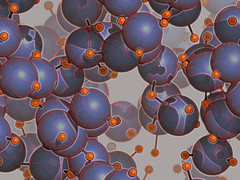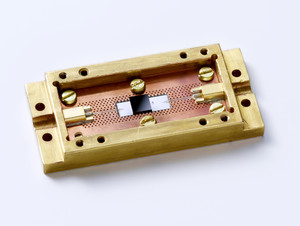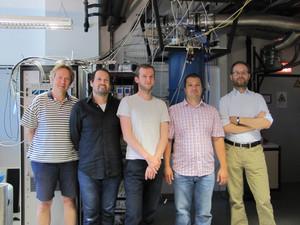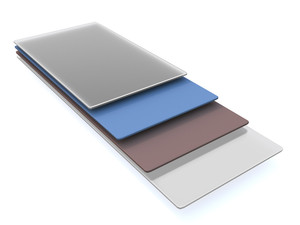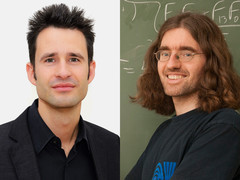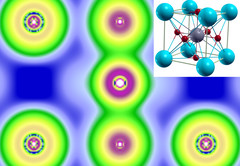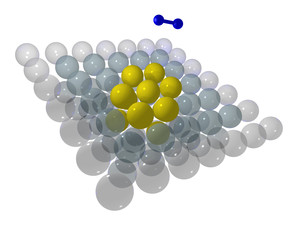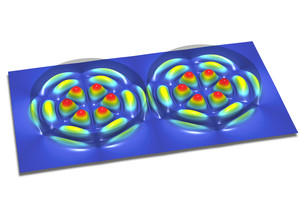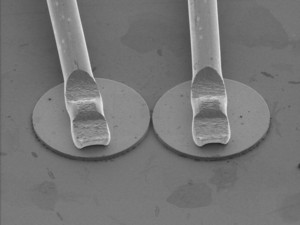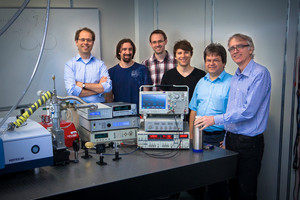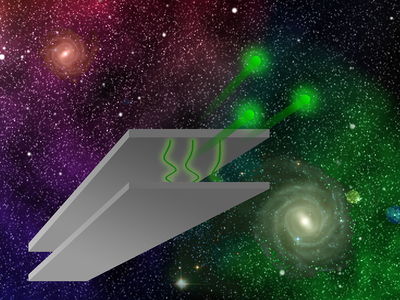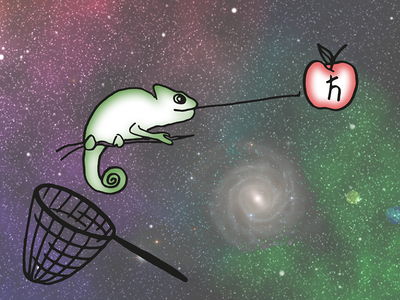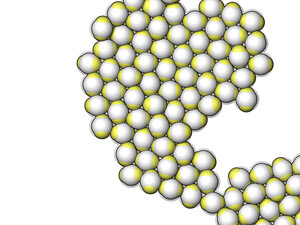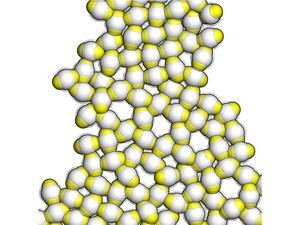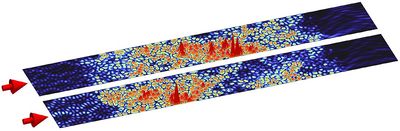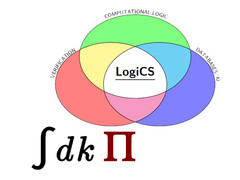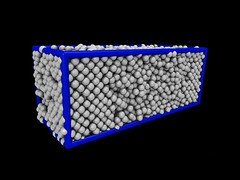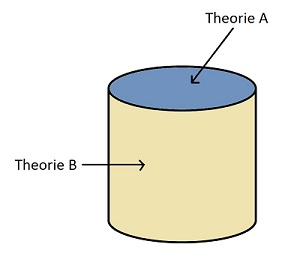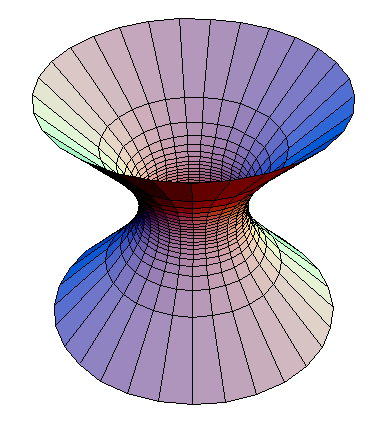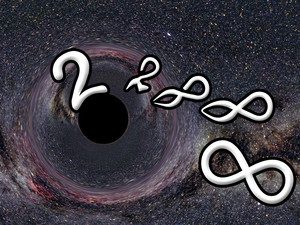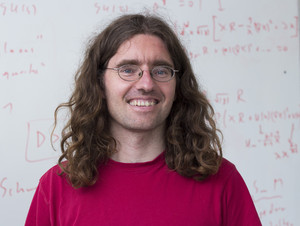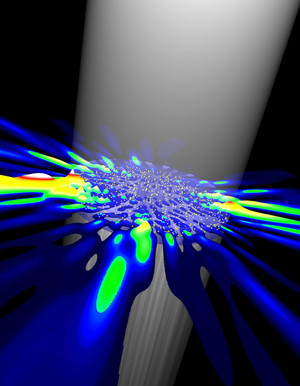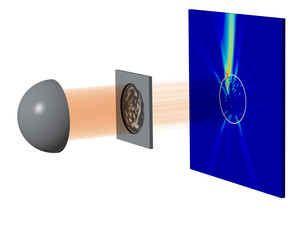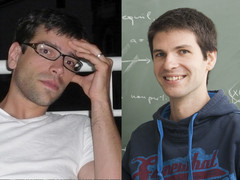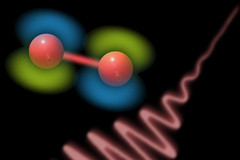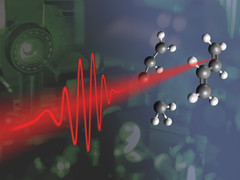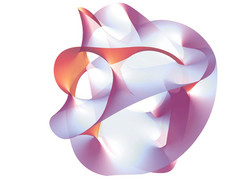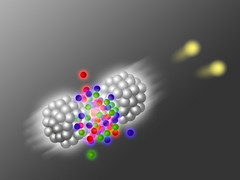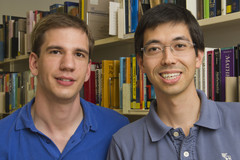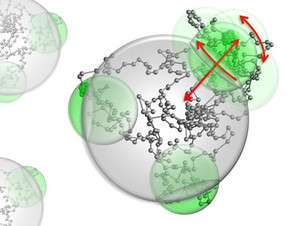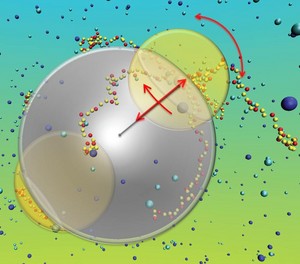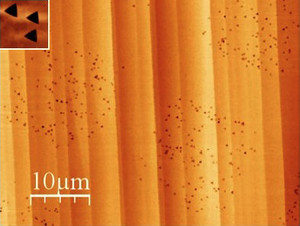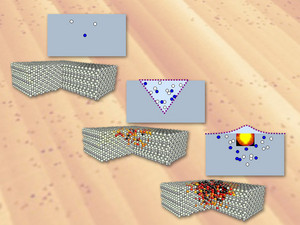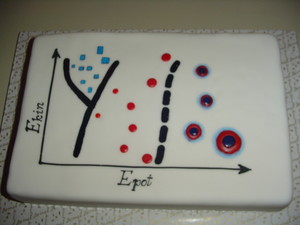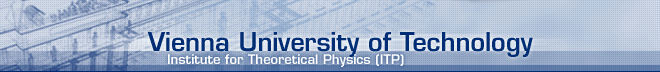
Difference between revisions of "News"
| Line 30: | Line 30: | ||
[http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.131601/ Originalpublikation in Physical Review Letters] <br> |
[http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.115.131601/ Originalpublikation in Physical Review Letters] <br> |
||
[http://science.orf.at/stories/1763678/ Artikel auf science.orf.at]<br> |
[http://science.orf.at/stories/1763678/ Artikel auf science.orf.at]<br> |
||
| − | [http://www.tuwien.ac.at/dle/pr/aktuelles/downloads/2015/glueball/PhysRevLett.115.131601/ Bilderdownload] <br> |
||
| − | |||
| − | |||
Rückfragehinweis:<br> |
Rückfragehinweis:<br> |
||
Revision as of 14:14, 16 October 2015
Ein Teilchen aus reiner Kernkraft
Berechnungen der TU Wien legen nahe, dass es sich bei dem Meson f0(1710) um ein ganz besonderes Teilchen handelt - um den lange gesuchten „Glueball“, ein Teilchen aus reiner Kraft.
Kernteilchen (links) bestehen aus Quarks (Materieteilchen) und Gluonen (Kraftteilchen). Ein Glueball (rechts) hingegen besteht aus reinen Gluonen.
Seit Jahrzehnten sucht man nach sogenannten „Gluebällen“, nun könnten sie gefunden sein. Ein Glueball ist ein exotisches Teilchen, das ganz aus Gluonen besteht – aus den „Klebeteilchen“, von denen unsere Kernteilchen zusammengehalten werden. Weil Gluebälle extrem instabil sind, kann man sie nur indirekt über ihre Zerfallsprozesse nachweisen, über die aber wenig bekannt ist.
Prof. Anton Rebhan und Frederic Brünner von der TU Wien konnten nun allerdings durch einen neuen theoretischen Zugangs den Zerfall von Gluebällen berechnen. Ihre Ergebnisse passen sehr gut zu Daten, die man in Teilchenbeschleuniger-Experimenten gemessen hat. Somit deutet nun vieles darauf hin, dass es sich bei der bereits beobachteten Resonanz f0(1710) um den lange gesuchten Glueball handelt. Weitere Experimente werden in den nächsten Monaten erwartet.
Auch Kräfte sind Teilchen
Protonen und Neutronen bestehen aus noch kleineren Elementarteilchen, den Quarks. Diese Quarks werden von der starken Kernkraft zusammengehalten. „In der Elementarteilchenphysik wird jede Kraft durch ein bestimmtes Kraftteilchen vermittelt, und das Kraftteilchen der starken Kernkraft ist das sogenannte Gluon“, erklärt Prof. Anton Rebhan vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Man kann Gluonen als kompliziertere Version der Photonen betrachten. Die masselosen Photonen (Lichtteilchen) vermitteln die Kräfte des Elektromagnetismus, acht verschiedene Gluonen vermitteln die starken Kernkräfte. Allerdings gibt es zwischen Photonen und Gluonen einen ganz entscheidenden Unterschied: Gluonen spüren die von ihnen übertragene Kraft auch selbst, Photonen nicht. Daher gibt es keine Bindungszustände aus reinem Licht. Teilchen, die nur aus Gluonen zusammengesetzt sind, die also aus reiner Kernkraft bestehen, sind hingegen prinzipiell möglich.
Schon 1972, kurz nachdem die Theorie der Quarks und Gluonen entwickelt wurde, spekulierten die Physiker Murray Gell-Mann und Harald Fritzsch, dass es einen solchen Bindungszustand aus reinen Gluonen geben könnte (ursprünglich etwas vornehmer „Gluonium“ genannt). Bei Teilchenbeschleuniger-Experimenten fand man mehrere Teilchen, die als Kandidaten für Gluebälle gelten, doch Einigkeit darüber, ob eines der gemessenen Signale tatsächlich der gesuchte Glueball ist, gab es nie. Es könnte sich auch um gewöhnliche Bindungszustände aus Quarks und deren Antiteilchen handeln. Für einen direkten Nachweis sind Gluebälle jedenfalls zu kurzlebig. Wenn es sie gibt, muss man sie anhand ihrer Zerfallsprodukte identifizieren.
Kandidat f0(1710) zerfällt in seltsame Quarks
„Leider sind die Zerfallsmuster der Gluebälle nicht rigoros berechenbar“, sagt Anton Rebhan. Vereinfachte Modellrechnungen haben aber ergeben, dass es zwei realistische Kandidaten für Gluebälle gibt: Mesonen mit den Bezeichnungen f0(1500) und f0(1710). Ersteres wurde lange Zeit für den wahrscheinlichsten Glueball-Kandidaten gehalten. Das zweite würde mit seiner höheren Masse zwar besser zu Computersimulationen passen, doch bei seinem Zerfall entstehen bevorzugt schwere Quarks (die sogenannten „strange Quarks“), und das erschien der Mehrheit der Teilchenphysik-Community unplausibel, weil Gluonen bei ihren Wechselwirkungen normalerweise keinen Unterschied zwischen schweren und leichten Quarks machen.
Anton Rebhan und sein Doktorand Frederic Brünner sind der Lösung dieses Rätsels nun aber mit einem neuen Zugang einen großen Schritt nähergekommen. Es gibt nämlich fundamentale Zusammenhänge zwischen Quantentheorien, die teilchenphysikalische Phänomene in unserer dreidimensionalen Welt beschreiben, und bestimmten Gravitationstheorien, die höherdimensionale Räume beschreiben. Dadurch kann man Fragen aus der Teilchenphysik mit Methoden aus der Gravitationstheorie beantworten.
„Aus unseren Rechnungen ergab sich, dass Gluebälle tatsächlich bevorzugt in schwere Quarks zerfallen können“, sagt Anton Rebhan. Das berechnete Zerfallsmuster in zwei leichtere Teilchen konnte erstaunlicherweise das Zerfallsmuster von f0(1710) mit hoher Genauigkeit reproduzieren. Gleichzeitig sind auch kompliziertere Zerfälle der Gluebälle in mehr als zwei Teilchen möglich, auch diese Zerfallsraten konnten mit dem neuen Ansatz berechnet werden.
Weitere Messdaten bald erwartet
Für diese zusätzlichen Zerfallsraten gibt es bisher noch keine Messungen, doch bereits in den nächsten Monaten könnten zwei spezielle Experimente am Large Hadron Collider des CERN (TOTEM und LHCb) sowie ein Beschleunigerexperiment in Beijing (BESIII) neue Daten dazu liefern. „Diese Tests werden die Nagelprobe für unsere Theorie sein“, glaubt Anton Rebhan. „Unsere Rechnung liefert für diese Zerfälle ganz andere Vorhersagen als konkurrierende einfachere Modelle. Sollten die Ergebnisse also mit unseren Vorhersagen zusammenpassen, wäre das ein entscheidender Erfolg für unseren Ansatz.“ Damit wären die Indizien erdrückend, dass das bereits seit längerer Zeit bekannte aber bislang noch wenig erforschte Teilchen f0(1710) der so lange gesuchte Glueball-Zustand ist. Außerdem würde es ein weiteres Mal zeigen, dass sich mit höherdimensionaler Gravitationstheorie auch teilchenphysikalische Phänomene analysieren lassen – das wäre ein neuerlicher Triumph der allgemeinen Relativitätstheorie, die heuer im November ihren 100. Geburtstag feiert.
Originalpublikation in Physical Review Letters
Artikel auf science.orf.at
Rückfragehinweis:
Prof. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Poster Award für Alexander Haber und seine Supraflüssigkeiten
Alexander Haber, Doktorand am Institut für Theoretische Physik der TU Wien, wurde bei der Sommerschule „Dense matter in compact stars" in Bukarest, Rumänien, http://www.nipne.ro/indico/conferenceDisplay.py?confId=236, mit dem ersten Preis für das beste Poster der Schule ausgezeichnet. Das Siegerposter „Instabilities in two-component superfluids“ http://hep.itp.tuwien.ac.at/~ahaber/haber_poster.pdf wurde in einer anonymen Wahl von Studenten und Vortragenden ausgewählt, und Alexander erhielt die Gelegenheit, sein Poster in der finalen Sitzung der Sommerschule in Form eines 25-minütigen Vortrags zu präsentieren.
Alexander Haber
Siegerposter (Download: http://hep.itp.tuwien.ac.at/~ahaber/haber_poster.pdf)
Die Sommerschule fand im Rahmen des von der EU gefördertes Netzwerks “Exploring fundamental physics with compact stars” (NewCompStar http://compstar.uni-frankfurt.de) statt, das die führenden Experten in Astrophysik, Kernphysik und Gravitationstheorie zusammenbringt um das faszinierende Gebiet der Neutronensternphysik interdisziplinär zu erforschen.
Die heißesten Supraflüssigkeiten des Universums
Das Projekt, das durch Alexander Haber mit dem Poster präsentiert wurde, ist ein Teilprojekt seiner Doktorarbeit unter der Betreuung von Andreas Schmitt und wurde in Zusammenarbeit mit Stephan Stetina von der Washington University in Seattle ausgeführt. In diesem Projekt werden spezielle Eigenschaften von zwei-komponentigen Supraflüssigkeiten untersucht. Solche supraflüssigen Systeme können im Labor erzeugt werden, z.B. in kalten Quantengasen. Vor allem aber vermutet man sie im Innern von Neutronensternen. Durch die extrem hohen Dichten, die in Neutronensternen erreicht werden (ein Kubikzentimeter Neutronensternmaterie wiegt in etwa soviel wie die gesamte Menschheit), wird erwartet, dass Neutronen und Protonen, bei ultra-hohen Dichten auch Quarks, eine Supraflüssigkeit bzw. einen Supraleiter bilden. Dies geschieht trotz der relativ hohen Temperaturen (zirka eine Milliarde Grad Celsius), im Gegensatz zu Supraflüssigkeiten im Labor, für die ultra-kalte Bedingungen nötig sind (z.B. -271 °C, d.h. 2 Grad über dem absoluten Nullpunkt, für supraflüssiges Helium). Durch die Wechselwirkung zweier Flüssigkeitskomponenten (z.B. Neutronen und Protonen, oder auch zwei verschiedene ultrakalte, atomare Gase im Labor) kann es zu interessanten Instabilitäten kommen, wenn die beiden Flüssigkeiten sich mit einer Relativgeschwindigkeit zueinander bewegen. Mit anderen Worten, man erwartet spektakuläre Effekte wie z.B. supraflüssige Turbulenz, wenn eine Flüssigkeit hinreichend schnell im Vergleich zur anderen fließt.
Diese sogenannten Zwei-Strom-Instabilitäten haben möglicherweise einen wichtigen Einfluss auf die Rotationsfrequenz von Neutronensternen. Diese zeigen von Zeit zu Zeit ein bis heute nicht vollständig verstandenes Verhalten: Während die Rotationsgeschwindigkeit den Großteil der Zeit, wie erwartet, kontinuierlich sinkt, kommt es gelegentlich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von wenigen Jahren zu einem sprunghaften Anstieg der Winkelgeschwindigkeit, in der Fachsprache „Pulsar Glitch“ genannt. Die Ursache dafür wird einer speziellen Eigenschaft von Supraflüssigkeiten zugeschrieben: Setzt man den Behälter, in dem sich die Supraflüssigkeit befindet (in diesem Fall den Neutronenstern selbst) in Rotation, dreht sich die Supraflüssigkeit, im Gegensatz zu Wasser zum Beispiel, nicht mit. Stattdessen bilden sich Wirbel aus, in denen, wie in kleinen Tornados, der Drehimpuls gespeichert wird. Es wird angenommen, dass die plötzlichen Änderungen in der Rotationsfrequenz der Sterne durch ein kollektives Übertragen des Drehimpulses der Wirbel zurück auf den Stern zustande kommen. Wodurch diese Übertragung jedoch ausgelöst wird, ist bis dato unbekannt, wobei die untersuchte Instabilität als möglicher Kandidat gilt.
Da die Rotationsfrequenz leicht messbar ist, bilden diese Instabilitäten somit einen entscheidender Baustein für die Beobachtung von „stellaren Suprafluessigkeiten“. Das Forschungsprojekt von Alexander Haber verbindet also Fragen der fundamentalen Wechselwirkungen mit astrophysikalischen Beobachtungen und ist auch von Relevanz für Systeme kondensierter Materie im Labor.
Rückfragehinweis:
Alexander Haber
Technische Universität Wien
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: ahaber@hep.itp.tuwien.ac.at
Neues Materialdesign ermöglicht ungestörte Lichtwellen
In Materialien, die Licht abschwächen und verstärken können, sind überraschende Arten von Lichtwellen möglich – das zeigen Berechnungen der TU Wien.
Eine Welle dringt in ein Material ein: Normalerweise kommt es zu komplizierten Wellenüberlagerungen, zu hellen und dunklen Bereichen.
Eine Welle dringt in ein Material ein: Bei speziell designten nicht-hermitischen Materialien bleibt die Welle unbeeinflusst.
Wenn eine Lichtwelle in ein Material eindringt, ändert sie sich normalerweise drastisch. Sie wird gestreut und abgelenkt, und durch die Überlagerung von Lichtwellen kommt es zu einem Muster aus helleren und dunkleren Bereichen. In maßgeschneiderten High-Tech-Materialien, die das Licht lokal verstärken oder abschwächen können, ergeben sich nun neue Möglichkeiten solche Effekte vollständig zu unterdrücken: Wie eine theoretische Arbeit der TU Wien zeigt, ermöglichen diese neuen Materialien ganz besondere Lichtwellen, die im Inneren des Materials an jedem Ort dieselbe Intensität aufweisen - so als gäbe es keinerlei Wellenüberlagerung. Durch diese ungewöhnlichen Eigenschaften könnten sich diese neuartigen Lösungen der Wellengleichung des Lichts technisch nutzen lassen.
Hindernisse verändern die Lichtintensität
Wenn sich eine Lichtwelle gerade und eben durch den freien Raum bewegt, dann kann sie überall dieselbe Intensität haben, ihr Licht ist demnach überall gleich hell. Trifft sie allerdings auf ein Hindernis, dann wird die Welle abgelenkt, das Licht ist danach an manchen Stellen heller, an anderen Stellen dunkler als es ohne Hindernis gewesen wäre. Erst durch solche Überlagerungs- oder Interferenzeffekte können wir Objekte sehen, die selbst kein Licht ausstrahlen.
In den letzten Jahren gab es allerdings immer wieder Experimente mit neuen Materialien, die Lichtwellen auf ganz besondere Weise verändern können: Sie können das Licht lokal verstärken (ähnlich wie das in einem Laser geschieht) oder auch abschwächen (wie in einer Sonnenbrille). „Wenn solche Prozesse möglich sind, muss man die Lichtwelle mathematisch anders beschreiben, als man es in gewöhnlichen, transparenten Materialien tut“, erklärt Prof. Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik, TU Wien). „Wir sprechen dann von sogenannten nicht-hermitischen Medien.“
Eine neue Lösung für die Wellengleichung
Konstantinos Makris und Stefan Rotter entdeckten gemeinsam mit Kollegen aus den USA, dass sich damit neuartige Lösungen der Wellengleichung finden lassen. „Man erhält Lichtwellen, die überall gleich hell sind, wie bei einer ebenen Welle im freien Raum, obwohl die Welle ein stark strukturiertes Material durchdringt“, sagt Konstantinos Makris. „Für die Welle ist das Material in gewissem Sinn unsichtbar, obwohl sie es durchdringt und mit ihm stark wechselwirkt.“
Das neue Konzept der Physiker erinnert an sogenannte „Metamaterialien“, mit denen in den letzten Jahren viel experimentiert wurde. Dabei handelt es sich um strukturierte Materialien, die Licht auf ungewöhnliche Weise ablenken und in bestimmten Fällen um ein Objekt herum führen können, sodass das Objekt wie durch Harry Potters Tarnumhang ("invisibility cloak") unsichtbar gemacht wird. „Unsere nicht-hermitischen Materialien funktionieren allerdings auf Basis eines anderen Prinzips“, betont Stefan Rotter. „Die Lichtwelle wird nicht außen herumgelenkt, sondern sie durchdringt das Material. Aber der Effekt, den das Material auf die Intensität der Welle hat, wird durch ein genau justiertes Wechselspiel aus Verlust und Verstärkung ausgeglichen.“ Am Ende ist die Welle überall im Raum genauso hell, wie sie ohne das Objekt gewesen wäre.
Bis es tatsächlich gelingt, Objekte herzustellen, die Lichtwellen unberührt passieren lassen, ist noch eine Reihe technischer Details zu lösen – gearbeitet wird daran bereits. Mathematisch ist allerdings nun bewiesen, dass es neben Metamaterialien auch noch einen anderen, äußerst vielversprechenden Pfad gibt, Wellen auf ungewöhnliche Weise zu manipulieren. „In einem gewissen Sinn haben wir mit unserer ersten Arbeit zu diesem Thema eine Tür aufgestoßen, hinter der wir noch eine Vielzahl an neuen Einsichten vermuten“, erklärt Konstantinos Makris.
Originalpublikation in Nature Communications:
http://www.nature.com/ncomms/2015/150708/ncomms8257/full/ncomms8257.html
Frei zugängliche Version:
http://arxiv.org/abs/1503.08986
Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter at tuwien.ac.at
Ist unser Universum ein Hologramm?
Zur Beschreibung des Universums braucht man möglicherweise eine Dimension weniger als es den Anschein hat. Rechnungen der TU Wien legen nun nahe, dass es sich dabei nicht bloß um einen Rechentrick handelt, sondern um eine grundlegende Eigenschaft des Raums.
Leben wir in einem Hologramm?
Daniel Grumiller
Auf den ersten Blick scheint jeder Zweifel ausgeschlossen: Das Universum sieht für uns dreidimensional aus. Doch eine der fruchtbarsten Ideen der theoretischen Physik in den letzten beiden Jahrzehnten stellt genau das in Frage: Das „holographische Prinzip“ sagt, dass man für die Beschreibung unseres Universums möglicherweise eine Dimension weniger braucht als es den Anschein hat. Was wir dreidimensional erleben, kann man auch als Abbild von zweidimensionalen Vorgängen auf einem riesigen kosmischen Horizont betrachten.
Bisher wurde es nur in exotischen Raumzeiten mit negativer Krümmung studiert, die zwar theoretisch interessant sind, sich von unserem Universum aber wesentlich unterscheiden. Ergebnisse der TU Wien legen nun allerdings nahe, dass dieses holographische Prinzip auch in flachen Raumzeiten gilt, wie wir sie in unserem Universum beobachten.
Das Holographische Prinzip
Man kennt das von Hologrammen auf Geldscheinen oder Kreditkarten. Sie sind eigentlich zweidimensional, sehen für uns aber dreidimensional aus. Möglicherweise verhält sich das Universum ganz ähnlich. „Schon 1997 stellte der Physiker Juan Maldacena die Vermutung auf, dass es eine Korrespondenz zwischen Gravitationstheorien in gekrümmten Anti-de-Sitter-Räumen und Quantenfeldtheorien in Räumen mit einer Dimension weniger gibt“, sagt Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Man beschreibt Gravitations-Phänomene in einer Theorie mit drei Raumdimensionen oder das Verhalten von Quantenteilchen in einer Theorie in zwei Raumdimensionen und kann die Ergebnisse ineinander überführen. Ein solcher Zusammenhang ist zunächst ähnlich überraschend als würde man mit den Formeln aus einem Astronomie-Lehrbuch einen CD-Player reparieren. Doch die Methode hat schon viele Erfolge gebracht. Mehr als zehntausend wissenschaftliche Arbeiten wurden mittlerweile zu Maldacenas „AdS-CFT-Korrespondenz“ veröffentlicht.
Korrespondenzprinzip auch im flachen Universum
Für die theoretische Physik ist das zwar wichtig, doch mit unserem Universum hat das zunächst noch nichts zu tun. Wir leben nämlich definitiv nicht in einem Anti-de-Sitter-Raum. Solche Räume haben sehr merkwürdige Eigenschaften. Sie sind negativ gekrümmt, Objekte, die man auf gerader Linie wegwirft, kommen wieder zurück. „Unser Universum hingegen ist ziemlich flach – und auf astronomischen Distanzen betrachtet ist es positiv gekrümmt“, sagt Daniel Grumiller.
Grumiller vermutete allerdings schon vor einigen Jahren, dass ein Korrespondenzprinzip auch für unser reales Universum gelten könnte. Um das herauszufinden, muss man Gravitationstheorien konstruieren, die keine exotischen Anti-de-Sitter-Räume brauchen, sondern in gewöhnlichen flachen Räumen zu Hause sind. Daran wird seit etwa drei Jahren in einer internationalen Kooperation von der Universität Edinburgh, Harvard, IISER Pune, dem MIT, der Universität Kyoto und der TU Wien gearbeitet. Nun veröffentlichte Grumiller mit Kollegen aus Indien und Japan einen Artikel im Journal „Physical Review Letters“, das die Korrespondenz-Vermutung in einem flachen Universum bestätigt.
Zweimal gerechnet – selbes Ergebnis
„Wenn die Quantengravitation im flachen Raum eine holographische Beschreibung durch eine gewöhnliche Quantentheorie zulässt, dann muss man physikalische Größen in beiden Theorien berechnen können, und die Ergebnisse müssen übereinstimmen“, sagt Grumiller. Insbesondere muss sich eine Schlüsseleigenschaft der Quantenmechanik – die Quantenverschränkung – auch auf der Seite der Gravitationstheorie finden.
Wenn Quantenteilchen verschränkt sind, lassen sie sich mathematisch nicht getrennt beschreiben – sie bilden quantenphysikalisch betrachtet ein gemeinsames Objekt, auch wenn sie weit voneinander entfernt sind. Ein Maß für die quantenmechanische Verschränkung ist die sogenannte „Verschränkungsentopie“. Gemeinsam mit Arjun Bagchi, Rudranil Basu und Max Riegler konnte Daniel Grumiller zeigen, dass man für diese Verschränkungsentropie in einer flachen Quantengravitationstheorie und in einer niedrigdimensionalen Quantenfeldtheorie tatsächlich denselben Wert erhält.
"Diese Rechnung bestätigt unsere Vermutung, dass das holographische Prinzip auch in flachen Raumzeiten realisiert sein kann. Es ist somit ein Hinweis für die Gültigkeit dieses Prinzips in unserem Universum." erklärt Max Riegler, DOC-Stipendiat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Daniel Grumillers Forschungsgruppe. "Allein die Tatsache, dass wir auf der Gravitationsseite über Quanteninformationsbegriffe wie Verschränkungsentropie reden können ist verblüffend und war vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar. Dass wir sie nun sogar als Werkzeug verwenden können um die Gültigkeit des holographischen Prinzips zu testen - und das dieser Test auch funktioniert hat – ist wirklich bemerkenswert“, sagt Daniel Grumiller.
Damit ist freilich noch nicht bewiesen, dass wir tatsächlich auf einem Hologramm leben – doch die Hinweise auf die Gültigkeit des Korrespondenzprinzips in unserem realen Universum scheinen sich zu verdichten.
Originalpublikation: Phys. Rev. Lett. 114, 111602, 2015:
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.114.111602
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Rückfragehinweis:
Prof. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
daniel.grumiller at tuwien.ac.at
Gipfeltreffen der Teilchenphysik in Wien
Neue Entdeckungen am CERN und die Suche nach unbekannten Teilchen beschäftigen die Forscher_innen auf einer der bedeutendsten Teilchenphysik-Konferenzen der Welt.
CMS Detektor am CERN in Genf
Seit vergangenem Mittwoch steht Wien im Zeichen von Pentaquarks, Neutrinos, Higgs-Boson & Co. Mehr als 700 internationale Physiker_innen diskutieren bei einer der weltweit bedeutendsten Teilchenphysik-Konferenzen die neuesten Ergebnisse ihres Forschungsbereichs. Im Zentrum der Konferenz, die von der European Physical Society, dem Institut für Hochenergiephysik bzw. dem Stefan-Meyer-Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), der Technischen Universität (TU) Wien und der Universität Wien veranstaltet wird, stehen die mit Spannung erwarteten Resultate der kürzlich wieder angelaufenen Experimente am Large Hadron Collider (LHC) des CERN. Bei einer Pressekonferenz am 27. Juli 2015 konnte CERN-Generaldirektor Rolf Heuer bereits Neuigkeiten zu den erst vor wenigen Tagen entdeckten Pentaquarks präsentieren. Insgesamt fällt die Zwischenbilanz über die neu gestarteten Versuchsreihen am CERN überaus positiv aus: „Mit den LHC-Experimenten haben wir schon weit mehr Daten gesammelt als im Jahr 2010, in dem der LHC seinen Betrieb erstmals bei hohen Energien aufgenommen hat. Wir spüren gerade einen fantastischen Pioniergeist bei den Physikern, die derzeit völlig neuartige Daten bei bisher unerforschten Energien auswerten“, sagte Heuer vor Vertretern der internationalen Presse.
Österreichs Forschung leistet wesentliche Beiträge in der Teilchenphysik
Österreich ist bereits seit 1959 Teil der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) und österreichische Forschungseinrichtungen leisten seit vielen Jahren wichtige Beiträge in der Kern- und Teilchenphysik. Ein Schwerpunkt der österreichischen Beteiligung am CERN ist die Mitarbeit bei internationalen Großexperimenten. So ist das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW Gründungsmitglied des CMS-Experiments am CERN, einem der beiden großen Detektoren, in denen 2012 der Nachweis des Higgs-Bosons gelang. Auch das Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik der ÖAW, das Atominstitut der TU Wien, das Institut für Theoretische Physik der Universität Wien sowie fünf weitere österreichische Forschungseinrichtungen arbeiten auf dem Gebiet der experimentellen und theoretischen Kern- und Teilchenphysik.
„Die Technologieentwicklungen für die Experimente am CERN werden an verschiedenen Instituten weltweit vorangetrieben. Auch kleinere Länder wie Österreich sind federführend beteiligt. Beispielsweise hat das Institut für Hochenergiephysik der ÖAW in den vergangenen Jahren eine international anerkannte Rolle bei der Entwicklung und dem Bau von Spurdetektoren eingenommen“, sagte Jochen Schieck, Direktor des Instituts für Hochenergiephysik der ÖAW auf der Pressekonferenz. Spurdetektoren sind wichtige Instrumente für die Arbeit am CERN. Sie haben die Aufgabe Signale aufzuzeichnen, die die Teilchen hinterlassen. Damit können Flugbahnen und Ursprungsorte von Teilchen präzise vermessen werden.
Von der Grundlagenforschung, die an österreichischen Forschungseinrichtungen und am CERN betrieben wird, hat nicht nur die Wissenschaft etwas. Die österreichische Wirtschaft profitiert vom Know‐how der neu entwickelten Technologien und von finanziellen Rückflüssen an österreichische Unternehmen. Die österreichischen Kern‐ und Teilchenphysik‐Institute bieten zudem ein exzellentes Ausbildungsprogramm für Studierende und Doktorand_innen. Nachwuchswissenschaftler_innen sind von Beginn an in internationale Forschungsprojekte involviert.
Die neuesten Erkenntnisse vom LHC
Ein Höhepunkt der Pressekonferenz war das Update des CERN zum neugestarteten LHC. Der schnellste und stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt, auch als „Weltmaschine“ bekannt, läuft seit seinem Neustart mit fast dem Doppelten der bisherigen Kollisionsenergie. Waren es vor der Wartungspause Energien von rund acht Tera-Elektronenvolt, so sind jetzt bereits bis zu 13 Tera-Elektronenvolt möglich. Übersetzt entspricht diese Energie dem Milliardenfachen der Temperatur im Inneren der Sonne. Der Vorteil dieser hohen Energien: Je heftiger die Zusammenstöße der Protonen sind, desto exotischere, bislang unbekannte Partikel könnten auftauchen.
Selbst die Daten aus der ersten Betriebsphase des LHC sind noch voller Überraschungen, wie sich erst kürzlich wieder zeigte. Lange, nämlich bereits seit den 1960er Jahren, hatte man darüber spekuliert, jetzt wurde es erstmals sichtbar: Das „Pentaquark“, ein Konglomerat aus fünf Quarks und ein weiterer Meilenstein in der Teilchenphysik.
„Mit den hohen Energien, die seit 2015 am LHC möglich sind, betreten wir physikalisches Neuland“, betonte Rolf Heuer bei der Pressekonferenz, „denn diese Energien sind nie zuvor erreicht worden“, so der Generaldirektor des CERN weiter.
27 Kilometer ist der unterirdische Ringtunnel des LHC im CERN bei Genf lang. In ihm werden zwei Strahlen, bestehend aus Paketen von jeweils 100 Milliarden Protonen, in gegenläufiger Richtung fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und im Zentrum der Detektoren alle 50 Nanosekunden frontal zur Kollision gebracht. Die Zahl der Pakete wird derzeit schrittweise erhöht und in den nächsten Tagen soll die Zeit zwischen den Kollisionen sogar halbiert werden. Das ambitionierte Ziel ist, bis Ende des Jahres die Anzahl der Pakete im Beschleuniger auf 2000 pro Strahl zu steigern. Die Aussichten damit neue, bisher völlig unbekannte Teilchen zu finden, werden damit noch größer.
Wichtigster Preis der Teilchenphysik verliehen
Bei der noch bis Mittwoch laufenden Teilchenphysik-Konferenz wurde erstmals in Wien auch einer der prestigeträchtigsten Preise der gegenwärtigen Physik vergeben: Der „High Energy and Particle Physics“-Preis der European Physical Society. Dessen Bedeutung unterstreicht auch die Tatsache, dass viele seiner bisherigen Träger_innen später mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurden. Die Preisträger_innen des EPS-Preises 2015 sind die theoretischen Physiker James D. Bjorken (Stanford), Guido Altarelli (Rom), Yuri L. Dokshitzer (Paris und St. Petersburg), Lev Lipatov (St. Petersburg) und Giorgio Parisi (Rom).
Einer der EPS-Preise, der „Giuseppe und Vanna Cocconi-Preis“ für herausragende Leistungen im Bereich der Astrophysik, wurde in diesem Jahr an Francis Halzen verliehen. Halzen leitet eines der derzeit meistbeachteten Experimente der Astrophysik, das sich mit der Erforschung einer ganz besonderen Art von Teilchen befasst: Das IceCube-Projekt sucht mit einem gigantischen Teleskop in der Antarktis nach Neutrinos im Weltall. Die Verleihung des „Giuseppe und Vanna Cocconi-Preises“ würdigt Halzens visionäre und führende Rolle bei der Entdeckung von hochenergetischen extraterrestrischen Neutrinos. Auf der Pressekonferenz erläuterte er: „Neueste Erkenntnisse zeigen, dass Neutrinos uns von Quellen aus dem gesamten Universum erreichen. Es scheint, dass die Quellen der Neutrinos mit den bereits bekannten Quellen hochenergetischer Lichtquanten zusammenhängen.“ Halzens Forschungsergebnisse eröffnen der Astroteilchenphysik damit ein neues Fenster für das Verständnis unseres Universums.
Die Teilchenphysik der Zukunft
Das Universum steht auch in den kommenden zwei Tagen im Zentrum des Interesses der Forscher_innen, die sich mit zahlreichen weiteren Themen der aktuellen Physik beschäftigen. Neben der Suche nach dunkler Materie und der Entstehung des Universums durch den Urknall versprechen auch die am LHC erreichten höheren Kollisionsenergien sowie die inzwischen atemberaubende Präzision der Ergebnisse aus der kosmologischen Forschung immer genauere Informationen über die Zusammensetzung und den Aufbau des Universums.
Die faszinierenden Rätsel an der Wurzel unserer Existenz waren darüber hinaus auch Thema bei der gemeinsamen Strategiesitzung der European Physical Society und dem europäischen Komitee für zukünftige Beschleuniger, die im Rahmen der Konferenz stattfand. So hält die Frage, ob es eine Verbindung zwischen der Physik des Allerkleinsten und des Allergrößten gibt, gleichermaßen Teilchenphysik wie Kosmologie – der Wissenschaft vom Ursprung, der Entwicklung und der grundlegenden Struktur des Universums – in Atem. Zu erwarten ist, dass zukünftig die Teilchenphysik und die Kosmologie noch enger verknüpft werden können – und damit Ergebnisse für zahlreiche weitere Gipfeltreffen der Physik liefern.
Den Abschluss einer der weltweit größten Konferenzen der Teilchenphysik bildet am 29. Juli der Vortrag der designierten CERN-Generaldirektorin Fabiola Gianotti. Sie gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Teilchenphysik und die nächste Generation von Beschleunigern.
Pressetext und Fotos zum Download unter: www.oeaw.ac.at/pr
Informationen zum Programm der Konferenz unter http://eps-hep2015.eu
Ein täglicher Newsletter zur Konferenz unter http://eps-hep2015.eu/news-press
Information und Kontakte:
The European Physical Society
The European Physical Society (EPS) is a not for profit association whose members include 42 National Physical Societies in Europe, individuals from all fields of physics, and European research institutions.
As a learned society, the EPS engages in activities that strengthen ties among the physicists in Europe. As a federation of National Physical Societies, the EPS studies issues of concern to all European countries relating to physics research, science policy and education.
www.eps.org
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften
Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hat die gesetzliche Aufgabe, „die Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern“. 1847 als Gelehrtengesellschaft gegründet, steht sie mit ihren heute über 770 Mitgliedern sowie rund 1.300 Mitarbeiter_innen für innovative Grundlagenforschung, interdisziplinären Wissensaustausch und Wissenschaftsvermittlung – mit dem Ziel der Förderung des wissenschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Fortschritts.
www.oeaw.ac.at
Die Technische Universität Wien
Die Technische Universität Wien – kurz: TU Wien - liegt im Herzen Europas, an einem Ort kultureller Vielfalt und gelebter Internationalität. Hier wird seit fast 200 Jahren im Dienste des Fortschritts geforscht, gelehrt und gelernt. Die TU Wien zählt zu den erfolgreichsten Technischen Universitäten in Europa und ist mit über 29.000 Studierenden und rund 3.300 Wissenschaftler_innen Österreichs größte naturwissenschaftlich-technische Forschungs- und Bildungseinrichtung.
www.tuwien.ac.at
Die Universität Wien
Die Universität Wien ist eine der ältesten und größten Universitäten Europas: An 19 Fakultäten und Zentren arbeiten rund 9.700 Mitarbeiter_innen, davon 6.900 Wissenschafter_innen. Die Universität Wien ist damit die größte Forschungsinstitution Österreichs sowie die größte Bildungsstätte: An der Universität Wien sind derzeit rund 92.000 nationale und internationale Studierende inskribiert. Mit über 180 Studien verfügt sie über das vielfältigste Studienangebot des Landes. Die Universität Wien ist auch eine bedeutende Einrichtung für Weiterbildung in Österreich. 1365 gegründet, feiert die Alma Mater Rudolphina Vindobonensis im Jahr 2015 ihr 650-jähriges Gründungsjubiläum.
www.univie.ac.at
Rückfragehinweise
Dipl.-Soz. Sven Hartwig
Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation
Österreichische Akademie der Wissenschaften
sven.hartwig at oeaw.ac.at
Mag. Alexandra Frey
Pressebüro der Universität Wien
Forschung und Lehre
alexandra.frey at univie.ac.at
MMag. Christine Cimzar-Egger
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Forschungs-PR
christine.cimzar-egger at tuwien.ac.at
Bild: © CERN
Ausgezeichneter TU Chor
Der Chor der TU Wien unter der Leitung von Andreas Ipp wurde beim 5. Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz mit dem silbernen Diplom ausgezeichnet.
Silbernes Diplom für den TU Chor beim Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival
19 Chöre aus 12 Nationen traten von 3. bis 7. Juni 2015 beim renommierten Internationalen Anton-Bruckner-Chorwettbewerb & Festival in Linz in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Zum ersten Mal war der TU Chor unter der Leitung von Andreas Ipp dabei und wurde in der Kategorie "B1 - Mixed Choirs without compulsory piece" mit dem silbernen Diplom ausgezeichnet. Gold in dieser Kategorie erhielten der Nanyang Technological University Choir aus Singapur sowie der Pärnu Kammerkoor aus Estland.
Der Großpreis ging an den Choir of the West, Pacific Lutheran University, USA, der sich beim Abschlusskonzert gegen die besten Chöre aus den verschiedenen Kategorien durchsetzen konnte.
Neben dem Wettbewerbsauftritt im Brucknerhaus nutzen die TU-Sänger_innen die Gelegenheit, sich von der internationalen Jury in einem Beratungskonzert Feedback zu holen und probten mit dem Dirigenten Fred Sjöberg aus Schweden.
Beim Freundschaftskonzert im Marmorsaal des Stiftes St. Florian konnte der TU Chor zeigen, dass er nicht nur klassische Stücke wie das "Jagdlied" von Felix Mendelssohn Bartholdy beherrscht: Das Publikum zeigte sich begeistert vom 1990er-Medley "I don`t care who you are".
Singen auf den Spuren Anton Bruckners
Knapp 60.000 km haben alle Teilnehmerchöre insgesamt zurückgelegt, um beim INTERKULTUR Event in Linz dabei zu sein. Die weiteste Anreise hatte dabei der "Cantata Choir - Puerto Princesa City" von den Philippinen mit 10.245 km. Andere Chöre kamen unter anderem aus den USA, Singapur, Estland, Finnland, Rumänien und Kroatien.
Die Veranstaltungstage begannen traditionell mit der Aufführung von Anton Bruckners "Te Deum" im Neuen Dom Linz. Internationale Chöre aus Dänemark, Estland und den Niederlanden traten als "Sing’n’Joy Festivalchor" gemeinsam mit dem Domchor, Solist_innen und dem Orchester der Dommusik auf. Auch die nächsten Tage standen ganz im Zeichen Anton Bruckners. Ob als Pflichtstück in der Wettbewerbskategorie A oder bei Festivalkonzerten an seiner ehemaligen Wirkungsstätte im Stift St. Florian – überall folgen die Teilnehmer_innen in Linz seinen Spuren. Bei der Abschlussveranstaltung am Samstagabend sangen alle Chöre gemeinsam Bruckners "Locus iste", dirigiert von Domkapellmeister Josef Habringer.
Details zum Wettbewerb: http://www.interkultur.com
Mehr zum TU Chor unter: http://chor.tuwien.ac.at/home/
Ernest Rutherford Fellowship für Andreas Schmitt
Andreas Schmitt vom Institut für Theoretische Physik hat das hoch angesehene Ernest Rutherford Fellowship des Science & Technology Facilities Council (STFC) errungen. Dieses Fellowship ermöglicht den weltweit besten und vielversprechendsten jungen Wissenschaftlern unabhängige Spitzenforschung im Bereich der Teilchen-, Kern- und Astrophysik an einer ausgewählten Institution in Großbritannien über einen Zeitraum von fünf Jahren durchzuführen. Andreas Schmitt wird das Fellowship an der Universität von Southampton, im neu etablierten "Southampton Theory Astrophysics and Gravity Research Center" (STAG), antreten, in dem zahlreiche international anerkannte Forscher arbeiten und das deshalb eine ideale Umgebung für moderne Forschung im Grenzbereich zwischen fundamentaler Teilchenphysik und Astrophysik darstellt.
Andreas Schmitt
Neutronenstern im Krebsnebel, der bei einer Supernova-Explosion im Jahr 1054 entstanden ist (Chandra X-Ray Observatory)
Die ganze Menschheit in einem Stück Würfelzucker
Die Forschungsvorhaben, die Andreas Schmitt während dieses Fellowships anstrebt, sind zum Teil eine Fortsetzung und Weiterentwicklung seiner bisherigen erfolgreichen Arbeit, die er in den vergangenen Jahren am Institut für Theoretische Physik der TU Wien durchgeführt hat. Dabei handelt es sich vor allem um offene Probleme der Kern- und Teilchenphysik, die sowohl von fundamentalem Interesse sind als auch wichtig sind für das Verständnis astrophysikalischer Beobachtungen von Neutronensternen. Die zu Grunde liegende - und äußerst schwer zu beantwortende - Frage ist, was mit Materie passiert, wenn man sie immer weiter zusammenpresst, so dass man ultradichte Materie erhält, in der die fundamentalen Freiheitsgrade wie Quarks und Gluonen eine Rolle spielen. Während irdische Experimente nur schwerlich solch extreme Dichten erreichen können, existiert ultradichte Kern- und eventuell Quarkmaterie im Innern von Neutronensternen: ultra-kompakte Sterne schwerer als die Sonne, aber nicht größer als eine Großstadt wie Wien - ein zuckerwürfelgroßes Stück Neutronensternmaterie wiegt in etwa so viel wie die gesamte Menschheit.
Supraflüssigkeit, quantisierte Wirbel und magnetische Flussschläuche
Es geht also im geplanten Forschungsvorhaben darum, mikroskopische, auf Quantenfeldtheorien basierende Eigenschaften von dichter Materie mit astrophysikalischen Phänomenen zu verknüpfen. In der Forschungsarbeit von Andreas Schmitt steht dabei zum Beispiel die Supraflüssigkeit von ultradichter Materie im Mittelpunkt. Wie bei wohlbekannten, im Labor untersuchten Supraflüssigkeiten können auch Neutronen, Protonen und Quarks in Neutronensternen Cooper-Paar-Kondensate bilden, deren Bindung durch die starke Kernkraft erzeugt wird und die zu charakteristischen Phänomenen von Supraleitung und Supraflüssigkeit führen, wie zum Beispiel quantisierte Wirbel und magnetische Flussschläuche. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt während des Fellowships wird die Anwendung der Dualität von gewissen Eich- und Gravitationstheorien sein, die auf stringtheoretische Methoden zurückgreift und mit Hilfe derer man Eigenschaften stark gekoppelter Materie untersuchen kann. Eine große Herausforderung, die aber auch enorme Möglichkeiten für zukünftige Forschung bietet, ist die Entwicklung eines realistischen Modells für dichte Kernmaterie im Rahmen dieser Dualität.
Rückfragehinweis:
Dr. Andreas Schmitt
Technische Universität Wien
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: aschmitt@hep.itp.tuwien.ac.at;
Fertigstellung der Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten im Freihaus
Am Mittwoch, 22. April, werden die sanierten Türme A und B im Freihaus feierlich eröffnet.
Freihaus
Als Folge der Zusammenführung der Fakultät für Maschinenwesen am Getreidemarkt werden im Rahmen der "TU Nachnutzungen" freiwerdende Bereich saniert und modernisiert. Mit den Fakultäten Mathematik und Geoinformation sowie Physik wurden zur Zusammenführung der Institute im Freihaus entsprechende Projekte entwickelt und umgesetzt.
Ab 2014 begannen im Grünen Bereich (Turm A - vorwiegend Mathematik), 3. bis ins 8. OG und im gelben Bereich (Turm B), 3 und 4 Stockwerken die Bauaktivitäten. Es erfolgten Sanierungsarbeiten und Adaptierungen von Teilbereichen und strukturbereinigende Maßnahmen die nun fertiggestellt wurden.
Eröffnung
Mi, 22.04.2015, 16:00 Uhr
TU Wien Freihaus, Gelber Turm (DB), 4.OG, Seminarraum 105A
1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8 - 10
Im Faxraum ist alles in Ordnung
Die alten Swoboda-Kästen in unserem Faxraum im 10. Stock fielen auseinander. So nutzten wir die Gelegenheit der herannahenden neuen Möbel und nahmen drei jung gebliebene Kästen aus dem Jahr 1988 aus Prof. Schwedas Zimmer. „Neue“ Kästen, ein bisschen Ausmisten und eine neue Ordnung – schon strahlt unser Faxraum in nie gekanntem Glanz.
Vor allem in den offenen Bereichen der „Kredenzen“ und im linken Kasten finden Sie alles Nötige.
Hier noch ein paar Bilder:
Hochdotierte Förderung für Materialforschung
Zwei Spezialforschungsbereiche des FWF im Bereich der Materialwissenschaft wurden verlängert: Die erfolgreiche Forschung an funktionalen Oxid-Oberflächen (FOXSI) und an materialwissenschaftlichen Computersimulationen (VICOM) wird fortgesetzt.
Neue Materialien entdeckt man nicht einfach durch Zufall. Um neue Werkstoffe oder neue Katalysator-Materialien zu entwickeln, muss man heute auf atomarer Ebene verstehen, durch welche Effekte Materialeigenschaften überhaupt zustande kommen. Seit vier Jahren wird an der TU Wien in zwei hochdotierten Spezialforschungsbereichen (gefördert vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF) international höchst angesehene Forschung betrieben. Beide Projekte wurden nun um weitere vier Jahre verlängert: Im SFB VICOM entwickelt und verwendet man Computermethoden zur Berechnung von Materialien auf Quanten-Ebene, im SFB FOXSI werden Metall-Oxide erforscht, insbesondere ihre Oberflächen und die Grenzflächen zwischen unterschiedlichen Materialien.
Die Oberfläche hat ihre eigenen Regeln
Wenn man weiß, wie ein Material im Inneren aufgebaut ist und auf welche Weise seine Atome aneinandergefügt sind, kann man Materialeigenschaften oft gut verstehen. Doch die Oberflächen des Materials, oder die Grenzflächen zwischen zwei verschiedenen Materialien, sind oft viel schwieriger zu verstehen. Dabei ist gerade das Verhalten an der Oberfläche besonders interessant: Wenn Materialien als Katalysatoren eingesetzt werden, dann geht es genau darum, die Eigenschaften der äußersten Atomschichten zu untersuchen.
Im SFB FOXSI widmet man sich genau dieser ganz besonders schwierigen Aufgabe: Man untersucht funktionale Oxide, wie man sie etwa als Katalysatoren oder Elektrolyte für Brennstoffzellen einsetzt. „In der Industrie ist man in diesem Bereich ständig auf der Suche nach neuen Materialien“, sagt Prof. Günther Rupprechter, der Leiter des Spezialforschungsbereichs. Manchmal gelingen Verbesserungen einfach durch Versuch und Irrtum, aber für substanzielle Fortschritte benötigt man Grundlagenforschung. An der TU Wien versucht man auf ganz fundamentaler Ebene zu verstehen, welche Effekte hier eine Rolle spielen und wie man Materialien gezielt verbessern kann.
Materialeigenschaften am Computer berechnen
International höchst erfolgreich ist auch der SFB VICOM (Vienna Computational Materials Laboratory), an dem sowohl die Universität Wien als auch die TU Wien beteiligt ist. „Sucht man nach neuen Materialien die zum Beispiel ganz besondere magnetische oder thermoelektrische Eigenschaften haben, muss man die Materialphysik auf Quanten-Ebene verstehen und berechnen können“, sagt Prof. Karsten Held, einer der Principal Investigators von VICOM. „Das komplizierte Zusammenspiel der Atome eines Festkörpers und ganz besonders das Verhalten seiner Elektronen legen seine Eigenschaften fest.“
Berechnen kann man das nur mit großem Aufwand. Oft werden für solche Berechnungen besonders leistungsfähige Computercluster wie der Vienna Scientific Cluster mit tausenden Prozessorkernen verwendet. Die Universität Wien und die TU Wien liefern seit Jahren wichtige Beiträge für den Forschungsbereich der computergestützten Materialforschung. Im Rahmen des Spezialforschungsbereichs VICOM werden neue Computermethoden entwickelt, verbessert und angewandt.
FWF-Förderung verlängert
Mit der Schaffung von Spezialforschungsbereichen setzt der Wissenschaftsfonds FWF gezielt Schwerpunkte und baut international erfolgreiche Forschungsnetzwerke in Österreich auf. Dadurch soll das Entstehen von eng vernetzten, oft multidisziplinären Forschungseinheiten gefördert werden. Sowohl VICOM als auch FOXSI konnten in den vergangenen vier Jahren große wissenschaftliche Erfolge vorweisen und wurden vom FWF nun verlängert: Beide Projekte laufen nun weitere vier Jahre weiter.
Mehr dazu: FOXSI und VICOM online
http://foxsi.tuwien.ac.at
http://www.sfb-vicom.at
Doktortitel für das Erklären der Welt
Einigen der fundamentalsten Fragen der Wissenschaft widmet sich das Doktoratskolleg „Particles and Interactions“, das am 10. März an der TU Wien eröffnet wird – mit prominenten Gästen.
[1]
Über die Grundgesetze der Physik weiß man zwar mittlerweile sehr viel, doch noch sind wir weit davon entfernt, die fundamentalen Gesetze des Universums völlig verstanden zu haben. Wie kann man die kleinsten Teilchen unserer Welt genau beschreiben, wie lässt sich dunkle Materie verstehen, was ist unmittelbar nach dem Urknall passiert und was hat die Krümmung von Raum und Zeit damit zu tun? Solche Fragen bietet nach wie vor Stoff für unzählige spannende Forschungsarbeiten.
Einige solche Arbeiten werden in den nächsten Jahren im Rahmen des Doktoratskollegs „Particles and Interactions“ durchgeführt. Das Kolleg wird am 10. März feierlich eröffnet, mit Gastvorträgen des Quantenphysikers Prof. Anton Zeilinger (Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) und des Teilchenphysikers John Ellis vom King’s College in London, der lange Zeit die Theorieabteilung des CERN leitete und weiterhin dort forscht.
TU Wien, Uni Wien und Akademie der Wissenschaften
Das Doktoratskolleg vereint mehrere renommierte Wiener Forschungsinstitutionen: Neben den Instituten für theoretische Physik und dem Atominstitut der TU Wien ist auch die Teilchenphysik-Gruppe der Fakultät für Physik der Universität Wien beteiligt. Mit dem Institut für Hochenergiephysik (HEPHY) und dem Stefan Meyer Institut für Subatomare Physik sind außerdem zwei Institute der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit dabei.
Das Spektrum der Themen ist breit. Auf experimenteller Seite wird sowohl am Large Hadron Collider des CERN in Genf mitgearbeitet, der im März mit bisher unerreichter Energie wieder in Betrieb gehen soll, als auch mit ultrakalten Neutronen bei extrem niedrigen Energien nach neuer Physik gesucht. Andere Forschungsthemen sind eher theoretischer Natur und beschäftigen sich mit Teilchen-Wechselwirkungen bei extremen Bedingungen oder mit der Quantenstruktur der Raumzeit.
In der modernen Teilchenphysik trifft sich das Allerkleinste mit dem Allergrößten. Um zu verstehen, wie das Universum entstanden ist, wie es sich verhält und warum es seine astronomisch großen Strukturen ausgebildet hat, muss man die Naturgesetze auf den kleinsten Skalen verstehen. Deshalb spielen hier sowohl Messdaten aus Teilchenbeschleunigern genauso eine Rolle wie die Untersuchung der kosmischen Hintergrundstrahlung.
Prominente Vortragende
Wer sich für Teilchenphysik interessiert oder vielleicht sogar überlegt, selbst eines Tages Forschung in dieser Richtung zu betreiben, ist eingeladen am 10. März um 14:00 im Kuppelsaal der TU Wien prominenten Vortragenden zu lauschen. Zunächst wird Prof. Anton Zeilinger einen Vortrag über Quantenverschränkung halten, danach wird Prof. John Ellis über die Suche nach dem Higgs-Teilchen und darüber hinaus erzählen.
Finanziert wird das neue Doktoratskolleg vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF – auch die FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund gehört zu den Ehrengästen bei der Eröffnung.
Inauguration Ceremony “Particles and Interactions”
Prof. Anton Zeilinger:
Quantum Entanglement: From Einstein via John Bell at CERN to Quantum Information
Prof. John Ellis:
The Long Road to the Higgs Boson and Beyond
The discovery of a Higgs boson was a milestone in our fundamental description of matter. Postulated theoretically in 1964 and the object of major experimental searches at CERN‘s LHC, this particle is vital evidence how other particles acquire their masses. However, there are many open questions in fundamental physics, such as the nature of astrophysical dark matter and the origin of matter itself. Future experiments at the LHC and other accelerators aim at answering these questions.
Das Doktoratskolleg online: www.dkpi.at
Rückfragehinweis:
Prof. Anton Rebhan
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
florian.aigner@tuwien.ac.at
[1]: Simulated particle trajectories © CERN
Ein Swimmingpool im Seminarraum - neuer Boden im SEM-136
Unser alter Teppichboden hatte ausgedient, ab heute zieren TU-blaue Linoleumbahnen den Boden unseres frisch ausgemalten Seminarraums. In den letzten Tagen vor Beginn des Sommersemesters 2015 hat sich im DB10 so einiges abgespielt.
Freitag, 20.2.:
Ausräumen der Kästen. Aufteilung unserer historischen Schätze auf die Destinationen „Archiv 3. Stock“, „TU-Archiv“, „Entsorgung“ und „Später-wieder-zurück-in-den-Seminarraum“. Wow, jede Menge Kisten.
Montag, 23.2.:
Abtransport der Kästen. Überall steht etwas auf dem Gang. Kaum zu glauben, dass all das plus 14 Tische und 70 Sessel in unserem Seminarraum waren.
Dienstag, 24.2.:
Direkt nach der Brandschutzunterweisung Abholung aller Sessel und Tische. Beginn der Abbrucharbeiten. Und siehe da, unter dem Spannteppich ist noch eine Schicht Linoleumfliesen. Nichts wie raus mit all den archäologischen Schichten samt Kleber.
Mittwoch, 25.2.:
Entfernung aller Kleberreste und Aufbringung der Ausgleichsmasse. Dann heißt es trocknen lassen.
Donnerstag, 26.2.:
Ausrichten und Aufkleben unseres neuen Bodens – wirklich gekonnt. Erstaunlich mit wie wenig Kleber man auskommen kann. Unser Boden ist fast so schön wie ein blauer Swimmingpool. Und natürlich brauchen wir Sesselleisten.
Freitag, 27.2.:
Nur noch die Nähte verklebt und schon verleiht der TU-blaue Boden unserem Seminarraum neuen Glanz. Eigentlich wäre Ausmalen auch eine sehr gute Idee – unser Herr Architekt Tamarstin macht es möglich.
Montag, 2.3.:
Das Abdecken und Abkleben dauert mindestens so lange wie der neue Farbauftrag.
Dienstag, 3.3.:
Einmal Bodenreinigung – jetzt ist er schon fast kitschig schön in unserem frisch ausgemalten Seminarraum.
Dann wieder alle Möbel hinein, so schnell, dass sogar das Foto unscharf geworden ist. Nach der Reinigung werden alle Schätze wieder eingeräumt – und schon kann das neue Sommersemester beginnen.
Jetzt brauchen nur noch die Garderoben in unserem Seminarraum eine kleine Überholung. Die G.U.T. ist schon beauftragt.
Ein großes und herzliches Dankeschön allen Helferinnen und Helfern bei dieser ersten großen Aufräum- und Umbauaktion des Jahres 2015!
Als nächstes stehen die Kästen in unserem Faxraum und die Möbellieferungen im dritten und im zehnten Stock an. Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen. Mehr Info bei Heike Höller, Simone Krüger und Sylvia Riedler.
Bildernachweis:
Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien
Feuer aus!
Am 24. Februar 2015 hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Brand- und Katastrophenschutz-Unterweisung durch die G.U.T. die Gelegenheit, ihr Wissen über Brandschutz und das richtige Verhalten im Ernstfall aufzufrischen.
Ruhe bewahren!
Alarmieren
(andere im Bereich, Druckknopfmelder, Feuerwehr: 122, Portierloge: (90) 44 44),
Wo? Was? Wer/wieviele sind verletzt? Wer ruft an?
Retten
(sich selbst und andere, Fenster und Türen schließen, Keile entfernen, das Haus verlassen, Aufzug nicht benützen, am Sammelplatz bleiben)
Löschen
(Feuerlöscher, ohne Selbstgefährdung, Feuerwehr einweisen)
Übung macht Meister – und so konnten wir selbst Feuerlöscher ausprobieren.
Bildernachweis:
Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien
Sicherheitsvertrauensperson:
Sylvia Riedler
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: sylvia.riedler [at] tuwien.ac.at
Georg Kastlunger erhält das Stipendium der Monatshefte für Chemie 2014
Das begehrte Stipendium, gesponsert von der Akademie der Wissenschaften, der Gesellschaft Österreichischer Chemiker und dem Springer Verlag, geht an ein Mitglied des Instituts für theoretische Physik der TU Wien.
Transportmechanismen in molekularen Kontakten
Georg Kastlunger
Georg Kastlunger wird vom Stipendium der Monatshefte für Chemie im kommenden Jahr beim Abschluss seiner Dissertation mit dem Titel "Theory of charge transport through single redox-active transition metal complexes" unterstützt werden. In seiner von Robert Stadler betreuten Doktorarbeit geht es um die theoretische Beschreibung von Ladungstransport im Nanomaßstab. Die Arbeit wird in Zusammenarbeit mit IBM Zürich und dem Imperial College London durchgeführt.
Minituarisierung und wandelbare Moleküle
Georg Kastlunger über seine Doktorarbeit: “Für die fortschreitende Miniaturisierung auf dem Gebiet der Elektronik ergibt sich naturgemäß eine Grenze bei der Annäherung an die Nanowelt. Ein Grund dafür ist, dass Bauteile basierend auf Silizium in einer Größenordnung von einzelnen Nanometern nicht exakt reproduzierbar sind. Durch chemische Synthese erzeugte Moleküle lösen dieses Problem und besitzen zusätzlich die Fähigkeit passiver (Dioden) und aktiver (Schalter, Transistoren) elektronischer Funktionalität. So können Konfigurationsänderungen oder eine Änderung des Redoxzustandes im Molekül verwendet werden, um zwischen stark und schwach leitenden Zuständen zu schalten. Eine besonders vielversprechende Molekülklasse in diesem Zusammenhang sind Übergangsmetallkomplexe, da sich durch die Fähigkeit des Zentralatoms, mehrere Ladungszustände einzunehmen, implizit die Eignung dieser als molekulare Schalter und Transistoren ergibt.“
Verschiedene Wege führen nach Rom
Die Zielsetzungen der Dissertation sind eine Beschreibung der Parameter einer elektronischen Komponente, die einen Übergangsmetallkomplex enthält, und eine Erklärung von gemessenen Strom-Spannungs-Charakteristika auf der Basis von ab initio Simulationen auf Basis der Dichtefunktionaltheorie (DFT).In Zürich und London werden zwei experimentelle Routen im Rahmen der Dissertation analysiert. Georg Kastlunger: „Das Setup, welches bei IBM Zuerich verwendet wird, basiert auf einer mechanisch kontrollierten “Break junction” (MCBJ) im Hochvakuum, wobei vor allem die Art und Stärke der Ankopplung verschiedener Moleküle an die Elektroden und eine implizite aktive Funktionalität dieser theoretisch untersucht wird. Am Imperial College London werden Messungen mithilfe eines elektrochemischen Rastertunnelmikroskops (STM) durchgeführt. Die theoretische Herausforderung dabei besteht in der Beschreibung des Effekts des Lösungsmittels und einer möglichen dritten (“Gate”) Elektrode. Weiters wird in diesem experimentellen Zusammenhang ein Übergang zwischen direktem (kohärentem) und schrittweisem (hopping) Elektronentransport in Abhängigkeit von der Länge der molekulare Brücke zwischen den Elektroden auf Basis von DFT beschrieben. Die Berechnungen der Simulationen werden am Vienna Scientific Cluster (VSC) in Wien durchgeführt.“
Bildernachweis:
Abdruck honorarfrei, Copyright TU Wien
Rückfragehinweis:
Georg Kastlunger
Institut für Theoretische Physik
E-Mail: georg.kastlunger [at] tuwien.ac.at
Elektronen-Wettrennen: Die kürzeste Sprintstrecke der Welt
Mit Laserpulsen lässt sich die Bewegung von Elektronen in Metall nun mit Attosekunden-Präzision untersuchen. Damit kann man elektronische Effekte verstehen – und vielleicht auch verbessern.
Ein Laserstrahl dringt in eine Struktur ein, die aus zwei verschiedenen Metallen besteht. In beiden Metallen können Elektronen aus ihrem Platz gelöst werden und sich nach außen (oben) bewegen. Die Dynamik dieses Vorgangs kann mit Attosekunden-Präzision gemessen werden.
Elektrischen Strom zu messen ist einfach. Die einzelnen Elektronen zu beobachten, aus denen dieser Strom besteht, ist allerdings äußerst schwierig. Mit einer Geschwindigkeit von mehreren Millionen Metern pro Sekunde rasen die Elektronen durch das Material, und die Distanzen, die sie zwischen zwei benachbarten Atomen zurückzulegen haben, sind äußerst kurz. Dementsprechend muss man winzige Zeitintervalle auflösen können, um den Sprint der Elektronen durchs Material zu studieren. Durch Messungen in Garching (Deutschland) und theoretische Berechnungen der TU Wien ist das nun gelungen. Wie sich zeigt, unterscheidet sich die Bewegung der Elektronen in einem Metall gar nicht besonders stark von der ballistischen Bewegung im freien Raum. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse nun im Journal „Nature“.
Die winzigen Zeitskalen der Quantenwelt
Der sogenannte „photoelektrische Effekt“ wurde bereits 1905 von Albert Einstein erklärt: Licht überträgt Energie auf ein Elektron, das dabei aus dem Material herausgelöst wird. Das geschieht so schnell, dass es lange Zeit völlig unmöglich erschien, den zeitlichen Ablauf dieses Effektes zu untersuchen. In den letzten Jahren hat sich allerdings das Forschungsgebiet der Attosekundenphysik deutlich weiterentwickelt, sodass man heute solche quantenphysikalischen Prozesse tatsächlich zeitaufgelöst analysieren kann.
Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer Milliardstelsekunde (10-18 Sekunden). So lange braucht das Licht ungefähr, um in einem Metall den Weg von einem Atom zum nächsten zurückzulegen. Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse kann man heute Messgenauigkeiten in Attosekunden-Größenordnung erreichen.
Die nun veröffentlichten Daten wurden am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching gemessen. Am Experiment beteiligt waren auch die TU München, das Fritz-Haber-Institut in Berlin, das Max-Planck-Institut für die Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg und die LMU München. An der TU Wien wurden dazu die theoretische Modelle und Computersimulationen entwickelt, um die experimentellen Ergebnisse präzise interpretieren zu können.
Wettlauf der Elektronen
„Im Experiment untersucht man ein Wettrennen der Elektronen“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Zwei verschiedene Metalle – Wolfram und Magnesium – werden aufeinandergestapelt und mit einem Laserpuls beschossen. Das Laserlicht kann nun entweder außen im Magnesium oder darunter im Wolfram Elektronen herauslösen, die dann nach kurzer Zeit den Weg an die Oberfläche finden. Nicht mal einen Nanometer legen die Elektronen dabei normalerweise zurück, und trotzdem kann man messen, mit welchem Vorsprung die Elektronen aus dem Magnesium vor den Elektronen aus der Wolfram-Schicht an der Oberfläche ankommen.
Die Länge der Elektronen-Sprintstrecke kann variiert werden: Zwischen einer und fünf Atomlagen Magnesium wurde auf das Wolfram aufgedampft. „Je dicker die Magnesium-Schicht ist, umso größer ist der mittlere zeitliche Vorsprung der Elektronen, die dort herausgelöst werden, gegenüber den Elektronen aus der Wolfram-Schicht“, sagt Christoph Lemell (TU Wien). Der einfache Zusammenhang zwischen Schichtdicke und Ankunftszeit zeigt, dass sich die Elektronen recht ungestört und geradlinig („ballistisch“) durch das Metall bewegen und es nicht zu komplexeren Stoßprozessen kommt.
Scharf gezogene Ziellinie
Entscheidend für die Zeitmessung beim Elektronen-Sprint ist eine wohldefinierte Ziellinie. Dafür wurde im Experiment ein weiterer Laserpuls auf die Metall-Oberfläche geschossen – und zwar so, dass er die aus dem Metall austretenden Elektronen beeinflusst, aber nicht ins Innere des Metalls eindringt. „Innerhalb eines Bereichs der kürzer ist als der Abstand zwischen zwei Metall-Atomen ändert sich die Intensität dieses Laserfeldes ganz extrem“, erklärt Georg Wachter (TU Wien). Schon in der äußersten atomaren Schicht des Metalls wird das Feld praktisch auf null reduziert, unmittelbar oberhalb der Metalloberfläche hingegen geraten die austretenden Elektronen sofort in ein starkes Laserfeld. Erst durch die Schärfe dieses Übergangs wird die präzise Messung möglich.
Die neuen Erkenntnisse sollen bei der weiteren Miniaturisierung von elektronischen und photonischen Bauteilen helfen – und sie sind ein weiterer Beweis für die erstaunlichen Möglichkeiten der Attosekundenphysik, durch deren Techniken atomare Phänomene immer besser studiert werden können. „Dieser Forschungsbereich könnte ganz neue Türen öffnen, neue Methoden für die Quantentechnologie liefern und uns helfen, grundlegende Fragen der Materialwissenschaft und Elektronik zu verstehen“, sagt Joachim Burgdörfer.
Graphikdownload: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Publikation "Nature":
http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7534/full/nature14094.html
Rückfragehinweise:
Prof. Christoph Lemell
Institut für Theoretische Physik
christoph.lemell@tuwien.ac.at
Dr. Georg Wachter
Institut für Theoretische Physik
georg.wachter@tuwien.ac.at
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
joachim.burgdoerfer@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T.: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Jakob Salzer erhält ÖPG-Studierendenpreis
Jakob Salzer
Jakob Salzer erhält den Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit 2014. Seine Arbeit, die unter der Anleitung von Ass. Prof. Daniel Grumiller erstellt wurde, trägt den Titel „The Cosmological Constant as a Thermodynamical Variable in 2d Dilaton Gravity“. Darin beschäftigte er sich mit der Thermodynamik Schwarzer Löcher in einem bestimmten Gravitationsmodell in Anwesenheit einer veränderlichen kosmologischen Konstante.
Thermodynamik und Schwarze Löcher
In mehreren bahnbrechenden Arbeiten zeigten Stephen Hawking und Jacob Bekenstein in den siebziger Jahren, dass bestimmten Raumzeiten – im Besonderen auch Schwarze Löcher – Temperatur und Entropie zugeordnet werden können. Schwarze Löcher folgen also den üblichen Gesetzen der Thermodynamik, die auch das Verhalten gewöhnlicher makroskopischer Systeme bestimmen, z.B.: Wärme fließt vom wärmeren Körper zum kälteren. Bei makroskopischen Objekten jedoch lassen sich die Gesetze der Thermodynamik aus dem kollektiven Verhalten einer großen Anzahl von mikroskopischen Konstituenten (Atome, Moleküle) herleiten, was nahelegt, dass Ähnliches auch für Schwarze Löcher möglich sein sollte. Die Identifizierung dieser mikroskopischen Freiheitsgrade und das damit verbundene Problem einer konsistenten Quantentheorie der Gravitation ist jedoch noch immer Gegenstand intensivster Forschungsbemühungen.
Gravitation in 2 Dimensionen: ein toy-model für die Allgemeine Relativitätstheorie
Jakob Salzer beschreibt die Motivation hinter seiner Masterarbeit so: ”Die Behandlung grundlegender Fragen zu Schwarzen Löchern ist im Rahmen der Allgemeinen Relativitätstheorie oft erschwert durch das Zusammenspiel von Problemen technischer und konzeptueller Natur. In solchen Fällen ist es oft zielführender, vereinfachte Theorien - so genannte ‘toy-models' - zu betrachten, in denen konzeptuelle Fragen untersucht werden können, während Probleme technischer Natur auf ein Minimum reduziert sind. Ein beliebtes ‘toy-model' für die Allgemeine Relativitätstheorie ist zwei-dimensionale (2d) Dilaton- Gravitation.”
In dieser Gravitationstheorie untersuchte Jakob Salzer das thermodynamische Verhalten Schwarzer Löcher bei Anwesenheit einer veränderlichen kosmologischen Konstante.
Auch in seiner Dissertation beschäftigt sich Jakob Salzer mit Aspekten der Thermodynamik Schwarzer Löcher im Rahmen der 2d Dilaton Gravitation.
Rückfragehinweis:
Jakob Salzer
Institut für Theoretische Physik
T.: +43 (1) 58801-13622
jakob.salzer@tuwien.ac.at
Max Riegler erhält DOC Stipendium
Eines der begehrten DOC Stipendien der Akademie der Wissenschaften geht an ein Mitglied des Instituts für Theoretische Physik an der TU Wien.
Max Riegler
Nach dem Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit im Jahr 2013 konnte Max Riegler 2014 die international besetzte Gutachterkommission des Doktorand(inn)enprogramms der ÖAW von sich und seinem Forschungsschwerpunkt überzeugen. Im Rahmen seiner Dissertation mit dem Titel "Higher-Spin Holography in 2+1 Dimensions" wird Max Riegler von einem der prestigeträchtigen DOC Stipendien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die kommenden 2 Jahre unterstützt werden.
Schematische Darstellung der Berechnung von holographischer Verschänkungsentropie. Die Verschränkungsentropie zwischen den Gebieten A und B ist proportional zur Fläche der Oberfläche F, deren Rand das Gebiet A begrenzt.
Das holographische Prinzip in höheren Dimensionen
Max Riegler arbeitet unter der Anleitung von Associate Prof. Daniel Grumiller an seiner Dissertation, in der er sich im Wesentlichen mit dem so genannten "holographischen Prinzip" auseinandersetzt. Max Riegler, der im Moment einen viermonatigen Forschungsaufenthalt an der Kyoto Universität in Japan absolviert, beschreibt das Thema seiner Dissertation folgendermaßen:
„Im Wesentlichen beschäftige ich mich im Rahmen meiner Dissertation mit der Frage nach einem besseren Verständnis einer möglichen Theorie der Quantengravitation, die Gravitation auf sehr kleinen Längenskalen oder alternativ bei sehr großen Energien, bzw. Massen, korrekt beschreibt. Das so genannte "holographische Prinzip" ist eine Möglichkeit, um einem besseren Verständniss dieses Problems näher zu kommen. Dieses Prinzip besagt, dass man eine Theorie, die Gravitation beschreibt, auch zur Beschreibung einer Quantentheorie nutzen kann, die allerdings eine Dimension weniger besitzt als die Gravitationstheorie. Umgekehrt funktioniert es ebenso.
Besonders interessant ist die Frage, wie dieses holographische Prinzip für Gravitationstheorien funktioniert, die mehr Symmetrie aufweisen als sonst üblich. Im holographischen Kontext kann man diese zusätzlichen Symmetrien als Objekte mit "höherem spin" (mehr als spin=2) auffassen, daher der Name "Higher-Spin".
Von speziellem Interesse für meine Forschungsarbeit ist es im Moment, mich mit Verschränkungsentropie, einem Maß für die Verschränkung von
Quantensystemen, auseinanderzusetzen. Insbesondere Raumzeiten, welche keine Krümmung aufweisen sind ein sehr interessantes Betätigungsfeld für meine Forschung. Besonders reizvoll sind in diesem Zusammenhang auch geometrische Zusammenhänge, die helfen, Theorien mit höherem Spin besser zu verstehen.“
Bildernachweis:
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei
Rückfragehinweis:
Max Riegler
Institut für Theoretische Physik
T.: +43 (1) 58801-13622
rieglerm@hep.itp.tuwien.ac.at
Teilchen, Wellen und Ameisen
Tiere, die nach Futter suchen, oder Elektronen, die sich durch Metall bewegen: Zwischen verblüffend unterschiedlichen Phänomenen wurden an der TU Wien überraschende Gemeinsamkeiten gefunden.
Ameisen und Wellen - gibt es da Ähnlichkeiten? [1]
Werden Teilchen oft gestreut, entstehen komplizierte Wege ...
... werden Teilchen seltener gestreut, ist die Eindringtiefe größer, der durchschnittliche Weg, den die eingedrungenen Teilchen zurücklegen, ist jedoch gleich lang.
Eine Welle dringt in einen Bereich mit vielen Störstellen ein.
Eine Welle dringt in einen Bereich mit wenigen Störstellen ein.
Ein Betrunkener torkelt ziellos auf einen Platz, auf dem Straßenlaternen stehen. Ab und zu wird er an eine Laterne stoßen, seine Richtung ändern müssen und weitertorkeln. Hängt seine Verweildauer auf diesem Platz von der Anzahl der Straßenlaternen pro Fläche ab? Die überraschende Antwort ist: Nein.
Egal ob auf jedem Quadratmeter eine Straßenlaterne im Weg steht, oder ob die Abstände zwischen ihnen groß sind – der Betrunkene braucht auf seiner zufälligen Wanderung vom Betreten bis zum Verlassen des Platzes im Durchschnitt immer gleich lange. Berechnungen der TU Wien zeigen nun, dass diese Konstanz der Verweildauer ein universelles Phänomen ist. Transportphänomene aus ganz unterschiedlichen Bereichen lassen sich so erklären – von der Wanderung von Ameisen bis zu Lichtwellen, die ihren Weg durch diffuses Milchglas suchen.
Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit Forschungteams aus Frankreich erarbeitet (Institut Langevin und Laboratoire Kastler-Brossel, Paris) und wurden nun im Fachjournal PNAS veröffentlicht.
Und wenn ich auch wanderte im finsteren Glas …
Prof. Stefan Rotter (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) untersucht mit seinem Team, wie sich Wellen in einem ungeordneten Medium ausbreiten. Das können Lichtwellen sein, die durch eine getönte Fensterscheibe dringen, oder auch Quantenteilchen, die sich wellenartig durch ein Material mit einzelnen Störstellen bewegen.
„Solche Transportphänomene charakterisiert man normalerweise mit Hilfe der sogenannten mittleren freien Weglänge“, erklärt Rotter. Das ist die Strecke, die sich eine Welle oder ein Teilchen typischerweise frei bewegen kann, bis sie auf das nächste Hindernis trifft – also der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Straßenlaternen im Fall des torkelnden Wanderers, oder die Distanz zwischen zwei mikroskopischen Partikeln im Glas, an denen eine Lichtwelle gestreut wird.
Die Verweildauer ist immer gleich
Von dieser mittleren freien Weglänge hängen viele wichtige physikalische Größen ab – zum Beispiel legt sie fest, welcher Anteil des Lichts von einer trüben Glasscheibe durchgelassen wird. „Man kann auch berechnen, wie viel Zeit der durchgelassene und der reflektierte Anteil des Lichts jeweils im Glas verbringen. Auch diese Größen, die sogenannte Transmissionszeit und die Reflektionszeit, hängen stark von der mittleren freien Weglänge ab“, erklärt Philipp Ambichl, Doktorand in der Gruppe Rotter und Ko-Autor der Studie.
Betrachtet man diese beiden Anteile aber gemeinsam um insgesamt die durchschnittliche Verweildauer des Lichts im Glas zu berechnen, dann heben sich diese Abhängigkeiten auf. Im Ergebnis kommt die freie Weglänge nicht mehr vor. Licht hält sich also in einer sehr trüben Glasplatte genauso lange auf wie in einer beinahe durchsichtigen.
Beim Betrunkenen und den Straßenlaternen ist es genauso: Stehen viele Laternen im Weg, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich zu Beginn irgendwo anstößt, gleich umkehrt und gar nicht weit in den Platz vordringt – dann ist die Aufenthaltsdauer klein. Wege, die ihn auf die andere Seite des Platzes führen, dauern umso länger, je mehr Straßenlaternen es gibt. Insgesamt heben sich die beiden Effekte auf, sodass die zu erwartende Verweildauer auf dem Platz immer gleich ist.
„Verblüffend ist, dass diese Erkenntnis auf ganz unterschiedliche Systeme zutrifft“, sagt Philipp Ambichl. „Sie trifft etwa auf Kugeln zu, die man über ein Brett rollen lässt, in dem zufällig verteilte Nägel eingeschlagen sind. Es gilt aber auch für Elektronen-Wellen, die sich durch ein ungeordnetes Material bewegen, wo das Elektron zum Beispiel an einzelnen Atomen gestreut wird.“
Sogar in der Biologie lässt sich das Phänomen beobachten: Wenn Ameisen über eine Fläche spazieren, kann man das auch als Zufalls-Wanderung beschreiben und mathematisch abschätzen, wie lange sie auf dieser Fläche verweilen werden. Eine große Ameise braucht für die Reise weniger Schritte als eine kleine, die kleinere Ameise hat daher viel öfter die Möglichkeit, ihre Richtung zu ändern. Trotzdem ist die Verweildauer für beide Ameisen gleich, sie hängt nur von der Größe des betrachteten Areals ab.
„In der Gesamt-Verweildauer haben wir eine feste Größe identifiziert, die von der mittleren freien Weglänge gänzlich unabhängig ist. Dieses erstaunliche Resultat wird uns helfen ganz unterschiedliche Transportphänomene besser zu verstehen die etwa auch in ganz konkreten Anwendungen wie Solarzellen auftreten“, sagt Stefan Rotter. Egal ob Teilchen, Wellen oder Ameisen – vom Studium eines Transportprozesses kann man auch etwas über scheinbar völlig anders gelagerte Vorgänge lernen.
Der Fachartikel wird diese Woche im Journal "PNAS" publiziert. Eine frei zugängliche Vorversion finden Sie hier:
http://arxiv.org/abs/1409.7229
Bildernachweis:
[1] Bild:Fir0002/Flagstaffotos, GNU Free Documentation Licence 1.2
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13618
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Laserpulse und Materie: IMPRS-APS-Meeting in Wien
Die TU Wien kooperiert mit den Max-Planck-Zentren bei der Erforschung ultrakurzer Laserpulse und ihrer Auswirkungen. Von 24. bis 26.11. wird das Thema in einer Vortragsreihe vorgestellt.
Laserpulse und Materie
Den kürzesten und schnellsten Vorgängen, die es in der Natur gibt, versucht man mit Laserpulsen auf die Spur zu kommen. Auf der Zeitskala von Femto- und Attosekunden lassen sich chemische und quantenphysikalische Phänomene beobachten. Die TU Wien kooperiert mit der deutschen Max-Planck-Gesellschaft und ist an der Max-Planck-Research School of Advanced Photon Science (IMPRS-APS) beteiligt. Das Jahrestreffen findet diesmal in Wien statt. Dabei wird es zahlreiche Vorträge über dieses Forschungsgebiet zu hören geben – die meisten davon werden die Doktorandinnen selbst halten. Studierende, die sich einen Eindruck von diesem spannenden Forschungsgebiet verschaffen wollen, sind herzlich eingeladen.
Einblick in internationale Top-Forschung
Gleich zwei Forschungsgruppen der TU Wien aus zwei unterschiedlichen Fakultäten sind Teil der Research School: Das Team von Prof. Joachim Burgdörfer (Institut für Theoretische Physik) und jenes von Prof. Karl Unterrainer (Institut für Photonik, Fakultät für Elektrotechnik). Die zahlreichen Doktorandinnen und Doktoranden der TU Wien, die in den vergangenen Jahren Teil des IMPRS-APS waren, haben davon sehr profitiert: „Diese Research School bietet die Möglichkeit, schon früh internationale Kontakte zu weltweit führenden Forschungsgruppen zu knüpfen. Für eine wissenschaftliche Karriere ist das äußerst nützlich“, sagt Joachim Burgdörfer.
Von Montag, dem 24.11. bis Mittwoch, 26.11., findet die IMPRS-APS-Tagung in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Theatersaal, Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien) statt. Wer einen Einblick in die aktuelle Attosekunden-Forschung und die Wechselwirkung ultrakurzer Lichtpulse mit Materie erhalten möchte, ist herzlich eingeladen, die Vorträge zu besuchen.
Detailliertes Programm:
http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/tuwien/fotos/news/IMPRS_Annual_Vienna2014_Program_2.pdf
Gewinnen durch Verlust
Ein scheinbar widersinniges Verhalten von Lasern, das an der TU Wien vorhergesagt worden war, konnte nun in einem neuen Experiment bestätigt werden, wie das Fachjournal „Science“ berichtet.
Zwei kreisförmige Raman-Laser werden aneinander gekoppelt und durch eine Licht-Faser mit Energie versorgt (sh. gelbe Linie). [1]
Fügt man einem der beiden Laser Verluste zu, wie durch den absorbierenden Streuer rechts, beginnt das gekoppelte System zu lasen und emittiert einen kohärenten Lichtstrahl (sh. rote Linie). [1]
Matthias Liertzer (l) und Stefan Rotter (r)
Was zunächst wie eine mathematische Kuriosität aussah ist nun zur neuen Laser-Technologie geworden. Vor zwei Jahren wurde von Physikern der TU Wien ein paradoxer Laser-Effekt vorhergesagt: In bestimmten Situationen kann man einen Laser einschalten, indem man ihm nicht mehr Energie zuführt, sondern ihm stattdessen Energie entnimmt. Erste experimentelle Anzeichen für diesen Effekt wurden vor kurzem an der TU gefunden; nun konnte der paradoxe Laser-Effekt in Zusammenarbeit mit Teams von der Washington University in St. Louis, USA und von RIKEN, Japan auf ein weiteres Laser-System übertragen und dort präzise vermessen werden. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Science“ veröffentlicht.
Einschalten durch Ausschalten
Matthias Liertzer und Prof. Stefan Rotter stießen zunächst in Computersimulationen auf den Effekt: „Wenn man zwei kleine, gleichartig gebaute Laser in engen Kontakt zueinander bringt, dann können sich diese auf eine Weise beeinflussen, die auf den ersten Blick jeder Erwartung widerspricht“, erklärt Stefan Rotter. „Normalerweise leuchtet ein Laser, wenn man ihm mehr Energie zuführt. Doch bei geeigneter Laser-Kopplung kann eine Energiezufuhr die beiden Laser abschalten und ein Energieverlust kann die Laser zum Leuchten bringen.“
In einem Laser werden Lichtteilchen vervielfältigt, es kommt zu einer Kettenreaktion die letztendlich kräftige Strahlung erzeugt. Normalerweise ist dabei jeder Lichtverlust höchst unerwünscht. Wenn zu viel Licht verlorengeht, etwa durch eine schlecht verspiegelte Außenwand des Lasers, dann kann die Lichtproduktions-Kettenreaktion nicht aufrecht erhalten werden und der Laser erlischt.
Paradoxes Verhalten am „Entartungspunkt“
„Die Eigenschaften der Laser kann man durch mathematische Gleichungssysteme sehr gut beschreiben und verstehen“, erklärt Matthias Liertzer. „Wenn man sich diese Gleichungen genau ansieht, mit denen auch die Kopplung zwischen zwei Lasern beschrieben wird, dann stellt man fest, dass hier sogenannte Entartungspunkte auftreten. Befindet sich der Zustand, der den Laser mathematisch charakterisiert, in der Umgebung eines solchen Entartungspunktes, dann zeigt sich paradoxes Verhalten.“
Im Experiment, das von Bo Peng und Dr. Sahin Kaya Ozdemir mit der Gruppe von Prof. Lan Yang in St. Louis, USA durchgeführt wurde, stellte man zwei winzige kreisförmige Laser her, die man in unmittelbarer Nähe zueinander platzierte. Zusätzlich wurde eine feine Spitze aus Chrom in das System eingebracht, die Licht stark absorbiert. Durch genaues Justieren der Spitze kann der Lichtverlust fein dosiert werden. „Die Experimente bestätigten unsere Vorhersagen: Wenn sich das System in der Nähe des Entartungspunktes befindet, führt die Absorption der Spitze dazu, dass sich der Laser einschaltet und zu leuchten beginnt“, sagt Stefan Rotter.
Die Besonderheiten solcher Entartungspunkte zu verstehen wird für ganz unterschiedliche technologische Anwendungen wichtig sein, glaubt Rotter: „Das kann für hochsensible Detektoren nützlich sein, oder für jedes andere System das aus gekoppelten Oszillatoren besteht, wie zum Beispiel in der Opto-Mechanik. Jedenfalls gibt es noch viele interessante Effekte, die man im Zusammenhang mit diesen Entartungspunkten studieren kann“, meint Stefan Rotter.
Originalartikel "Perspective Article" von Science:
http://www.sciencemag.org/content/346/6207/328.full
Bildernachweis:
[1]: J. Zhu, B. Peng, S.K. Ozdemir, L. Yang
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei
Rückfragehinweise:
Dipl.-Ing. Matthias Liertzer
Institut für Theoretische Physik
T.: +43-1-58801-13644
matthias@liertzer.at
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13618
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Laserpuls macht Glas zum Metall
Mit Laserpulsen kann man einem elektrisch isolierenden Material für winzige Sekundenbruchteile Eigenschaften eines Metalls verleihen - das zeigen Rechnungen der TU Wien. Damit könnte man Schaltungen bauen, die um Größenordnungen schneller getaktet sind als heutige Mikroelektronik.
Computersimulationen zeigen, wie Elektronen von einem Atom wegfließen und sich fortbewegen.
Georg Wachter (Bild) berechnet die Materialeigenschaften von Glas, beim Auftreffen von Laserpulsen.
Ein Laserpuls trifft ein Stück Quarzglas zwischen zwei Elektroden.
Quarzglas leitet keinen Strom, es ist ein klassisches Beispiel für einen elektrischen Isolator. Doch mit ultrakurzen Laserpulsen ist es möglich, innerhalb von Femtosekunden (eine fs entspricht 10 hoch -15 Sekunden) die elektronischen Eigenschaften von Glas völlig zu verändern. Ist der Laserpuls stark genug, können sich Elektronen im Material frei bewegen. Das Quarzglas verhält sich dann für einen winzigen Augenblick wie ein Metall, es leitet Strom und wird undurchsichtig. Dieser Wandel der Materialeigenschaften findet auf so kurzen Zeitskalen statt, dass man ihn für extrem schnelle lichtbasierte Elektronik nutzen könnte. Am Institut für Theoretische Physik der TU Wien konnte man diesen Effekt nun mit Hilfe von Computersimulationen erklären.
Wer kleine Dinge beobachten will, muss schnell sein
Ultrakurze Laserpulse mit einer Dauer im Bereich von wenigen Femtosekunden wurden in den letzten Jahren immer wieder dazu benutzt, quantenphysikalische Effekte in Atomen oder Molekülen zu untersuchen. Nun zeigt sich, dass solche Laserpulse auch dazu geeignet sind, Materialeigenschaften blitzschnell zu verändern. Im Experiment (am Max-Planck-Institut in Garching) hatte man festgestellt, dass elektrischer Strom durch Quarzglas fließt, während es vom Laserpuls getroffen wird. Nach dem Ende des Laserpulses kehrt das Material wieder in seinen Ausgangszustand zurück. Wie dieser merkwürdige Effekt genau abläuft, konnten Georg Wachter, Christoph Lemell und Prof. Joachim Burgdörfer von der TU Wien in Zusammenarbeit mit Forschern von der Tsukuba University in Japan nun erstmals berechnen.
Quantenphysikalisch betrachtet kann ein Elektron in einem Festkörper verschiedene Zustände einnehmen. Es gibt Zustände, in denen es fest an ein bestimmtes Atom gebunden ist, bei anderen Zuständen höherer Energie kann es sich zwischen den einzelnen Atomen frei bewegen. Das Elektron verhält sich ähnlich wie eine Kugel auf einer verbeulten Oberfläche: Wenn sie wenig Energie hat, bleibt sie in einem bestimmten Tal liegen. Verhilft man ihr mit einem kräftigen Kick zu mehr Energie, rollt sie frei herum.
„Der Laserpuls ist ein extrem starkes elektrisches Feld, das die Zustände der Elektronen im Quarz dramatisch verändert“, erklärt Georg Wachter. „Der Puls kann nicht nur Energie auf die Elektronen übertragen, er kann die gesamte Struktur der möglichen Elektronen-Zustände im Material verbiegen.“
Dadurch ist es möglich, dass ein Elektron, das sonst fest an ein Sauerstoff-Atom im Quarzglas gebunden ist, plötzlich zu einem anderen Atom überwechselt und sich ähnlich benimmt wie ein frei bewegliches Elektron in einem Metall. Hat es der Laserpuls erst einmal geschafft, Elektronen von den Atomen zu lösen, kann das elektrische Feld des Pulses die Elektronen gezielt in eine bestimmte Richtung treiben und Strom beginnt zu fließen. Bei sehr starken Laserpulsen hält dieser Stromfluss sogar noch für eine kurze Weile an, nachdem der Laserpuls schon wieder abgeklungen ist.
Mehrere Quanten-Prozesse auf einmal
„Die genaue Berechnung solcher Effekte ist sehr aufwändig, weil man viele Effekte gleichzeitig berücksichtigen muss“, sagt Prof. Burgdörfer. Die elektronische Struktur des Materials, die Wechselwirkung der Elektronen mit dem Laser, und auch die Wechselwirkung der Elektronen untereinander muss quantenphysikalisch berechnet werden - eine Aufgabe, die nur mit Supercomputern zu lösen ist. „In unserer Computersimulation können wir den zeitlichen Verlauf wie in Zeitlupe nachverfolgen und verstehen, was hier eigentlich geschieht“, erklärt Burgdörfer.
In den Transistoren, die heute verwendet werden, bewegen sich bei jedem Schaltvorgang eine große Zahl von Ladungsträgern bis sich ein neuer Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Dementsprechend braucht der Schaltvorgang eine gewisse Zeit. Beim vom Laserpuls ausgelösten blitzartigen Ändern der Materialeigenschaften ergibt sich eine neue Situation: der Schaltvorgang erfolgt durch die Änderung der Elektronenzustände und durch die Ionisation der Atome. „Das gehört zu den schnellsten Prozessen, die man in der Festkörperphysik kennt“, sagt Christoph Lemell. Transistoren arbeiten auf einer Zeitskala von einigen Pikosekunden (10 hoch -12 Sekunden), mit Laserpulsen kann man Ströme mehr als tausend mal schneller schalten.
Die Berechnungen zeigten, dass die Kristallstruktur und die chemischen Bindungen im Material einen überraschend großen Einfluss auf den ultraschnellen Stromfluss haben. Es sollen daher nun Experimente mit unterschiedlichen weiteren Materialen folgen, um den Effekt noch besser nutzen zu können.
Die Berechnungen wurden nun im Journal "Physical Review Letters" veröffentlicht (Originalpublikation (frei zugängliche Version)):Bildernachweis:
http://arxiv.org/abs/1401.4357
Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Rückfragehinweis:
Dipl.-Ing. Georg Wachter
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13630
georg.wachter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Eine Flüssigkeit, die nicht gefriert
Neuartige Makromoleküle zeigen völlig überraschende thermodynamische Eigenschaften. Ein Workshop versammelt die Soft-Matter-Community nun an der TU Wien.
Es ist nur eine Frage der Temperatur, irgendwann friert praktisch jede Flüssigkeit. Die einzige bisher bekannte Ausnahme ist das Edelgas Helium, das selbst am absoluten Nullpunkt flüssig bleibt. Doch Helium ist ein Sonderfall – es geht schließlich auch keine stabilen chemischen Verbindungen ein. Alle Substanzen, die atomare oder molekulare Netzwerke ausbilden, wie etwa Kohlenstoff, werden unterhalb einer bestimmten Temperatur fest. Neue Computeranalysen zeigen allerdings, dass es bei dieser Regel ein Schlupfloch gibt: Sogenannte „DNA-Nanosterne“ können Strukturen bilden, die selbst bei niedrigsten Temperaturen nicht zu einer geordneten Struktur gefrieren. Solche und ähnliche Phänomene stehen im Mittelpunkt eines von der TU Wien organisierten Workshops über Materialwissenschaft.
Ordnung hat weniger freie Energie
In einer Flüssigkeit bewegen sich Atome oder Moleküle völlig ungeordnet, in einem Festkörper ordnen sie sich nach einer regelmäßigen Struktur an. „Normalerweise stellt die geordnete Phase bei niedrigen Temperaturen den stabilen Aggregatszustand dar, weil die geordnete Struktur eine geringere freie Energie hat als die ungeordnete, flüssige Phase“, erklärt Prof. Gerhard Kahl (Institut für Theoretische Physik, TU Wien). Nun wurden allerdings von der Forschungsgruppe von Francesco Sciortino (Universität Rom, La Sapienzia) Computersimulationen präsentiert, die zeigen, dass die Sache auch anders aussehen kann.
Sogenannte „DNA-Nanosterne“ sind Makromoleküle, die aus vier speziell synthetisierten DNA-Doppelketten aufgebaut sind. Sie können ungeordnete Strukturen ausbilden, die selbst bei niedrigsten Temperaturen eine geringere freie Energie aufweisen als die konkurrierende geordnete Diamantstruktur. Solche Systeme können also selbst bei extrem niedrigen Temperaturen stabile ungeordnete Phasen ausbilden – energetisch ist es für solche Substanzen auch bei extremer Kälte günstiger, im flüssigen Zustand vorzuliegen und nicht zur Diamantstruktur zu erstarren.
„Die DNA-Nanosterne zeichnen sich durch eine große Flexibilität in ihren Armen aus“, sagt Gerhard Kahl. „Wie Sciortino und Mitarbeiter zeigen konnten, ist gerade diese Eigenschaft dafür verantwortlich, dass die ungeordnete Phase selbst bei tiefen Temperaturen eine niedrigere freie Energie erzielen kann als eine geordnete Kristallstruktur und somit thermodynamisch stabil ist.“ Bisher wurde diese Art von Makromolekülen nur am Computer untersucht, der experimentelle Nachweis steht noch aus.
TU-Workshop
Diese Klasse von Kolloide sind zentrales Thema eines Workshops, der vom 23. bis 26.9.2014 am Danube Center for Atomistic Simulations (DaCAM) an der TU Wien stattfindet. Theoretiker und Experimentalisten aus aller Welt diskutieren aktuelle neueste Entwicklungen auf diesem Gebiet. Organisiert wird diese Veranstaltung von Emanuela Bianchi, Gerhard Kahl (beide TU Wien), Christos N. Likos (Universitaet Wien) und eben Francesco Sciortino (Rom). DaCAM ist der Wiener Knoten des CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire), eines europaeischen Netzwerkes, das sich den Anwendungen und der Weiterentwicklung von atomaren und molekularen Simulationen in einem breiten Themenspektrum (von der Biologie bis zu den Materialwissenschaften) widmet.
Rückfragehinweis:
Dr. Emanuela Bianchi
Institut für Theoretische Physik
T: +43-1-58801-13631
emanuela.bianchi@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
"Cavity Protection Effect" macht Quanteninformation langlebig
Hybridsysteme aus Mikrowellenresonatoren und Atom-Spins in Diamant gelten als Hoffnungsträger für zukünftige Quantentechnologien. Durch einen neuartigen Trick gelang es Forschern an der TU Wien, die Speicherdauer in diesem System deutlich zu verbessern.
Das an der TU Wien verwendete Quantensystem: In der Mitte sitzt ein schwarzer Diamant mit Stickstoffatomen, sie koppeln an das Licht eines Mikrowellenresonators.
Das Team: Jörg Schmiedmayer, Johannes Majer, Stefan Putz, Dmitry Krimer und Stefan Rotter (v.l.n.r)
Die Elektronik in unseren Computern kennt nur zwei Zustände: entweder null oder eins. Quantensysteme hingegen können beliebige Überlagerungen von Zuständen annehmen – also null und eins gleichzeitig. Man hofft, basierend darauf in Zukunft superschnelle Quantencomputer bauen zu können, doch bis dahin sind noch schwierige technologische Probleme zu lösen. Insbesondere hat man damit zu kämpfen, dass gespeicherte Quantenzustände durch Wechselwirkungen mit der Umgebung extrem leicht zerstört werden. An der TU Wien ist es nun gelungen, einen speziellen Schutzeffekt zu nutzen, um die Stabilität eines besonders vielversprechenden Quantensystems deutlich zu erhöhen.
Ein Quantenrechner aus zwei Systemen
Es gibt heute ganz unterschiedliche Konzepte für die Speicherung von Quanteninformation. "Wir verwenden ein Hybridsystem aus zwei völlig verschiedenen Quantentechnologien", erklärt Johannes Majer vom Atominstitut der TU Wien. Gemeinsam mit seinem Team koppelt er Mikrowellen und Atome und arbeitet damit an der Verwirklichung eines Quantenspeichers. Die theoretischen Modelle dazu wurden von Dmitry Krimer und Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien entwickelt.
In einem Mikrowellenresonator werden Photonen erzeugt. Sie wechselwirken mit dem Spin von Stickstoffatomen, die in Diamant eingebaut sind. Der Mikrowellenresonator ermöglicht Quanteninformation schnell zu transportieren, die Atomspins im Diamant können diese speichern, zumindest für eine Zeitdauer von einigen hundert Nanosekunden. Das ist lange genug, verglichen mit der extrem kurzen Zeitskala, auf der sich Photonen im Mikrowellenresonator hin und her bewegen.
"Eigentlich sind alle Stickstoffatome zwar völlig gleich, aber wenn sie im Diamant jeweils in eine leicht unterschiedliche Umgebung platziert sind, dann haben sie auch leicht unterschiedliche Schwingungsfrequenzen", sagt Stefan Putz, Doktorand am Atominstitut. Die Atomspins verhalten sich dann wie ein Raum voller Pendeluhren mit leicht unterschiedlich langen Pendeln: Am Anfang schwingen sie ziemlich synchron, aber nachdem sie niemals völlig identisch sind, laufen sie nach einer gewissen Zeit aus dem Takt und übrig bleibt ein wildes Durcheinander.
Ordnung durch Kopplung
"Wenn die Energien der einzelnen Spins auf passende Weise verteilt sind, kann man durch eine starke Kopplung zwischen Atomspins und dem Mikrowellenresonator erreichen, dass die Spins viel länger im Gleichtakt schwingen", erklärt Dmitry Krimer. Die Atomspins haben zwar keinen direkten Einfluss aufeinander, aber die Tatsache, dass sie kollektiv stark an den Mikrowellenresonator gekoppelt sind, verhindert, dass der Quantenspeicher in Zustände übergeht, die für Quanteninformations-Übertragung nicht mehr genutzt werden können. Dieser Quanten-Schutzeffekt gegen den Zerfall der quantenmechanischen Eigenschaften des Systems verlängert die Zeitdauer, in der man Quanteninformation aus den Atomspins auslesen kann erheblich.
"Durch die Verbesserung der Quanten-Kohärenzzeit auf Basis dieses Cavity Protection Effekts eröffnen sich vielversprechende Anwendungsmöglichkeiten für unsere hybriden Quantenspeicher", sagt Johannes Majer.
Die Arbeit wurde im Journal Nature Physics veröffentlicht:
http://www.nature.com/nphys/journal/v10/n10/full/nphys3050.html
Bildernachweis:
Quantensystem: (Abdruck honorarfrei, Copyright: Dieter Brasch für Terra Mater Magazin)
Team: Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Rückfragehinweis:
Dr. Johannes Majer
Atominstitut
T: +43-1-58801-141838
johannes.majer@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Neues Material ermöglicht ultradünne Solarzellen
An der TU Wien gelang es, zwei unterschiedliche Halbleitermaterialien zu kombinieren, die jeweils aus nur drei Atomlagen bestehen. Dadurch ergibt sich eine vielversprechende neue Struktur für Solarzellen.
Marco Furchi, Thomas Müller, Andreas Pospischil (v.l.n.r.)
Das Schichtsystem der Solarzelle: innen die beiden Halbleiter, darüber und darunter befinden sich elektrische Kontakte.
Durchsichtige, hauchdünne, biegsame Solarzellen könnten bald Wirklichkeit werden. An der TU Wien gelang es Thomas Müller und seinen Mitarbeitern Marco Furchi und Andreas Pospischil, eine neuartige Halbleiterstruktur aus zwei ultradünnen Atomschichten herzustellen, die sich ausgezeichnet für den Bau von Solarzellen eignet.
Schon vor einigen Monaten war es an der TU Wien gelungen, eine ultradünne Schicht des photoaktiven Kristalls Wolframdiselenid zu produzieren. Durch die erfolgreiche Kombination mit einer zweiten Schicht aus Molybdändisulfid entstand nun ein Material, das großflächig als Solarzelle einsetzbar ist. Das Forschungsteam erhofft sich, damit eine neue Solarzellentechnologie zu begründen.
Zweidimensionale Schichten
Ultradünne Materialien, die nur aus einer oder wenigen Atomlagen bestehen, sind in der Materialwissenschaft derzeit ein blühendes Hoffnungsgebiet. Begonnen hat es mit Graphen, das aus einer einzelnen Lage von Kohlenstoff-Atomen besteht. Wie auch zahlreiche andere Forschungsgruppen auf der Welt hat auch der Elektrotechniker Thomas Müller und sein Team am Institut für Photonik der TU Wien durch die Arbeit mit Graphen herausgefunden, wie man mit ultradünnen Schichten umgeht, sie bearbeitet und verbessert. Dieses Wissen lässt sich nun auch auf andere Materialien übertragen.
„Solche zweidimensionalen Kristalle haben oft völlig andere elektronische Eigenschaften als eine dickere, dreidimensionale Version desselben Materials“, erklärt Thomas Müller. Seinem Team gelang es ihm nun erstmals, zwei verschiedene ultradünne Halbleiterschichten aneinanderzufügen und ihre Eigenschaften zu untersuchen.
Zwei Schichten mit unterschiedlichen Aufgaben
Wolframdiselenid ist ein Halbleiter, der aus drei Atomschichten besteht. In der Mitte befindet sich eine Lage von Wolfram-Atomen, die oberhalb und unterhalb der Schicht durch Selen-Atome verbunden sind. „Dass Wolframdiselenid geeignet ist, elektrischen Strom aus Licht zu erzeugen, konnten wir bereits vor einigen Monaten zeigen“, sagt Thomas Müller. Allerdings müsste man beim Bau einer Solarzelle aus reinem Wolframdiselenid in Mikrometer-engen Abständen winzige Elektroden in das Material einbauen. Durch die Kombination mit einem weiteren Material (Molybdändisulfid, das ebenso aus drei Atomlagen besteht) ist das nun nicht mehr nötig. Somit lässt sich das Schichtsystem als großflächige Solarzelle einsetzen.
Wenn Licht auf ein photoaktives Material fällt, dann werden einzelne Elektronen von ihrem Platz gelöst. Übrig bleibt ein bewegliches Elektron und ein Loch an der Stelle, wo sich das Elektron vorher befunden hat. Sowohl das Elektron als auch das Loch kann im Material herumwandern, zum Stromfluss können beide allerdings nur dann beitragen, wenn sie voneinander getrennt werden, sodass sie sich nicht wieder miteinander vereinen.
Um diese Rekombination von negativ geladenen Elektronen mit positiv geladenen Löchern zu verhindern, kann man entweder Elektroden verwenden, über die man die Ladungsträger absaugt, oder man benutzt dafür eine zweite Materialschicht. „Die Löcher bewegen sich im Wolframdiselenid, die Elektronen hingegen wandern über das Molybdändisulfid ab“, sagt Thomas Müller. Damit ist die Rekombinations-Gefahr gebannt.
Um diesen Effekt zu ermöglichen, müssen die Energien der Elektronen in den beiden Schichten optimal angeglichen werden, was im Experiment durch ein elektrostatisches Feld geschieht. Florian Libisch und Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien konnten mit Computersimulationen berechnen, wie sich die Energie der Elektronen in den beiden Materialien ändert und bei welchen Spannungen eine optimale Ausbeute an elektrischer Leistung zu erwarten ist.
Atom an Atom: enger Kontakt durch Hitze
„Eine der größten technischen Herausforderungen war es, die beiden Materialien atomar flach aufeinander aufzubringen“, sagt Thomas Müller. „Wenn sich zwischen den beiden Schichten noch andere Moleküle verstecken, sodass kein direkter Kontakt gegeben ist, dann funktioniert die Solarzelle nicht.“ Gelungen ist dieses Kunststück schließlich, indem man beide Schichten zunächst in Vakuum ausheizte und dann in gewöhnlicher Atmosphäre zusammenfügte. Wasser zwischen den beiden Lagen konnte durch nochmaliges Ausheizen aus dem Schichtsystem entfernt werden.
Das neue Material lässt einen großen Teil des Lichts durch, der absorbierte Anteil wird in elektrische Energie umgewandelt. Man könnte es etwa auf Glasfassaden einsetzen, wo es Licht durchlassen und trotzdem Strom erzeugen würde. Weil es nur aus wenigen Atomlagen besteht, ist das Material extrem leicht (300 m2 des Films wiegen etwa ein Gramm) und sehr flexibel. Um eine höhere Energieausbeute auf Kosten reduzierter Transparenz zu erreichen arbeitet das Team gegenwärtig daran, mehr als zwei Schichten aufeinander zu stapeln.
Die Arbeit ist nun im Fachjournal „Nano Letters“ erschienen: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl501962c?
Frei zugängliche arxiv-Version: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1403/1403.2652.pdf
Rückfragehinweis:
Prof. Joachim Burgdörfer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
burg@concord.itp.tuwien.ac.at
Prof. Thomas Müller
Institut für Photonik
Technische Universität Wien
thomas.mueller@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Zwei TU-Forscher im Direktorium der Jungen ÖAW-Kurie
Mit Thorsten Schumm und Daniel Grumiller ist die TU Wien im fünfköpfigen Direktorium der Jungen Kurie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften nun doppelt vertreten.
Thorsten Schumm, Daniel Grumiller (v.l.n.r.)
Neben der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse und der philosophisch-historischen Klasse ist die Junge Kurie die dritte Säule der österreichsichen Akademie der Wissenschaften. Ihre Aufgabe ist es, sich mit aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen zu beschäftigen, insbesondere mit solchen, die den wissenschaftlichen Nachwuchs betreffen. Die Junge Kurie hat 70 Mitglieder und wird von einem fünfköpfigen Direktorium geleitet. Thorsten Schumm vom Atominstitut und Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik wurden nun in das Direktorium gewählt.
Präzisionsuhren und das Universum
Thorsten Schumm beschäftigt sich in erster Linie mit Atom- und Kernphysik. So untersucht er etwa Anregungszustände von Thoriumkernen mit extrem niedriger Energie. Gelingt es, sie technologisch nutzbar zu machen, könnte man sie für Hochpräzisionsmessungen benutzen, etwa für Kern-Uhren, die noch deutlich präziser wären als Atom-Uhren. Thorsten Schumm ist START- und ERC-Preisträger.
Daniel Grumiller forscht an der Schnittstelle zwischen Quantenphysik, Gravitationsphysik und Kosmologie. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Physik Schwarzer Löcher und mit holographischen Beziehungen zwischen Gravitation und Teilchenphysik. Grumiller wurde mit einem europäischen Marie-Curie-Fellowship sowie mit dem START-Preis ausgezeichnet.
Webtipps:
http://www.thorium.at
http://quark.itp.tuwien.ac.at/~grumil/research.shtml
Neue Theorie ermöglicht Blick ins Innere der Erde
Unter extremem Druck kann es zu Phasenübergängen kommen, die sich mit herkömmlichen Methoden nicht berechnen lassen. Durch eine neue Theorie, entwickelt an der TU Wien und der Universität Wien, wird eine genauere Analyse seismischer Wellen und ein Einblick in die innersten Eigenschaften unserer Erde möglich.
In der Erde herrscht gewaltiger Druck - die Phasenübergänge, die sich dadurch ergeben, können nun endlich berechnet werden.
Computerberechnung der Valenzelektronendichte in Strontiumtitanat. Inset: Die Perovskit-Struktur
Oben: Andreas Tröster, Wilfried Schranz; unten: Peter Blaha, Ferenc Karsai (jeweils v.l.n.r)
Ins Innere unseres Planeten zu gelangen ist eine schwierige Aufgabe – das hat schon Jules Verne in seinem berühmten Roman "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" beschrieben. Auch heute noch können wir nur indirekt durch seismische Messungen Information über Struktur und Zusammensetzung der Erde gewinnen. Um solche Daten allerdings richtig interpretieren zu können, braucht man eine exakte Beschreibung der Materialien im Erdinneren. Einem Team von Wissenschaftlern der TU Wien und der Universität Wien unter Führung des theoretischen Physikers Andreas Tröster (TU Wien) gelang es nun mit Hilfe quantenphysikalischer Berechnungen, bestimmte Phasenübergänge, wie sie bei hohem Druck im Erdinneren stattfinden, mit bisher noch nie dagewesener Präzision zu beschreiben. Die neue Theorie wurde nun im Fachjournal „Physical Review X“ publiziert.
Hochdruckphasenübergänge geben Einblick ins Erdinnere
Das Innere unserer Erde ist bis heute noch nicht vollständig erforscht. Bekannt ist, dass rund 60 Prozent der Erde aus siliziumhaltigen Materialien – sogenannten Perowskit-Strukturen – bestehen, der mächtige untere Mantel sogar zu 93 Prozent. Diese Mineralien sind in der Erde einem enorm großen Druck ausgesetzt. Der im Zentrum herrschende Druck von 360 Giga-Pascal entspricht einem Gewicht von zehn Millionen Elefanten auf einer Fläche von einem Quadratmeter. "Dadurch kann es unter bestimmten Bedingungen zu Hochdruckphasenübergängen kommen, bei denen sich die innere Struktur der Mineralien ändert" erklärt Trösters einstiger Doktorvater, der Materialphysiker Wilfried Schranz von der Arbeitsgruppe "Physik Funktioneller Materialien" der Universität Wien.
Die Struktur des Erdkörpers wird untersucht, indem man seismische Wellen analysiert. Ihr Ausbreitungsverhalten wird durch die elastischen Eigenschaften der Materialien im Erdinneren festgelegt. "Diese elastischen Eigenschaften können sich in der Nähe von strukturellen Phasenübergängen als Funktion von Druck und Temperatur stark ändern", erklärt Schranz. „Bis heute gibt es aber leider keinen veröffentlichten experimentellen Datensatz zu den elastischen Eigenschaften der Materialien im Erdmantel bei realistischen Druck- und Temperaturbedingungen, geschweige denn von Materialien im tiefen Erdinneren." Man ist daher auf Berechnungen angewiesen.
Eine Erweiterung der Landau-Theorie
„Quantenmechanische ab-initio-Computersimulationen erlauben zwar die Berechnung von elastischen Eigenschaften von Materialien bis zu extremen Drücken, die Einbeziehung von Temperatureffekten ist dabei aber nur beschränkt möglich“, erklärt der theoretische Chemiker Peter Blaha. Phasenübergänge in Kristallen werden seit vielen Jahren mit Hilfe der „Landau-Theorie“ beschrieben. Sie erweist sich bei Drücken, mit denen wir normalerweise zu tun haben, als äußerst nützlich. „Bei hohem Druck kommt es aber zwangsläufig zu nichtlinearen Effekten, die man in der bisherigen Landau-Theorie vernachlässigen muss“, sagt Andreas Tröster. Das bedeutet zwar mathematisch eine enorme Vereinfachung, kann aber rasch zu Fehlern von sage und schreibe 100 Prozent führen. Einige Vorhersagen von Materialeigenschaften bei hohem Druck, die mit den bisher verwendeten Methoden berechneten wurden, müssen daher vermutlich auch einer gründlichen Revision unterzogen werden.
Lange wurde daher nach einer mathematisch konsistenten Erweiterung der Landau-Theorie auf Hochdruckphasenübergänge gesucht. „Uns gelang das nun mit Hilfe von Gruppentheorie, nichtlinearer Elastizitätstheorie und quantenmechanischen Dichtefunktionalberechnungen am Computer“, erklärt Tröster: „In dieser lange gesuchten Erweiterung der Landau-Theorie wird erstmals auch der bei hohen Drücken entscheidende nichtlineare Beitrag zur elastische Energie eines Kristalls mathematisch konsistent berücksichtigt.“
Um die neue Theorie zu testen, wandte man sie auf Strontiumtitanat an, einen Perowskit, dessen Eigenschaften bereits gut bekannt sind. „Anhand dieses Schlüssel-Materials konnten wir demonstrieren, dass unsere Theorie exzellent mit den gemessenen Daten übereinstimmt“, sagt Wilfried Schranz. Das zeigt, welch hohe Qualität bei der Beschreibung von Hochdruckphasenübergängen mit Hilfe von quantenmechanischen Dichtefunktionalberechnungen erreicht werden kann. „In Zukunft werden wir durch ein enges Zusammenspiel von experimenteller Arbeit, Computersimulationen und analytischer Theorie die gewonnenen Daten in große geophysikalische bzw. seismologische Modelle integrieren können. Damit werden wir zu einem immer besseren Verständnis des Aufbaus und der Eigenschaften unserer Erde gelangen", freut sich Andreas Tröster.
Publikation in "Physical Review X":
Andreas Tröster, Wilfried Schranz, Ferenc Karsai and Peter Blaha: "Fully consistent finite-strain Landau theory for high-pressure phase transitions", Phys. Rev. X (2014):
http://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.031010
PRX-Editorial dazu:
http://journals.aps.org/prx/edannounce/PhysRevX.4.030001
Rückfragehinweis:
Dr. Andreas Tröster
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
andreas.troester@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Der Computer kann auch nicht alles
Um Materialeigenschaften Atom für Atom verstehen zu können, braucht man nicht bloß Rechenpower, sondern auch neue kreative Ideen. Egal wie leistungsfähig ein Computer ist – in der Wissenschaft ist er niemals gut genug.
Der gelbe Bereich der Oberfläche hat einen stärkeren Einfluss auf das herannahende Molekül (blau), und muss anders in die Rechnung einbezogen werden als der Rest der Oberfläche (grau).
Florian Libisch
Wenn man mit einem neuen, schnelleren Modell nämlich endlich die Rechnungen durchführen kann, an denen das Vorgängermodell gescheitert ist, hat man sofort die nächste Idee für eine noch komplexere Rechnung. Besonders ausgeprägt ist dieses Problem in der Materialwissenschaft auf quantenmechanischem Niveau. Manche Rechenaufgaben kann man allerdings lösen, indem man nicht einfach immer mehr Rechenpower anwendet, sondern stattdessen die vorhandenen Ansätze klug verknüpft.
30 Atome sind ziemlich viel
Als Erwin Schrödinger 1926 mit Hilfe seiner berühmten Schrödingergleichung erstmals quantenphysikalische Berechnungen veröffentlichte, betrachtete er ein denkbar einfaches System: ein einzelnes Wasserstoffatom. Doch man möchte natürlich auch andere, kompliziertere Objekte quantenphysikalisch studieren. Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit oder Festigkeit eines Materials können auf atomarer Ebene verstanden, erklärt und auch verbessert werden – dafür ist es unerlässlich, eine große Anzahl von Atomen gleichzeitig am Computer zu simulieren.
"Solche Rechnungen werden sehr schnell ungeheuer aufwändig", erklärt Florian Libisch vom Institut für theoretische Physik. "Wo die Grenzen des Möglichen liegen, hängt von der ausgewählten Methode ab, aber in vielen Fällen ist man heute schon sehr zufrieden, wenn man 30 Atome exakt berechnen kann."
Doch eine Hand voll Atomen bildet noch kein Objekt mit makroskopischen Eigenschaften. Es kann sein, dass sich ein solcher Mini-Cluster völlig anders benimmt, als eine ausgedehnte Fläche desselben Materials. Wichtig ist das beispielsweise, wenn man Katalysatoren verstehen möchte: Einzelne Moleküle treffen etwa auf ein Metalloberfläche, die einen ganz bestimmten Effekt auf das eintreffende Molekül hat. Einige wenige Metall-Moleküle hätten eine ganz andere Wirkung als eine ausgedehnte Metalloberfläche.
1998 wurde der Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung quantenchemischer Berechnungsmethoden vergeben, die es ermöglichen, der Chemie auf Quantenebene auf die Spur zu kommen. Heute steht ein bunter Baukasten aus verschiedenen Rechenmethoden zur Verfügung, die von unterschiedlichen Näherungsannahmen ausgehen. Man braucht viel Wissen und Erfahrung, um zu entscheiden, welche Methode für ein bestimmtes Problem die richtige ist. Bei komplizierten Problemen kann es allerdings sein, dass keine einzelne Methode zum Ziel führt. Dann ist es am besten, verschiedene Bausteine zu etwas ganz Neuem zusammenzusetzen. Florian Libisch entwickelt mathematische Verfahren, um vorhandene Theorie-Bausteine zu neuen Methoden zusammenzufügen und dadurch Rechnungen zu ermöglichen, die man mit keiner einzelnen Methode durchführen könnte.
Zerlegen und zusammenfügen
So gelang es Florian Libisch etwa, das Verhalten eines Sauerstoffmoleküls zu berechnen, das sich einer Aluminiumoberfläche nähert. "Wir teilen die Aluminiumoberfläche auf in ein kleines Stück, das den stärksten Einfluss auf das Sauerstoffmolekül hat, und einen großen Rest", erklärt Libisch. "Für das kleinere Stück verwenden wir eine sehr genaue und sehr aufwendige Methode, für den großen Rest eine einfachere." Die genaue Methode ist zu aufwendig um das ganze System zu behandeln. Es reicht aber auch nicht, nur die einfachere Methode anzuwenden, weil dann die Resultate nicht zum Experiment passen. Erst durch die Kombination der beiden Methoden erhält man Ergebnisse, die auch zu entsprechenden Messungen passen.
Solche Vorgangsweisen sind nicht bloß eine zeitlich befristete Hilfsmaßnahme, die man heute ergreift, bis noch bessere Computer zur Verfügung stehen. Bei vielen Methoden steigt der Rechenaufwand exponentiell mit der Anzahl der beteiligten Teilchen an. Auch wenn sich die Fähigkeiten moderner Computer rasant weiterentwickeln, werden sie mit der Simulation großer Objekte auf Quantenniveau immer überfordert sein. Kreative Näherungsmethoden, wie man sie an der TU Wien entwickelt, werden also auch in Zukunft eine große Bedeutung haben.
Im Fokus der TU-Forschungsschwerpunkte
Die Untersuchung von Materialien mit quantenphysikalischen Computermethoden steht am Schnittpunkt von gleich drei Forschungsschwerpunkten der TU Wien: "Quantum Physics and Quantum Technologies", "Computational Science and Engineering" und "Materials and Matter". An der Verbindung unterschiedlicher Rechenmethoden arbeitete Florian Libisch intensiv während eines zweijährigen Forschungsaufenthaltes an der US-amerikanischen Princeton University. Danach kehrte er nach Wien zurück. Mit dem Know-How aus den USA fühlt er sich nun an der TU Wien am richtigen Platz: "Es gibt hier viele Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen, sowohl auf theoretischer Seite als auch experimentell. Das hilft natürlich sehr und ermöglicht spannende Kooperationen."
Florian Libisch wurde kürzlich eingeladen, über das Zusammenfügen verschiedener Rechentechniken ("Embedding-Verfahren") einen Review-Artikel für das Fachjournal "Accounts of Chemical Research" zu schreiben. Der Artikel ist nun erschienen.
Originalpublikation:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ar500086h
Rückfragehinweis:
Dr. Florian Libisch
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-13608
florian.libisch@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Laserphysik auf den Kopf gestellt
Ein System aus gekoppelten Lasern wurde an der TU Wien hergestellt, das sich völlig paradox verhält: Bei verstärkter Energiezufuhr schaltet sich das Laserlicht aus und bei weniger Energie schaltet es sich ein.
Simulation der Lasermoden, die in diesem System angeregt werden.
Elektronenmikroskopische Aufnahme der gekoppelten Quantenkaskadenlaser. Durch die beiden Drähte wird den Lasern die nötige Energie zugeführt.
Stefan Rotter (Theoretische Physik), Martin Brandstetter (Photonik), Matthias Liertzer (Theoretische Physik), Christoph Deutsch (Photonik), Joachim Schöberl (Mathematik), Karl Unterrainer (Photonik) (v.l.n.r)
Schallwellen verhallen, Wasserwellen verebben, ein Lichtstrahl wird von einer Wand verschluckt. Dass Wellen absorbiert werden ist ein ganz alltägliches Phänomen. Trotzdem erkannte die Physik erst in den letzten Jahren, welche neuen Möglichkeiten sich ergeben, wenn man diesen Verlust von Energie nicht als lästiges Ärgernis, sondern als erwünschten Effekt betrachtet. An der TU Wien wurde nun ein System aus zwei gekoppelten Lasern hergestellt, bei dem die Balance aus Energiezufuhr und Verlust zu einem paradoxen Verhalten führt: Zusätzliche Energie kann den Laser ausschalten, oder eine Reduktion der Energie den Laser einschalten. Auf diese Weise könnte man logische Schaltungen bauen, die mit Licht funktionieren. Im Fachjournal „Nature Communications“ wurde das entsprechende Experiment nun präsentiert.
Gewöhnliche Laser und paradoxe Laser
„Normalerweise hängt die Lichtintensität eines Lasers auf recht einfache Weise von der Energie ab, die man hineinsteckt“, sagt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Führt man zu wenig Energie zu, geschieht gar nichts. Überschreitet man eine kritische Schwelle, beginnt der Laser zu leuchten, und je mehr Energie man zuführt, umso stärker leuchtet er.“
Doch es geht auch anders. Zwei mikroskopisch kleine kreisförmige Laser wurden an der TU Wien miteinander gekoppelt, sodass ein Gesamtsystem entsteht, in dem die komplizierte Balance von Energiezufuhr und Energieverlust erstaunliche physikalische Effekte hervorruft: Zwei Laser, die sonst leuchten würden, schalten sich gegenseitig aus, wenn man sie koppelt. Mehr Energie führt dann nicht zu mehr Licht, sondern zu völliger Dunkelheit. Umgekehrt kann auch eine Reduktion der Energiezufuhr dazu führen, dass plötzlich das Licht angeht.
„Zunächst stießen wir in einer Computersimulation auf diesen Effekt, und waren ziemlich verblüfft von unseren Ergebnissen“, erzählt Stefan Rotter. Nun ist es gelungen, das vor zwei Jahren vorhergesagte Phänomen experimentell zu bestätigen – in einem Gemeinschaftsprojekt zwischen den Fachrichtungen Physik, Elektrotechnik und Mathematik der TU-Wien und der Universität Princeton (USA). Für das Experiment wurden sogenannte Terahertz-Quantenkaskadenlaser mit einem Durchmesser von weniger als einem Zehntelmillimeter verwendet. „Diese Mikro-Laser sind für solche Experimente besonders gut geeignet, weil ihre optischen Eigenschaften genau angepasst werden können und ihre Wellenlänge recht groß ist“, sagt Martin Brandstetter vom Institut für Photonik der TU-Wien. Dadurch gelangt die Lichtwelle leicht von einem Laser in den anderen.
Gewünschte Imperfektion
Die Absorption von Wellen wird in der Physik meist als unerwünschter Nebeneffekt betrachtet. „Man geht bei theoretischen Berechnungen meist vom perfekten Fall aus, in dem es keine Dissipation gibt“, erklärt Rotter. Es rechnet sich einfach leichter mit Spiegeln, die 100% des Lichtes reflektieren, mit Lichtleitungen, die 100% des Lichts leiten, oder mit Schallwellen, die bei ihrer Ausbreitung keine Energie verlieren. Doch Perfektion ist manchmal einfach langweilig – die interessanten Kopplungseffekte der beiden Laser werden nur sichtbar, wenn man auf ihnen eine speziell absorbierende Metallschicht anbringt, die einen Teil des Lichts absorbiert. Für das paradoxe Verhalten der Laser ist ein kompliziertes mathematisches Phänomen verantwortlich: Das Auftreten sogenannter „Ausnahmepunkte“ – spezielle Schnittpunkte von Flächen in komplexen Räumen, die bei der Berechnung der Zustände des Laser-Systems auftreten. Immer wenn die mathematischen Gleichungen solche Ausnahmepunkte hervorbringen, treten physikalisch recht merkwürdige Phänomene auf.
Solche Kopplungen von Lasern könnten zu neuen elektro-optischen Schaltungen führen. Ähnlich wie heute elektronische Bauteile Input-Signale zu einem Output-Signal verarbeiten, könnte man das auch mit optischen Bauteilen tun. Gekoppelte Mikro-Laser wären dafür ideal: Sie sind leicht auf einem kleinen Chip unterzubringen, und wie sich nun zeigt, bieten sie ein breites Repertoire an nicht-trivialen Schaltungsmöglichkeiten.
Originalpublikation in Nature Communications:
http://www.nature.com/ncomms/2014/140613/ncomms5034/full/ncomms5034.html
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-13618
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
T: +43-1-58801-41027
florian.aigner@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Mit Neutronen auf der Suche nach der Dunklen Energie
Nicht nur am großen Teilchenbeschleuniger, sondern auch am Labortisch macht man sich heute auf die Suche nach neuen Teilchensorten: Die Gravitations-Resonanz-Methode, entwickelt an der TU Wien, erweitert den Gültigkeitsbereich der Newton’schen Gravitationstheorie und schränkt Parameterbereiche für hypothetische Teilchen hunderttausendfach stärker ein als bisher.
Neutronen zwischen parallelen Platten geben Aufschluss über mögliche Kräfte im Universum.
Das Gravitations-Resonanz-Spektrometer an der TU Wien
Alle Teilchen, die wir heute kennen, machen nur fünf Prozent der Masse und Energie im Universum aus. Der große Rest – die „Dunkle Energie“ und die „Dunkle Materie“ – bleibt bis heute mysteriös. Ein Team der TU Wien führte gemeinsam mit dem ILL (Institut Laue-Langevin, Grenoble) hochsensitive Untersuchungen von Gravitations-Effekten auf winzigen Abständen durch. Damit lässt sich nun der Bereich, in dem man neue Teilchensorten oder zusätzliche Naturkräfte vermuten könnte, hunderttausend mal stärker einschränken als bisher.
Unentdeckte Teilchensorten?
Die Dunkle Materie kann man zwar nicht sehen, sie wirkt aber durch ihre Gravitationskraft auf die bekannte Materie ein, etwa auf die Rotation von Galaxien. Die dunkle Energie hingegen ist dafür verantwortlich, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt.
Dunkle Energie kann man mit einer zusätzlichen physikalischen Größe beschreiben, mit Albert Einsteins Kosmologischer Konstante. Eine Alternative dazu sind sogenannte Quintessenz-Theorien: „Vielleicht ist der leere Raum gar nicht leer, sondern erfüllt von einem bisher unbekannten Feld, vergleichbar mit dem Higgs-Feld“, sagt Prof. Hartmut Abele vom Atominstitut der TU Wien. Benannt wurden diese Theorien nach der von Aristoteles postulierten Quintessenz, einem hypothetischen fünften Element neben den vier antiken Urstoffen.
Als "Chamäleon-Felder" werden bestimmte hypothetische physikalische Felder bezeichnet, nach denen nun gesucht wird.
Andersartige Teilchensorten und zusätzlichen Naturkräfte müssten sich allerdings auch in Experimenten auf der Erde nachweisen lassen. Tobias Jenke und Hartmut Abele von der TU Wien entwickelten ein extrem sensitives Instrument, mit dem an der Neutronenquelle des ILL in Grenoble die Gravitationskraft vermessen werden konnte. Neutronen sind dafür optimal geeignet: Sie sind elektrisch neutral und kaum polarisierbar. Auf sie kann im Experiment bloß die Gravitation wirken – und allenfalls auch neue, bisher unbekannte Zusatzkräfte. Umfangreiche theoretische Berechnungen zum Verhalten der Neutronen wurden von Larisa Chizhova, Prof. Stefan Rotter und Prof. Joachim Burgdörfer vom Institut für theoretische Physik der TU Wien durchgeführt. U. Schmidt von der Universität Heidelberg und T. Lauer von der TU München steuerten zur Polarisationsanalyse bei.
Kräfte zwischen zwei Platten
Die Neutronen werden abgekühlt und zwischen zwei parallelen Platten hindurchgeschickt. Nach den Gesetzen der Quantenphysik kann sich das Neutron dabei nur in ganz bestimmten Zuständen mit ganz bestimmten Energien befinden, die von der Stärke der Kraft abhängt, die von der Gravitation auf das Teilchen ausgeübt wird. Indem man die untere Platte vibrieren lässt, kann man die Neutronen zwischen den Zuständen hin und her wechseln lassen. So lassen sich die Abstände der Energieniveaus vermessen.
„Das Experiment ist ein wichtiger Schritt zur Modellierung gravitativer Wechselwirkungen bei sehr kleinen Distanzen. Die Neutronen am ILL und die Messinstrumente aus Wien bilden zusammen das beste Werkzeug, um nach winzigen Abweichungen von der Newton‘schen Gravitationstheorie zu suchen, die von manchen Theorien vorhergesagt werden“, sagt Peter Geltenbort vom ILL Grenoble.
Wie leicht eine solche Abweichung aufzufinden ist, hängt von verschiedenen Parametern ab – zum Beispiel von der Stärke der Kopplung eines hypothetischen neuartigen Feldes an die bekannte Materie. Bestimmte Wertebereiche für diese Parameter gelten längst als ausgeschlossen: Gäbe es eine „Quintessenz“ mit solchen Kopplungsstärken, hätte man sie bereits in anderen Präzisions-Experimenten finden müssen. Doch noch immer blieb ein großer „erlaubter“ Parameterbereich, in dem sich neue physikalische Phänomene verstecken könnten.
Hunderttausend mal besser als bisher
Mit der Neutronen-Methode lassen sich nun allerdings Theorien in diesem Bereich testen: „Bisher konnten wir bei unseren Messungen keine Abweichungen zum bekannten Newton’schen Gravitationsgesetz finden“, sagt Hartmut Abele. „Dadurch können wir nun einen weiten Bereich von Parametern ausschließen.“ Die Messergebnisse legen nun ein Limit für den Kopplungsparameter fest, das hunderttausendmal unterhalb der Grenzen liegt, die sich aus anderen Messmethoden ergaben.
Auch wenn sich auf diese Weise bestimmte hypothetische Teilchen ausschließen lassen ist es freilich noch immer möglich, dass sich unterhalb dieser verbesserten Nachweisgrenze neuartige Physik versteckt. Die Gravitations-Resonanz-Methode soll daher nun noch weiterentwickelt werden. Einige Größenordnungen an Genauigkeits-Verbesserung scheinen noch möglich. Wenn sich auch dann keine Hinweise auf Abweichungen von den bekannten Kräften ergeben, könnte Albert Einstein schließlich noch Recht behalten: Seine Kosmologische Konstante erscheint dann immer plausibler.
arxiv-Version des Papers:
http://arxiv.org/abs/1404.4099
Rückfragehinweise:
Dr. Larisa Chizhova
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
larisa@dollywood.itp.tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Alle Bilder: Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Teilchenmuster, erzeugt durch Oberflächenladung
Aus Unordnung entsteht Ordnung: An der TU Wien konnte gezeigt werden, wie erstaunlich einfach wohlstrukturierte Teilchenmuster entstehen können.
Regelmäßige Strukturen, wie in einem Kristall
Unregelmäßigere Strukturen, mit unterschiedlich großen, ineinander verwobenen Ringen.
Emanuela Bianchi
Winzige Nanostrukturen zu erzeugen hat sich als extrem schwierig herausgestellt – doch was geschieht, wenn man sich kleine Teilchen ganz von selbst zur gewünschten Struktur zusammenbauen? An der TU Wien wird das Phänomen einer derartigen Selbstorganisation anhand von Partikeln untersucht, deren Oberfläche eine ungleichmäßig verteilte elektrische Ladung trägt. Abhängig von verschiedenen externen Parametern können diese Partikel ungeordnete, gel-artige oder kristallähnliche Strukturen bilden. Für die Nanotechnologie sind solche, von außen induzierte Selbstorganisations-Effekte ganz entscheidend.
Mikro-Partikel mit ganz besonderer Oberfläche
Die Partikel, die Emanuela Bianchi im Team von Prof. Gerhard Kahl (Institut für Theoretische Physik, TU Wien) und in Zusammenarbeit mit Prof. Christos N. Likos (Universität Wien) in ihren Computersimulationen analysiert, sind höchstens einige Mikrometer groß, vergleichbar mit Viren oder kleinen Bakterien. Besonders interessant sind solche Nano-Partikel, wenn sie an ihrer Oberfläche verschiedene Regionen mit unterschiedlichen Wechselwirkungseigenschaften aufweisen.
In einem Forschungsprojekt (das im Rahmen eines Elise Richter Stipendiums des FWF gefördert wird) wurden nun Partikel untersucht, deren elektrische Ladung an der Oberfläche ungleich verteilt ist (siehe Abbildung 1): Der Großteil des Partikels ist negativ geladen, an den Polen oben und unten sind allerdings Bereiche mit positiver Ladung zu finden. „Nachdem die Pol-Bereiche alle gleich geladen sind, stoßen sie einander ab“, sagt Emanuela Bianchi. „Bringt man zwei solche Teilchen in Kontakt, dann richten sie sich so aus, dass der Pol des einen Partikels genau zum Äquator des anderen Partikels zeigt.“ Wenn allerdings viele solche Partikel miteinander wechselwirken, wird die Sache komplizierter.
In Computersimulationen wurde untersucht, wie sich die Teilchen verhalten, wenn man sie zwischen zwei horizontalen Platten einsperrt, sodass sie dazwischen eine quasi zwei-dimensionale Struktur bilden können. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass ganz unterschiedliche Konfigurationen möglich sind: Manchmal fügen sich die Teilchen in sauber geordneten Flächenstücken zusammen und ergeben eine dichte, hexagonal gepackte Struktur, die man auch von Kristallen kennt. Manchmal hingegen entstehen ungeordnete, gel-artige Strukturen, die aus aneinanderhängenden Ringen aus fünf oder sechs Teilchen gebildet werden.
„Mit unserem Modell lässt sich untersuchen, wie die entstehenden Strukturen von den externen Parametern abhängen“, sagt Emanuela Bianchi. Ganz entscheidend ist dabei die Größe der positiv geladenen Polarregion der Partikel: Kügelchen, bei denen die Grenze zwischen negativer und positiver Ladung am 45. Breitengrad verläuft, ergeben deutlich besser geordnete planare Strukturen als solche, bei denen diese Grenze näher am Pol, beim 60. Breitengrad gezogen wird. Beeinflussen kann man das Ergebnis der Selbstorganisation auch dadurch, indem man die Bodenplatte, auf der die Teilchen zum Liegen kommen, elektrisch auflädt – ein Eingriff, der sich im Experiment ganz leicht umsetzen lässt.
Nanomaterialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften
Wenn man die Selbstorganisation von Mikropartikeln versteht, kann man die Teilchen so synthetisieren, dass sie sich in maßgeschneiderten makroskopische Strukturen selbstorganisieren. Je nach mikroskopischer Anordnung der Teilchen hat die aus ihnen entstehende Fläche eine unterschiedliche Dichte und reagiert somit unterschiedlich auf externe Einflüsse (wie etwa elektromagnetische Felder). Mit selbstorganisierenden Strukturen könnte man also beispielsweise Filter mit einstellbarer Porosität herstellen. „Gerade für biomedizinische Anwendungen gibt es hier viele Anwendungsmöglichkeiten“, sagt Emanuela Bianchi.
Die Forschungsergebnisse des Forschungsteams wurden im angesehenen Fachjournal „ACS Nano“ veröffentlicht:
Self-Assembly of Heterogeneously Charged Particles under Confinement:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nn401487m?prevSearch=%255BContrib%253A%2Bbianchi%255D
Rückfragehinweis:
Dr. Emanuela Bianchi
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
emanuela.bianchi@tuwien.ac.at
Aussender:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Motiv: Regelmäßige Strukturen, wie in einem Kristall
Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Motiv: Unregelmäßigere Strukturen, mit unterschiedlich großen, ineinander verwobenen Ringen.
Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Motiv: Emanuela Bianchi
Download (Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien)
Wenn das Licht im Verkehrsstau steckt
Dass wir durch ein Glas Milch nicht hindurchsehen können, liegt an der Lichtstreuung. Sie ist meist schwer zu berechnen, doch im Falle von besonders starker Streuung plötzlich verblüffend einfach, wie man an der TU Wien nun nachweisen konnte.
Aluminiumkugeln, in Styropor verpackt, in einer Kupferröhre:
So wird Wellenstreuung im Labor gemessen.
(Bild: University of Texas at San Antonio)
Komplizierte Wege:
Zwei verschiedene Licht-Zustände, die durch das Medium gelangen. Die Welle wird in Pfeilrichtung eingeschossen.
Warum ist Milch weiß und für uns undurchsichtig? Lichtwellen werden in Substanzen wie Milch zwischen unzähligen Tröpfchen immer wieder hin und her gestreut. Solche Wellen-Ausbreitungs-Phänomene spielen auch in der Technik eine sehr wichtige Rolle, zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik. Mit aufwändigen Computersimulationen und Mikrowellen-Experimenten gelangte man nun zu einem überraschenden Ergebnis: Wenn man Wellen durch immer komplexere Strukturen schickt, benehmen sie sich irgendwann ganz einfach und folgen einem einzigen, ganz bestimmten Streumuster. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „Nature Communications“ veröffentlicht.
Viele Wege führen durch die Stadt
Wie lange dauert es, von einem Ende einer Stadt zum anderen zu gelangen? Diese Frage hat keine eindeutige Antwort, denn das hängt vom Weg ab, den man wählt. Manche Verkehrsteilnehmer sind besonders schnell, manche quälen sich durch einen Verkehrsstau, wieder andere verirren sich und kommen gar nicht ans Ziel. „Mit Licht ist das so ähnlich“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Schickt man es durch ein kompliziertes, inhomogenes Material, dann kann es auf viele verschiedene Arten hindurch gelangen und im Medium viele verschiedene Streumuster einnehmen.“
Je größer die Stadt und je stärker der Verkehr, umso schwieriger wird es, einen Weg hindurch zu finden. Je dicker ein Material und je stärker die Lichtstreuung, umso geringer ist seine optische Durchlässigkeit. Das verblüffende Ergebnis der nun vorgelegten Arbeit zeigt sich, wenn man Wellen durch ein sehr dickes, rein zufällig strukturiertes Medium schickt, in dem die Wellen sehr stark gestreut werden: In diesem Fall gibt es nur noch eine einzige Variante, um durch das Medium zu gelangen. Anstatt das komplizierte Gesamtsystem mit seinen unzähligen inneren Wellenzuständen zu beschreiben, lässt es sich dann mit einem einzigen Streumuster vollständig charakterisieren. „Das ist als ob man zur Zeit des morgendlichen Verkehrsstaus eine riesige Stadt nur mehr auf einem einzigen Weg durchqueren kann“, so Rotter.
Mit modernen Computern alten Rätseln auf der Spur
Die theoretischen Überlegungen darüber gehen zurück bis in die Fünfzigerjahre, als der Physiker Philip W. Anderson solche Phänomene theoretisch untersuchte und 1977 dafür den Nobelpreis erhielt. Seine Theorie der Wellenausbreitung kann Lichtwellen genauso erklären wie Schall, und auch in der Quantenphysik, in der Teilchen als Welle beschrieben werden, treffen dieselben Überlegungen zu.
Lange Zeit war es aber nicht möglich, die hochkomplizierte Ausbreitung von Wellen in ungeordneten Medien adäquat zu berechnen. Doch mittlerweile kann man mit Hilfe von Großcomputern und klugen Berechnungsmethoden solchen Phänomenen mit großer Präzision auf die Spur kommen. Adrian Girschik, Florian Libisch und Stefan Rotter von der TU Wien entwickelten Computersimulationen, an der University of Texas in San Antonio wurden Experimente durchgeführt: Aluminiumkugeln wurden in Styropor gepackt, in eine Röhre gefüllt und dann mit Mikrowellen bestrahlt. Die Styropor-Hüllen dienen als Abstandhalter, sind jedoch für die Mikrowellen „unsichtbar“. Die Alukugeln bilden dadurch zufällig angeordnete Streu-Hindernisse für die Mikrowellenstrahlung, ähnlich wie Öltröpfchen in der Milch das sichtbare Licht ablenken.
Wie kompliziert die Wellenausbreitung ist, hängt von der Beschaffenheit des Mediums ab: „Man könnte erwarten, dass das System immer komplizierter wird, je länger die Röhre ist, und je mehr Aluminiumkugeln die Mikrowellen ablenken“, sagt Stefan Rotter. „Doch in Wirklichkeit zeigt sich: Ab einer gewissen Länge, ab einer gewissen Komplexität des Streusystems, spielt nur noch ein einziger Übertragungskanal eine Rolle.“ Am Ende der Röhre kommt dann immer dasselbe Wellenmuster heraus – nur ein einziger Wellen-Zustand gelangt durch das System, alle anderen werden bis zur Unsichtbarkeit abgedämpft.
Gemeinsam publizierten nun die Forschungsteams der TU Wien und der University of Texas ihre Ergebnisse im Fachjournal „Nature Communications“. Dass Untersuchungen von Wellenausbreitung durch ungeordnete Materialien auf so großes Interesse stoßen, ist kein Zufall: Solche Wellenphänomene sind in Wissenschaft und Technik allgegenwärtig. In der medizinischen Diagnostik, in der Geophysik, bei der Erzeugung von Laserstrahlung mit speziellen Zufallslasern – in vielen ganz unterschiedlichen Bereichen hat man es mit Wellenausbreitung zu tun, die von der Umgebung stark gestört wird. Diese Phänomene immer besser zu verstehen ist daher eine Aufgabe, die für viele verschiedene Bereiche relevant ist.
Link zur Originalpublikation:
The single-channel regime of transport through random media
http://staging-www.nature.com/ncomms/2014/140321/ncomms4488/full/ncomms4488.html
Rückfragehinweis:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Bildernachweis:
Aluminiumkugeln, in Styropor verpackt, in einer Kupferröhre:
So wird Wellenstreuung im Labor gemessen.
(Bild: University of Texas at San Antonio)
Abdruck honorarfrei, Copyright: University of Texas at San Antonio
Komplizierte Wege:
Zwei verschiedene Licht-Zustände, die durch das Medium gelangen. Die Welle wird in Pfeilrichtung eingeschossen.
Abdruck honorarfrei, Copyright: TU Wien
Kochrezept für ein Universum
Erhitzen und ein bisschen rühren: Ein expandierendes Universum kann auf erstaunlich einfache Weise entstehen, sagen Berechnungen an der TU Wien.
Kochrezept für ein Universum: Erhitzen und umrühren.
Daniel Grumiller erhitzt die Raumzeit - zumindest am Papier.
Der indische Physiker Arjun Bagchi (rechts) besucht derzeit die TU Wien und hat kürzlich ein Lise-Meitner Fellowship vom FWF erhalten, um in Zusammenarbeit mit Daniel Grumiller (links) die neuen holographischen Zusammenhänge in flachen Raumzeiten zu erforschen.
Wenn man Suppe erhitzt, beginnt sie zu kochen. Wenn man Raum und Zeit erhitzt, kann ein expandierendes Universum entstehen – ganz ohne Urknall. Diesen Phasenübergang zwischen einem langweiligen leeren Raum und einem expandierenden Universum, das Masse enthält, konnte ein Forschungsteam der TU Wien gemeinsam mit Kollegen aus Harvard, dem MIT und Edinburgh nun berechnen. Dahinter liegt ein bemerkenswerter Zusammenhang zwischen Quantenfeldtheorie und Einsteins Relativitätstheorie.
Kochen mit Raum und Zeit
Aus dem Alltag kennen wir Phasenübergänge nur von Stoffen, die zwischen festem, flüssigem und gasförmigem Zustand wechseln. Allerdings können auch Raum und Zeit selbst solche Übergänge durchmachen, wie die Physiker Steven Hawking und Don Page schon 1983 zeigten. Sie berechneten, dass aus leerem Raum bei einer bestimmten Temperatur plötzlich ein Schwarzes Loch werden kann.
Lässt sich bei einem ähnlichen Prozess aber auch ein ganzes Universum erzeugen, das sich kontinuierlich ausdehnt, so wie unseres? Diese Frage stellte sich Daniel Grumiller vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien gemeinsam mit Kollegen aus Harvard, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Universität Edinburgh. Das Ergebnis: Tatsächlich scheint es eine kritische Temperatur zu geben, bei der aus einem völlig leeren, flachen Raum ein expandierendes Universum mit Masse wird. „Die leere Raumzeit beginnt gewissermaßen zu kochen, es bilden sich Blasen, eine von ihnen expandiert und nimmt schließlich die gesamte Raumzeit ein“, erklärt Daniel Grumiller.
Das Universum muss dabei rotieren – das Kochrezept für ein expandierendes Universum lautet also: Erhitzen und umrühren. Diese Rotation kann allerdings beliebig gering sein. Bei den Berechnungen wurden vorerst nur zwei Raumdimensionen berücksichtigt. „Es gibt aber nichts, was dagegen spricht, dass es in drei Raumdimensionen genauso ist“, meint Grumiller.
Unser eigenes Universum ist allerdings wohl nicht auf diese Weise entstanden: Das Phasenübergangs-Modell ist nicht als Konkurrenz zur Urknalltheorie gedacht. „In der Kosmologie weiß man heute sehr viel über das frühe Universum – das zweifeln wir nicht an. Aber für uns ist die Frage entscheidend, welche Phasenübergänge in Raum und Zeit möglich sind und wie die mathematische Struktur der Raumzeit beschrieben werden kann“, sagt Grumiller.
Auf der Suche nach der Struktur des Universums
Die Theorie ist die logische Fortsetzung der sogenannten „AdS-CFT-Korrespondenz“, einer 1997 aufgestellten Vermutung, die seither die Forschung an den fundamentalen Fragen der Physik stark beeinflusst hat: Sie beschreibt einen merkwürdigen Zusammenhang zwischen Gravitationstheorien und Quantenfeldthorien – zwei Bereiche, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben müssten. In bestimmten Grenzfällen, so sagt die AdS-CFT-Korrespondenz, lassen sich Aussagen der Quantenfeldtheorie in Aussagen von Gravitationstheorien überführen und umgekehrt. Das klingt zunächst ähnlich merkwürdig, als würde man das Herunterfallen eines Steins studieren, indem man die Temperatur heißer Atome in einem Gas berechnet. Zwei ganz unterschiedliche physikalische Gebiete werden in Verbindung gebracht – aber es funktioniert.
Die Quantenfeldtheorie kommt dabei immer mit einer Dimension weniger aus als die dazugehörige Gravitationstheorie – das bezeichnet man als „holographisches Prinzip“. Ähnlich wie ein zweidimensionales Hologramm ein dreidimensionales Objekt darstellen kann, kann eine Quantenfeldtheorie mit zwei Raumdimensionen eine physikalische Situation in drei Raumdimensionen beschreiben.
Korrespondenz auch für flache Raumzeit
Die Gravitationstheorien müssen dafür allerdings in einer Raumzeit mit einer exotischen Geometrie definiert werden - in sogenannten „Anti-de-Sitter-Räumen“, deren Geometrie von der flachen Geometrie unserer Alltagserfahrung deutlich abweicht. Es wurde schon seit langem vermutet, dass es eine ähnliche Version dieses „holographischen Zusammenhangs“ auch für flache Raumzeiten geben könnte, aber es mangelte bisher an konkreten Modellen, die diesen Zusammenhang belegten.
Letztes Jahr wurde von Daniel Grumiller und Kollegen erstmals so ein Modell aufgestellt (der Einfachheit halber in bloß zwei Raumdimensionen). Das führte schließlich zur aktuellen Fragestellung: Dass es in den Quantenfeldtheorien einen Phasenübergang gibt, wusste man. Doch das bedeutete, dass es aus Konsistenzgründen auch auf der Gravitatations-Seite einen Phasenübergang geben muss.
„Das war zunächst ein Rätsel für uns“, sagt Daniel Grumiller. „Das würde einen Phasenübergang zwischen einer leeren Raumzeit und einem expandierenden Universum bedeuten, und das erschien uns zunächst äußerst unwahrscheinlich.“ Die Rechenergebnisse zeigten dann aber, dass genau diesen Übergang tatsächlich gibt. “Wir beginnen erst, diese Zusammenhänge zu verstehen“, meint Daniel Grumiller. Welche Erkenntnisse über unser eigenes Universum wir dadurch ableiten können, ist heute noch gar nicht absehbar.
Originalpublikation:
A. Bagchi, S. Detournay, D. Grumiller qnd Joan Simon, Phys. Rev. Lett. 111, 181301 (2013):
http://arxiv.org/abs/arXiv:1305.2919
siehe auch: A. Bagchi, S. Detournay and D. Grumiller, Phys. Rev. Lett. 109, 151301 (2012):
http://arxiv.org/abs/arXiv:1208.1658
Rückfragehinweis:
Dr. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
daniel.grumiller@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Award of Excellence an Dominik Steineder
BM Karlheinz Töchterle, Dominik Steineder
Als einer von vier AbsolventInnen des Doktoratsstudiums an der TU Wien wurde Dominik Steineder mit dem "Award of Excellence" ausgezeichnet.
Dominik Steineder hatte seine Doktorarbeit mit dem Titel "Holographic descriptions of anisotropic plasma" bei Prof. Anton Rebhan am Institut für Theoretische Physik im November 2012 abgeschlossen. Diese beinhaltet unter anderem neue Resultate zur Viskosität des Quark-Gluon-Plasma, die zeigten, dass die bislang vermutete untere Schranke für die Viskosität einer Quantenflüssigkeit durch Anisotropien unterboten werden kann, was in der internationalen Fachwelt auf großes Interesse stieß. (Siehe dazu die Pressemitteilung
http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7355/.)
Die Preisverleihung fand am 12. Dezember 2013 durch Dr. Karlheinz Töchterle im Palais Harrach statt (und war eine der letzten Amtshandlungen des Wissenschaftsministers Dr. Karlheinz Töchterle).
Rückfragehinweis:
Dr. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Logik und Teilchen
Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien wurden vom Wissenschaftsfonds FWF genehmigt: „Logik in der Informatik“ und „Teilchen und Wechselwirkungen“. Das bestehende Kolleg „Wasserwirtschaftliche Systeme“ wurde verlängert.
Logische Methoden in der Computerwissenschaft und Teilchenphysik: Zwei neue Doktoratskollegs an der TU Wien
Die TU Wien darf sich über zwei der fünf neuen Doktoratskollegs freuen, die nun vom österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert werden. Prof. Helmut Veith wird das Kolleg „Logical Methods in Computer Science“ leiten, Prof. Anton Rebhan das Kolleg „Particles and Interaction“. In den beiden Doktoratsprogrammen können insgesamt 25 junge Doktoratsstudierende angestellt werden. Zusätzlich wird eine größere Anzahl assoziierter Mitglieder von den neuen Kollegs profitieren.
Außerdem läuft das interdisziplinäre Doktoratsprogramm „Wasserwirtschaftliche Systeme“ weiter, das 2009 an der TU Wien unter der Leitung von Prof. Günter Blöschl gestartet wurde: Nach erfolgreicher Evaluierung wurde es nun verlängert. Verlängert wurde auch das Doktoratskolleg CoQuS ("Complex Quantum Systems"), an dem die TU Wien ebenfalls stark beteiligt ist.
“Particles and Interactions“: Ausrechnen, wie die Welt funktioniert
Auf die Suche nach den fundamentalen Gesetzen des Universums macht man sich im Doktoratskolleg „Teilchen und Wechselwirkungen“. „Das Forschungsgebiet steht heute an der Schwelle zu einer neuen Ära, mit bahnbrechenden Experimenten bei bisher unerreicht hohen Energien, bei hohen Dichten oder auch mit extrem hoher Präzision im Niedrigenergiebereich“, sagt Anton Rebhan.
Offene Fragen gibt es in der Physik noch genug: Wie können wir die Dunkle Materie oder den Ursprung der Masse verstehen? Wie lassen sich exotische Materiezustände erklären, wie sie Augenblicke nach dem Urknall auftraten, oder bei hochenergetischen Teilchenkollisionen zu beobachten sind? Was geht im Zentrum extrem dichter Sterne vor sich?
In den letzten Jahren gab es – nicht zuletzt durch die Experimente am CERN – große Fortschritte in diesem Forschungsbereich. Das Doktoratskolleg soll nun weitere Hinweise zu grundlegenden Problemen rund um die Vereinheitlichung der Grundkräfte, der Theorie der Quantengravitation und den fundamentalen Symmetrien der Natur liefern. Neben der TU Wien werden auch theoretische und experimentelle Forschungsgruppen der Universität Wien und der Akademie der Wissenschaften (Institut für Hochenergiephysik und Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik) eingebunden, um eine wienweite fruchtbare wissenschaftliche Umgebung für Doktoratsstudenten zu schaffen.
“Logical Methods in Computer Science“: Die Grundlagen für die Computerindustrie von morgen
Für die Softwaretechnik wird Logik in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Computer, die selbstständig argumentieren und urteilen können, werden in ganz verschiedenen Bereichen Einzug halten – etwa in der Medizin, in der Wirtschaft, aber auch in Alltagsanwendungen zu Hause.
„Ähnlich wie die Differential- und Integralrechnung völlig neue Möglichkeiten für die Physik und die Ingenieurswissenschaften eröffnet hat, ist die Logik eine Schlüsseldisziplin für neue Entwicklungen in den Computerwissenschaften“, meint Helmut Veith, der gemeinsam mit Stefan Szeider das Doktoratsprogramm leitet.
Durch das Vienna Center for Logic and Algorithms (VCLA) wurde in den vergangenen Jahren ein international sichtbares Kompetenzzentrum für Logik in der Informatik aufgebaut, das nun durch das Doktoratskolleg noch weiter gestärkt wird.
In drei Forschungsbereichen der Logik wurde in den letzten zwei Jahrzehnten an der TU Wien eine besonders gute internationale Sichtbarkeit erreicht, diese Bereiche werden auch im neuen Doktoratskolleg eine wichtige Rolle spielen: Erstens die Computationale Logik, ganz besonders Beweistheorie, Komplexitätstheorie und automatische Beweisführung, zweitens die Anwendung von Logik auf Datenbanken und künstliche Intelligenz, und drittens „Computer Aided Verification“ bzw. „Model Checking“, wo man mit Hilfe von Computerprogrammen Algorithmen auf Fehler untersucht.
Neben der Fakultät für Informatik der TU Wien sind auch die Fakultät für Mathematik und Geoinformation, die Universität Linz und die Technische Universität Graz mit je einer Doktorandenstelle im Doktoratskolleg vertreten. Die Zusammenarbeit mit Graz und Linz verstärkt die bestehenden Synergien im Nationalen Forschungsnetzwerk Rigorous Systems Engineering.
Verlängerung für Wasserwirtschafts-Projekt
Viele wissenschaftliche Erfolge brachte auch das Doktoratskolleg „Wasserwirtschaftliche Systeme“, geleitet von Prof. Günter Blöschl. Nach vier Jahren Laufzeit wurde das Kolleg nun evaluiert und darf in die nächste Runde gehen – es gehört zu den zehn laufenden Kollegs, die vom FWF verlängert werden.
Auch das Doktoratskolleg CoQuS wurde verlängert. In diesem Kolleg geht es um Quantentechnologie, Quantenoptik und Quanteninformation. Koordiniert wird es von der Unviersität Wien, aber auch hier ist die TU Wien stark vertreten.
Rückfragehinweis:
Dr. Anton Rebhan
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rebhana@tph.tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Videotipp: Phasenübergänge, visualisiert am Computer
Eine an der TU Wien entwickelte Simulationsmethode vereinfacht die Berechnung, ob ein Material bei bestimmten äußeren Bedingungen fest oder flüssig ist. Dieses Video erklärt, wie dieses Verfahren funktioniert.
Fest? Flüssig? Gasförmig? In vielen praktischen Anwendungen spielen Phasendiagramme eine ganz zentrale Rolle: Sie sind gewissermaßen Landkarten, die genau anzeigen, in welchem Aggregatszustand ein Material bei bestimmten äußeren Bedingungen vorliegt. So kann etwa eine Flüssigkeit erstarren, wenn man den Druck erhöht, oder aber auch, wenn man die Temperatur senkt. In einem Druck-Temperatur-Phasendiagramm kann man auf einen Blick sehen, wie die Grenzen zwischen fester und flüssiger Phase verlaufen.
Schmelzen und Erstarren am Computer
Diese Grenzen rechnerisch vorherzusagen ist allerdings schwierig. Man kann das Material am Computer simulieren, die Rechnung entweder im flüssigem oder im festen Zustand starten und hoffen, dass sich nach überschaubarer Zeit der tatsächliche Endzustand eingestellt hat. Man kann die Rechnung aber auch gleich mit einem Gemisch aus fester und flüssiger Phase beginnen und beobachten, ob sich im Laufe der Simulation der Festköper oder die Flüssigkeit über das Simulationsvolumen ausbreitet. All diese Methoden haben aber Nachteile: sie sind aufwändig und nicht unbedingt zuverlässig.
Die entscheidende thermodynamische Größe, die eindeutig Antwort darüber gibt, ob das Material bei bestimmten äußeren Parametern in fester oder flüssiger Form vorliegt, ist die Gibbs-Energie (auch freie Enthalpie). Der Zustand mit der niedrigeren Gibbs-Energie ist der stabile Endzustand. Auch bei chemischen Reaktionen spielt diese Größe eine wichtige Rolle: Die Gibbs-Energie ist ein Maß für die „Verfügbarkeit“ der Energie, die in einem System bei bestimmter Temperatur und bestimmtem Druck steckt. Wenn im Laufe einer chemischen Reaktion die Gibbs-Energie sinkt, dann läuft sie von selbst ab, hat aber der Endzustand eine höhere Gibbs-Energie als der Ausgangszustand, so muss von außen Energie zugeführt werden, um die Reaktion zu ermöglichen.
Neue Rechenmethode
Ulf Rørbæk Pedersen, „post-doc“ Miarbeiter am Institut für Theoretische Physik (gefördert im Rahmen des FWF-SFBs „ViCoM“) entwickelte eine neue Methode, die es erlaubt, den Unterschied in der Gibbs-Energie zwischen fester und flüssiger Phase sehr genau zu berechnen. Somit kann man eindeutig schließen, welche der beiden konkurrierenden Phasen die stabilere ist – ob sich also das Phasengleichgewicht eher zum festen oder eher zum flüssigen Zustand verschiebt, und zwar von selbst, also ohne Energiezufuhr von außen.
In diesem Video erklärt der Wissenschafter, wie die von ihm entwickelte „Interface-Pinning Method“ funktioniert: Er simuliert ein Gemisch aus einem geordneten Festkörper und einer Flüssigkeit und führt eine hypothetische Kraft ein, die bewirkt, dass die Mischung aus den beiden Aggretatszuständen bestehen bleibt. Diese Zusatzkraft, die nur als Rechengröße in der Computersimulation eingeführt wurde, sorgt also dafür, dass das Gemisch weder vollständig erstarren noch vollständig schmelzen kann. Aus der Stärke dieser Kraft lässt sich der Unterschied in der Gibbs-Energie der beiden konkurrierenden Phasen berechnen.
Video unter:
http://www.youtube.com/watch?v=YP_fyY-vGYc
Originalpublikation unter: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/139/10/10.1063/1.4818747
Rückfragehinweis:
Dr. Ulf Rørbæk Pedersen
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13651
ulf.pedersen@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
OePG-Studierendenpreis an Max Riegler
Max Riegler erhält den Studierendenpreis der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft für die beste Masterarbeit. Im Zuge dieser Arbeit hat Max Riegler sich damit auseinandergesetzt, wie man eine bestimmte Klasse von Theorien, welche Gravitation beschreiben, auf eine andere, äquivalente Weise, konsistent beschreiben kann.
Max Riegler (3. von links) und Richard Wollhofen (2. von links) erhalten den geteilten Preis der OePG für ihre Masterarbeiten
Max Riegler versucht in seiner Masterarbeit durch Anwendung des holographischen Prinzips ein besseres Verständnis von Gravitation in 2+1 Dimensionen zu gewinnen. Das „holographische Prinzip“ erlaubt uns, physikalische Beschreibungen von einer Theorie in eine andere, äquivalente Theorie zu übersetzen. Theorien beschreiben die Wirklichkeit oft nur in einem bestimmten Bereich einer Kenngröße exakt, in anderen Größenordnungen werden ihre Vorhersagen zu ungenau, bzw. liefern offensichtliche Widersprüche. Eine andere Theorie vermag die gesuchte Kenngröße aber in genau diesem bisher unzureichend beschriebenen Bereich genau darzustellen, ist aber dafür in anderen Bereichen unzuverlässig. Eine Übersetzung zwischen diesen beiden Theorien ermöglicht es, die gewünschte Kenngröße und die von ihr beschriebene Physik in allen Bereichen exakt zu beschreiben. Max Riegler nutzt eine spezielle Form des holographischen Prinzips, die „Höhere-Spin-Holographie“, welche zwischen einer bestimmten Raumzeit, welche mehr Symmetrien als sonst üblich besitzt , beschrieben von der Theorie A, und einer zugehörigen Quantenfeldtheorie, Theorie B, übersetzt.
Schematische Darstellung des holographischen Prinzips für eine Raumzeit mit der Topologie eines Zylinders
Besonders ist Max Riegler an Bereichen interessiert, in den die Räume besonders starke Krümmung aufweisen und die Gravitation besonders groß wird. Dies ist zum Beispiel in schwarzen Löchern der Fall. Max Riegler konnte in seiner Masterarbeit einen effizienten Algorithmus entwickeln, welcher zum Finden von passenden Randbedingungen der untersuchten Raumzeit verwendet werden kann, um die hier vorliegende Gravitationstheorie zu beschreiben.
1+1 dimensionale Anti-de-Sitter Raumzeit in flachem 2+1 dimensionalem Raum eingebettet
Max Riegler bleibt seinem Forschungsgebiet und seinem Betreuer Daniel Grumiller, Institut für Theoretische Physik, TU Wien, auch in seiner Dissertation treu. Ziel der Dissertation ist es nun, ein besseres Verständnis der Mechanismen und dualen Feldtheorien dieser Höheren-Spin-Holographie für Raumzeiten zu erlangen, welche nicht Anti-de-Sitter (i.e. Raumzeiten mit konstant negativer Krümmung) sind.
Mehr Information zur Arbeit von Max Riegler finden Sie unter:
http://www.teilchen.at/kdm/437
Foto: S. Albietz (OePG)
Grafiken: Andreas Krassnigg
Rückfragehinweis:
Max Riegler MSc
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
rieglerm@hep.itp.tuwien.ac.at
Autorin:
Sylvia Riedler M.A.
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
sylvia.riedler@tuwien.ac.at
Unendlich ist ungefähr zwei
An der TU Wien wird untersucht, wie die Relativitätstheorie aussieht, wenn man unendlich viele Raumdimensionen annimmt. Erstaunlicherweise ergeben sich daraus Resultate einer 2D-Stringtheorie. Diese Entdeckung soll nun helfen, Schwarze Löcher besser zu verstehen.
Zwei Dimensionen oder unendlich viele Dimensionen? Im Umgang mit Schwarzen Löchern ist das eine komplizierte Frage [1].
Daniel Grumiller
Immanuel Kant hätte sich gewundert. Er betrachtete den dreidimensionalen Raum als etwas a priori Vorgegebenes, als feststehende Voraussetzung für die Erkennbarkeit der Dinge. Doch in der modernen Physik ist längst der Raum selbst zum Forschungsobjekt geworden – und wie viele Dimensionen er hat, ist alles andere als klar.
Um Schwarze Löcher zu untersuchen rechnet Daniel Grumiller von der TU Wien mit unendlich vielen Raumdimensionen – und stößt dabei auf eine erstaunliche Verbindung zwischen Relativitätstheorie und Stringtheorie. Für seine bisherigen Forschungen erhielt er nun den Förderungspreis für Wissenschaft der Stadt Wien.
Das Wichtigste zuerst – kleine Störungen später
Um in der Physik möglichst exakte Ergebnisse zu bekommen, geht man oft von einem einfachen Fall aus und fügt dann kleinere zusätzliche Störungen mit ins Modell ein: Die Bewegung der Erde um die Sonne lässt sich grob berechnen, indem man zuerst alle anderen Himmelskörper ignoriert, danach fügt man die Störungen durch die großen Planeten hinzu. In der Teilchenphysik berechnet man die Wechselwirkung von wenigen Teilchen und bezieht erst dann weitere Teilchen-Interaktionen als kleine Störung mit ein.
Statt der Anzahl von Himmelskörpern oder Teilchen-Interaktionen kann man auch die Anzahl der Raumdimensionen als Störungs-Größe annehmen. Dort funktioniert das allerdings umgekehrt: Man geht nicht von einer möglichst kleinen Anzahl aus sondern nimmt zunächst unendlich viele Raumdimensionen an, und von diesem Extremfall ausgehend kann man sich dann mathematisch wieder einem realistischeren Fall (etwa mit unseren wohlbekannten drei Raumdimensionen) annähern.
Stringtheorie als Ergebnis der Relativitätstheorie
Gemeinsam mit Kollegen aus Spanien untersuchte Daniel Grumiller die Physik Schwarzer Löcher und verwendete dabei den Trick einer unendlichen Dimensionsanzahl. Allerdings hielt die unendlich-dimensionale Relativitätstheorie eine Überraschung bereit: „Wenn wir damit den Raum in der Nähe eines Schwarzen Loches beschreiben, dann ergibt sich aus den Gleichungen plötzlich eine zweidimensionale Stringtheorie – obwohl wir nirgendwo Strings in unsere Rechnungen eingefügt haben“, erklärt Grumiller.
Dieser Zusammenhang erinnert die sogenannte „AdS-CFT-Korrespondenz“: Diese 1997 aufgestellte Vermutung besagt, dass sich ganz unterschiedliche Theorien (Quanten-Gravitationstheorien und Quantenfeldtheorien) in bestimmten Grenzfällen aufeinander abbilden lassen – vorausgesetzt man nimmt jeweils die passende Anzahl von Raumdimensionen an. Warum es solche Querverbindungen zwischen scheinbar ganz unterschiedlichen Bereichen der Physik gibt, ist bis heute nicht ganz verstanden.
Ein neuer Rechentrick für Schwarze Löcher
Dass die unendlichdimensionale Relativitätstheorie gerade auf eine zweidimensionale Stringtheorie führt, ist für Daniel Grumiller ganz besonders erfreulich: Seine Forschungsgruppe an der TU Wien beschäftigt sich nämlich schon seit vielen Jahren mit zweidimensionalen Quanten-Gravitationstheorien. „Unsere bereits bestehenden Ergebnisse aus der zweidimensionalen Stringtheorie können wir nun aufgrund dieses neuentdeckten Zusammenhangs verwenden, um Aussagen über Schwarze Löcher abzuleiten“, ist Grumiller zuversichtlich.
Solche zweidimensionalen Theorien sind besonders dort interessant, wo der Raum als kugelsymmetrisch angenommen werden kann – etwa rund um ein nichtrotierendes Schwarzes Loch. Um diese physikalische Situation zu beschreiben, benötigt man nur zwei Dimensionen: Den räumlichen Abstand vom Zentrum des Schwarzen Lochs und die Zeit.
Förderungspreis der Stadt Wien
Für seine bisherigen Forschungen im Grenzgebiet zwischen Gravitations- und Quantentheorien erhielt Daniel Grumiller den Förderungspreis für Wissenschaft der Stadt Wien. Er wird einmal jährlich an Personen vergeben, die bereits ein hervorragendes Gesamtwerk vorweisen können, das 40. Lebensjahr allerdings noch nicht vollendet haben.
Grumillers Publikation in Physical Review Letters
Frei zugänglicher Artikel in Arxiv
[1] Creative Commons 2.0, Bild: TU Wien, Ute Kraus, Axel Mellinger
Rückfragehinweis:
Dr. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13634
daniel.grumiller@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Steuerbare Zufallslaser
Zufallslaser sind winzige Körnchen, die ihr Licht unkontrolliert in verschiedene Richtungen abstrahlen. An der TU Wien konnte nun gezeigt werden, dass man dem Zufall auf die Sprünge helfen kann um diese exotischen Lichtquellen präzise zu steuern.
Zufallslaser werden durch einen Lichtstrahl von oben mit Energie versorgt. Zufällige Unregelmäßigkeiten im Inneren (gelbe Punkte) sorgen dafür, dass das Laserlicht in ganz unterschiedliche Richtungen ausgestrahlt wird.
Hier wird der Lichtstrahl zuerst durch eine Maske geschickt, sodass nicht jeder Punkt im Zufallslaser (weißer Kreis) im selben Maß mit Energie versorgt wird. Durch dieses gezielte Pumpen emittiert der Zufallslaser einen Lichtstrahl genau in die gewünschte Richtung.
Das Licht, das sie ausstrahlen, ist ebenso individuell wie ein Fingerabdruck: Zufallslaser sind winzige Strukturen, deren Abstrahlverhalten durch chaotische Lichtstreuung in ihrem Inneren festgelegt ist. Erst seit wenigen Jahren kann man ihr Verhalten erklären, nun wurde an der TU Wien eine Methode präsentiert, mit der sich die Richtung ihrer Strahlung nach Belieben steuern lässt. Was als kuriose Idee begann, wird damit zu einer neuen Art von Lichtquelle.
Chaos statt Spiegel
In gewöhnlichen Lasern wird Licht zwischen zwei Spiegeln hin und her reflektiert. Dabei wird das Licht von den Atomen des Lasers immer weiter verstärkt, bis ein Laserstrahl entsteht und aus dem Laser austritt. „Ein Zufallslaser hingegen kommt ohne Spiegel aus“, erklärt Prof. Stefan Rotter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien. „Er besteht aus einem körnigen Material, in dem das Licht immer wieder abgelenkt und auf komplizierte Bahnen gezwungen wird.“ Entlang dieser Bahnen wird das Licht verstärkt – an welchen Stellen das Licht schließlich aus dem Laser austritt, hängt von der zufälligen inneren Struktur des Lasermaterials ab.
Pumpen mit Licht
Die Energie, die der Laser zur Verstärkung des Lichtstrahls benötigt, muss von außen in Form von Licht zugeführt werden – man spricht von „optischem Pumpen“. Gewöhnliches, ungeordnetes Licht wird in den Laser gepumpt und liefert Energie, im Laser wird daraus geordnetes, kohärentes Laserlicht erzeugt, in dem Lichtteilchen exakt im gleichen Takt schwingen.
„Beim Zufallslaser ist ganz entscheidend, auf welche Weise man ihn pumpt“, sagt Stefan Rotter. Licht wird von oben auf einen scheibenförmigen Zufallslaser gestrahlt, sein Laserlicht sendet er dann radial in alle Richtungen aus. „Unsere Grundidee ist, den Zufallslaser nicht gleichförmig zu pumpen, sondern ihn mit einem ganz bestimmten Lichtmuster zu beleuchten, das dann genau die Laserstrahlung hervorruft, die wir uns wünschen“, sagt Rotter. Durch eine genau passende Beleuchtung regt man verschiedene Regionen des Zufallslasers in unterschiedlichem Maß zur Lichtverstärkung an und kann dadurch erreichen, dass der Laser sein Licht nur in einer ganz bestimmten Richtung aussendet.
Schritt für Schritt zum richtigen Lichtmuster
Wie man nun das richtige Bestrahlungsprofil finden kann, mit dem sich genau das gewünschte Laserlicht hervorrufen lässt, wird an der TU Wien in Computersimulationen untersucht. „Man beginnt mit einem zufällig gewählten Bestrahlungsmuster und beobachtet, welches Laserlicht man dadurch bekommt. Dann passt man gezielt, Schritt für Schritt, dieses Muster an, bis der Laser sein Licht genau in die gewünschte Richtung abstrahlt“, erklärt Rotter.
Nachdem keine zwei Zufallslaser genau gleich sind, muss man diesen Optimierungsprozess für jeden einzelnen Laser individuell durchführen – doch ist die Lösung erst einmal bekannt, kann man damit immer wieder dieselbe Laserstrahlung hervorrufen. Hat man einen Zufallslaser also erst einmal genau analysiert, kann man nach Belieben einstellen, in welche Richtung er strahlt – oder seinen Strahl durch eine zeitliche Abfolge unterschiedlicher Bestrahlungsmuster im Raum herumführen.
Das Team von Stefan Rotter arbeitet derzeit mit einer Forschungsgruppe in Paris zusammen, die Zufallslaser im Labor herstellt und untersucht. Gemeinsam sollen die Ergebnisse der Computersimulationen nun experimentell realisiert werden. Wenn es auch in den bevorstehenden Messungen gelingt zu zeigen, dass in Zufallslasern nichts mehr dem Zufall überlassen werden muss, würde dies einen großen Schritt in Richtung Anwendung für diese exotischen Lichtquellen bedeuten.
Rückfragehinweise:
Prof. Stefan Rotter
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-680-3063161
stefan.rotter@tuwien.ac.at
Dipl.-Ing. Matthias Liertzer
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13644
matthias.liertzer@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Ehrenmedaille für Prof. Maria Ebel
Maria Ebels jahrzehntelanger Einsatz für die Fakultät für Physik wurde mit der Ehrenmedaille der Fakultät gewürdigt.
Prof. Maria Ebel
Dekan Gerald Badurek übergibt die Medaille
Die Ehrenmedaille der Fakultät für Physik
Prof. Maria Ebel kann auf viele arbeitsintensive und ereignisreiche Jahre an der Fakultät für Physik zurückblicken: Ihr Einsatz galt nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern in ganz bemerkenswertem Ausmaß auch der internationalen Vernetzung der Studierenden. Am 11. Juni wurde ihr die Ehrenmedaille der Fakultät für Physik überreicht. Sie ist erst die zweite Person, der diese Auszeichnung zugesprochen wurde.
Hunderte Auslandskontakte
Auslandssemester sind für Studierende heute etwas beinahe Alltägliches geworden – doch das war nicht immer so. Maria Ebel ist es zu verdanken, dass der internationale Austausch von Studierenden an der TU Wien schon seit langer Zeit so fest etabliert ist. Mehr als hundert ausländische Studierende unterstützte sie dabei, an die TU Wien zu kommen, und 332 Studierende der TU Wien konnten durch ihre Mithilfe Auslandsaufenthalten absolvieren. Zu Beginn knüpfte Maria Ebel in erster Linie Austausch-Kontakte zu Universitäten innerhalb Europas, später kamen dann auch noch die USA und Kanada hinzu.
Auch wissenschaftlich hat Maria Ebel große Erfolge vorzuweisen: 1982 habilitierte sie sich für Photoelektronenspektroskopie, zahlreiche Publikationen und Vorträge im In- und Ausland verhalfen ihr zu hohem Ansehen im Fachbereich der Oberflächenanalyse.
Eine Grußbotschaft der Rektorin Sabine Seidler wurde von Dekan Gerald Badurek überbracht. "Die Verdienste von Maria Ebel sind ganz unglaublich, aufwiegen kann man das gar nicht. Die Ehrenmedaille ist bloß eine winziges Anerkennung für eine Person, der unsere Fakultät enorm viel zu verdanken hat", sagt Gerald Badurek. Die Ehrenmedaille erhielt Maria Ebel in Anwesenheit von zahlreichen WeggefährtInnen, unter ihnen auch der ehemalige Rektor Peter Skalicky.
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Standing Ovations für den TU Chor
Der neue TU Chor hat sein erstes großes Konzert mit – im bildlichen Sinn – fliegenden Fahnen bestanden. Im vollbesetzten Prechtlsaal wurde dem begeisterten Publikum ein buntes Programm von Johann Strauß bis Pink geboten.
Der TU Chor ist das jüngste Kind der Künstlerfamilie der TU Wien und wurde im Oktober 2012 aus der Taufe gehoben. Nach zwei kleineren Auftritten im Dezember und Jänner wagten sich die sangesfreudigen TechnikerInnen aus 10 Studienrichtungen an ihr erstes großes Konzert. Eine Stunde lang erfreuten sie ihre überaus zahlreich erschienenen ZuhörerInnen mit Klassikern wie „Oh, Happy Day“ und „Somewhere over the rainbow“. Neben österreichischen Weisen wie „Is scho still uman See“ und dem „Champagnerlied“ aus der Fledermaus bot der TU Chor auch Gustostücke wie „The Lion sleeps tonight“ und „Only you“ in der Acapella-Version der Flying Pickets. Die 35 Sängerinnen und Sänger überzeugten nicht nur durch ihre stimmlichen Qualitäten, sondern auch mit Choreographie und Ausdrucksstärke. Unterstützung in Form von Percussion, Bass und Ukulele rundete das farbenreiche Klangbild harmonisch ab.
Der Chorleiter Andreas Ipp führte launig und fachkundig durch den Abend. Haben Sie gewusst, dass Johann Strauß am k. & k. polytechnischen Institut, der Vorgängerin der TU Wien, studierte und hinaus geworfen wurde, weil er immerzu komponierte und laut sang? „Das Konzert selber hat viel Spaß gemacht, und es war sehr schön, vor so einem begeisterten Publikum singen zu können.“ zieht er ein zufriedenes Fazit über die gelungene Darbietung von 10 Liedern (plus einer Zugabe) vor 250 enthusiastischen ZuhörerInnen.
Von der durchschlagenden Qualität der Protagonisten waren die Sponsoren bereits im Vorfeld überzeugt; die TU Wien, die Mensa der TU Wien und die Bäckerei Ströck unterstützen der TU Chor.
Wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben, mitzusingen, mehr Information und Bilder finden Sie unter: chor.tuwien.ac.at/mitsingen
Und wenn man in die leuchtenden Gesichter der Sängerinnen und Sänger schaut, weiß man: Singen ist gut für die Seele.
Autorin:
Sylvia Riedler
Institut für Theoretische Physik
E: sylvia.riedler@tuwien.ac.at
TU Chor: Frühlingskonzert
23. Mai 2013, 19:30 Uhr
Prechtlsaal
TU-Hauptgebäude | Erdgeschoss
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Foto:
© Matthias Muggli
TU Chor: Frühlingskonzert
Am 23. Mai 2013 gibt der TU Chor sein erstes öffentliches Konzert – ganz im Zeichen des Frühlings.
Seit Oktober 2012 probt der neue TU Chor und erarbeitet eine breite Palette von Liedern, von Johann Strauss bis Pink. Eine Auswahl dieser Lieder wird am 23. Mai 2013 beim ersten Konzert präsentiert.
Zeit & Ort:
23. Mai 2013, 19:30 Uhr | Einlass: 19:00 Uhr
Prechtlsaal
TU-Hauptgebäude | Erdgeschoss
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Eintritt frei - freiwillige Spenden
Sitzplatzreservierung unter chor@tuwien.ac.at
Webtipp: http://chor.tuwien.ac.at
Fotos:
Sonnenblume © Petra Schmidt/Pixelio.de;
Tulpen © Bernd Kasper/Pixelio.de,
Noten © Pambieni/Pixelio.de
Autorin:
Nicole Schipani
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
nicole.schipani@tuwien.ac.at
Möchten Sie Ihr schwarzes Loch mit Milch?
Zwischen dem Verhalten ultraheißer Teilchen und dem Kollaps eines schwarzen Loches gibt es erstaunliche mathematische Verbindungen. An der TU Wien nutzt man das, um mehr über die rätselhafte Physik des Quark-Gluon-Plasmas herauszufinden.
Schwarze Löcher, Teilchenphysik und thermischer Ausgleich: eine Melange aus unterschiedlichen physikalischen Gebieten
Stefan Stricker (l) und Dominik Steineder (r)
Fast mit Lichtgeschwindigkeit lässt man am CERN Atomkerne miteinander kollidieren. Dabei werden sie in ihre elementaren Bestandteile aufgelöst und bilden ein Quark-Gluon-Plasma, einen ultraheißen Materiezustand, in dem sich kurz nach dem Urknall die gesamte Materie des Universums befand. Dieses Plasma überrascht mit unerwarteten Eigenschaften: Es scheint dünnflüssiger zu sein als jede gewöhnliche Flüssigkeit und strebt erstaunlich schnell in ein Temperatur-Gleichgewicht – ein Prozess, den man als „Thermalisierung“ bezeichnet. An der TU Wien wird diese Thermalisierung mit Methoden berechnet, die nicht aus der Teilchenphysik, sondern aus der Gravitationstheorie kommen.
Die flüssigste Flüssigkeit der Welt
Wenn man Milch in heißen Kaffee leert, dann vermischen sich die Flüssigkeiten und gleichen ihre Temperatur an. Das bunte Gewirr an Quarks und Gluonen, das sich nach einer Kollision von schweren Atomen am CERN ungeordnet durcheinanderbewegt, verhält sich ähnlich. „Ursprünglich dachte man, die Teilchen würden sich verhalten wie Atome in einem Gas“, sagt Stefan Stricker, doch Messungen zeigen, dass die Sache viel komplizierter ist. In einem Gas stoßen Atome aneinander, abgesehen davon beeinflussen sie sich kaum. Die Teilchen im Quark-Gluon-Plasma hingegen sind stark aneinander gekoppelt und verhalten sich wie eine extrem dünne Flüssigkeit – das Plasma ist gewissermaßen die flüssigste Flüssigkeit der Welt.
Warum das Quark-Gluon-Plasma so extrem dünnflüssig ist und warum es so extrem schnell einem thermischen Gleichgewichtszustand zustrebt, gehört noch immer zu den großen Geheimnissen der modernen Physik. „Teilchen, die nur schwach wechselwirken, sind mathematisch recht einfach zu beschreiben“, erklärt Stefan Stricker. Bei starken Kopplungen versagen allerdings die gängigen Rechenmethoden.
Schwarze Löcher als Rechentrick
Der Trick, mit dem die Forschungsgruppe an der TU Wien dieses Problem umgeht, wurde in den Neunzigerjahren entdeckt, seither bewährt er sich immer wieder aufs Neue. „Es zeigt sich, das Quantentheorien, die man zur Beschreibung des Quark-Gluon-Plasmas braucht, sehr eng in Verbindung mit Gravitationstheorien stehen“, erklärt Stefan Stricker, „und zwar mit einer höherdimensionalen Erweiterung der Gravitationstheorie.“ Genau wie ein zweidimensionales Quadrat als Randfläche eines dreidimensionalen Würfels betrachtet werden kann, lässt sich auch unsere Welt mit drei Raumdimensionen als Rand eines größeren Raumes betrachten, der vier Raumdimensionen hat. „Die Teilchenphysik in drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension lässt sich in Gravitationsphysik in vier Raumdimensionen und einer Zeitdimension übersetzen“, sagt Stricker.
Anstatt zu berechnen, wie das Plasma thermisch ins Gleichgewicht strebt, übersetzt man daher das Problem auf eine ganz andere physikalische Situation im höherdimensionalen Raum: Man berechnet den Kollaps einer Kugelschale, die sich zu einem schwarzen Loch zusammenzieht. Das Ergebnis lässt sich dann wieder auf die Physik des Quark-Gluon-Plasmas zurückübertragen. Dieses Vorgehen, ganz unterschiedliche Gebiete der Physik mathematisch ineinander überzuführen, ist höchst ungewöhnlich. Vollständig verstanden ist diese Symmetrie zwischen Quantenfeldtheorien und Teilchen auf der einen Seite und Stringtheorie, Gravitation und schwarzen Löchern auf der anderen Seite bis heute nicht. „Es gibt keinen mathematischen Beweis, der diese Symmetrie zwischen zunächst ganz unterschiedlichen Theorien erklärt“, sagt Stefan Stricker, „doch mittlerweile haben wir eine ganze Reihe von korrekten Rechenergebnissen, die auf diese Weise gewonnen wurden.“
Gleichgewicht auf verschiedenen Ebenen
Mit Hilfe von Computersimulationen versuchten Stefan Stricker und Dominik Steineder von der TU Wien gemeinsam mit Aleksi Vuorinen von der Universität Bielefeld den Geheimnissen der Quark-Gluon-Plasma-Thermalisierung auf die Spur zu kommen. Dabei erkannten sie, dass zwei entgegengesetzte Prozesse an dieser Thermalisierung beteiligt sind. „Das System strebt nicht auf jeder Energie- oder Größenskala gleich schnell ins Gleichgewicht“, sagt Stefan Stricker. Temperaturen gleichen sich normalerweise zuerst auf mikro-Skala, dann erst auf großer Skala an – man spricht dann von einer „top-down-Thermalisierung“. Eng benachbarte Punkte haben sehr rasch fast dieselbe Temperatur, weit entfernte Regionen können hingegen zunächst noch ganz unterschiedliche Temperaturen haben. Beim Quark-Gluon-Plasma kann das allerdings auch umgekehrt ablaufen.
Dass das Streben in ein Gleichgewicht auf unterschiedlichen Größenskalen unterschiedlich aussehen kann, kennt man vom Mischen verschiedener Flüssigkeiten: So wird Milchkaffee zwar sehr rasch homogen und gleichmäßig braun, doch auf mikroskopischer Ebene kann man Kaffee und Milchtröpfchen noch immer unterscheiden. Umgekehrt sieht die Sache aus, wenn man zähe Substanzen mischt – etwa Honig und Schokomousse. Dann sieht das Gemisch auf mikroskopischer Skala zwar lokal zunächst noch gleichmäßig aus, doch im Großen sind unterschiedliche Komponenten sichtbar.
„Dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Größenskalen sehen wir auch bei der Thermalisierung des Quark-Gluon-Plasmas: Abhängig davon, wie stark die Teilchen miteinander gekoppelt sind, strebt das System entweder auf großer oder auf kleiner Längenskala rascher ins Gleichgewicht“, erklärt Stricker. Um die bemerkenswerten Eigenschaften des Quark-Gluon-Plasmas verstehen zu können muss man beide diese Sichtweisen gleichzeitig in die Berechnungen einbeziehen, ist das Forschungsteam nun sicher. Doch vielleicht sind bis zur endgültigen Klärung der Geheimnisse des Quark-Gluon-Plasmas noch einige ähnlich phantasievolle Tricks nötig, wie jene, die bereits in den letzten Jahren unser Verständnis über das Quark-Gluon-Plasma so sehr erweitert haben.
Nähere Informationen:
Dr. Stefan Stricker
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T +43 1 58801 13637
stefan.stricker@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Stefan Nagele - Promotio Sub Auspiciis Praesidentis Rei Publicae
Drei TU-Absolventen erreichen am 12. April den vorläufigen Höhepunkt ihrer außergewöhnlichen akademischen Karriere: Die Sub auspiciis Promotion. Die Bestleistungen in Schule und Studium werden von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer mit der Überreichung des Goldenen Ehrenringes der Republik gewürdigt.
Promoventen mit Bundespräsident Fischer und Rektorin Seidler
[Foto: Copyright: TU Wien | Foto: Thomas Blazina]
DI Stefan Nagele [Foto: Privat]
Promotio Sub Auspiciis Praesidentis Rei Publicae
Freitag, 12. April 2013, 11:00 Uhr
Festsaal der TU Wien
Karlsplatz 13, Stiege 1, 1. Stock
1040 Wien
Den akademischen Grad "Doktor der technischen Wissenschaften" erhalten:
Dipl.-Ing. Thomas Wannerer
Dissertationsthema: "SO(n) equivariant Minkowski Valuations"
Fakultät für Mathematik und Geoinformation
Dipl.-Ing. Manuel Friedrich Weberndorfer
Dissertationsthema: "Reverse Affine Isoperimetric Inequalities"
Fakultät für Mathematik und Geoinformation
Dipl.-Ing. Stefan Nagele
Dissertationsthema: "Ultrafast electronic dynamics in one- and two-electron atoms"
Fakultät für Physik
Goldener Ehrenring der Republik
Der gebürtige Salzburger Dipl.-Ing. Stefan Nagele absolvierte nach dem Privatgymnasium Borromäum das Diplomstudium Technische Physik an der TU Wien (2001-2007). In das Diplomstudium integrierte er auch einen Auslandsaufenthalt an der KTH Stockholm. Mit dem ausgezeichneten Diplom in der Tasche startete Nagele 2007 in das Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften an der TU Wien, parallel dazu war er bis 2012 Fellow der International Max Planck Research School of Advanced Photon Science. Bewusst auf eine Sub auspiciis Promotion hingearbeitet hat der Physiker nicht. "Das Physik-Studium war für mich außerordentlich interessant, und ich habe immer schon gerne gelernt - bei den Prüfungen eben solange, bis ich den Stoff verstanden habe. Die guten Noten haben sich dann eigentlich daraus ergeben", so Nagele. Gegen Studienende war die Möglichkeit einer Sub auspiciis Promotion aber doch ein zusätzlicher Ansporn.
Direkte Vorteile – z.B. bei künftigen Arbeitgebern - erwarte er nicht, es sei aber eine sehr schöne Geste der Anerkennung durch die Republik. Eine konkrete Anwendung für den mit der Promotion verbundenen Würdigungspreis und das mögliche Exzellenzstipendium des Wissenschaftsministeriums sieht Nagele in der Finanzierung von Forschungsaufenthalten im Ausland. Der Sub auspiciis Promovend bleibt der TU Wien vorerst als Universitätsassistent am Institut für Theoretische Physik erhalten. Befragt nach seinen Zukunftsplänen antwortet Nagele: "Die berufliche Vision für die nächste zehn Jahre ist aus jetziger Sicht das Erreichen einer Professur. Wenn die Bedingungen an den Universitäten aber nicht passen, kann ich mir auch eine Karriere abseits der Universität sehr gut vorstellen."
Rückfragehinweis:
Stefan Nagele
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13607
stefan.nagele[@]tuwien.ac.at
Aussender:
Herbert Kreuzeder
Büro für Öffentlichkeitsarbeit
Technische Universität Wien
pr@tuwien.ac.at
Zwischen Physik und Chemie
Stefanie Gräfe forschte an der TU Wien an kleinen Molekülen und ihrer Wechselwirkung mit Laserlicht. Nun tritt sie eine Professur in Jena an.
Stefanie Gräfe
Wer ein einzelnes Atom untersucht, macht Physik. Sind zwei Atome bereits Chemie? Gerade anhand kleiner Moleküle lassen sich interessante Phänomene untersuchen. „Manche Chemiker betrachten solche Systeme als zu klein um für die Chemie relevant zu sein, für die Physik hingegen sind sie schon fast zu groß, um sie exakt berechnen zu können“, sagt Stefanie Gräfe. Seit 2008 forschte sie am Institut für Theoretische Physik der TU Wien, nun tritt sie eine Professur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena an.
Grenzgängerin zwischen den Wissenschaften
Stefanie Gräfe ist studierte Chemikerin, hatte aber schon bei ihrer Doktorarbeit in Würzburg viel mit Physik zu tun: „In der physikalische Chemie spielen bei der Charakterisierung verschiedener Moleküle physikalische Methoden eine sehr wesentliche Rolle, zum Beispiel die Spektroskopie“, erklärt sie. Sie untersuchte damals, wie man mit Lasern Einfluss auf das Verhalten von Molekülen nehmen kann. Als Postdoc arbeitete sie dann zunächst in Ottawa, Kanada, in einer Physik-Gruppe. Dort forschte man an Atomen in starken Laserfeldern. Gräfe erweiterte die Rechenmethoden, sodass mit ihnen auch Moleküle berechnet werden konnten.
„Der Schritt zur Physik war zunächst schon eine große Umstellung“, meint Stefanie Gräfe heute. „Es gibt doch deutliche Unterschiede in der Mathematik- und der Quantentheorie-Ausbildung zwischen einem Physik- und einem Chemiestudium.“ Doch gerade das präzise Arbeiten mit den fundamentalen Grundgleichungen der Quantenmechanik fand Gräfe immer spannend.
2008 kam Stefanie Gräfe mit einem Lise Meitner Stipendium an die TU Wien – gemeinsam mit ihrem heutigen Ehemann Daniil Kartashov, den sie in Kanada kennengelernt hatte. Gräfe arbeitete am Institut für Theoretische Physik. Kartashov, ein Experimentalphysiker, ging ans Institut für Photonik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik. 2011 wurde Stefanie Gräfe mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet und verlängerte ihren Aufenthalt in Wien, nachdem sie durch eine Vertretungsprofessur bereits Kontakte mit der Universität Jena geknüpft hatte.
Chemie-Professorin nach Physik-Postdoc
Nach fünf Jahren an der TU Wien erhielt Stefanie Gräfe nun einen Ruf auf eine Professur für Theoretische Chemie in Jena, auch ihr Ehemann wird ihr in wenigen Monaten an die Universität Jena nachfolgen. „Ehepartner, die beide in der Wissenschaft tätig sind, haben es immer extrem schwer, Jobs in der selben Stadt zu finden“, sagt Gräfe. „Ich bin sehr froh, dass uns das in Jena gelungen ist.“
Stefanie Gräfe wird in Jena ihre Arbeit im Bereich der Wechselwirkung von Laserlicht und Molekülen fortsetzen, auch weitere Kooperationen mit der TU Wien sind geplant. „Die Universität Jena will ausdrücklich die fakultätsübergreifenden Verbindungen zwischen Chemie und Physik stärken, das kommt mir natürlich sehr gelegen“, sagt Gräfe. Zusätzlich wird sie an klassischeren materialchemische Forschungsprojekten mitarbeiten, etwa im Bereich der Solarzellenforschung.
Rückfragehinweis:
Dr. Stefanie Gräfe
Institut für Physikalische Chemie
Universität Jena
Helmholtzweg 4
07743 Jena
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Quanteneffekte in Super-Zeitlupe
Mit Hilfe von Laserpulsen lassen sich immer kürzere Zeiträume auflösen. Dadurch eröffnen sich ganz neue Einblicke in die Physik der Atome und Moleküle.
Ultrakurze Laserpulse und ihre Wechselwirkung mit Atomen und Molekülen: Auf ungeheuer kurzen Zeitskalen laufen Quanten-Phänomene ab.
v.l.n.r.: Joachim Burgdörfer, Stefan Nagele, Renate Pazourek
Haben Sie schon einmal versucht, eine vorbeifliegende Libelle zu fotografieren? Schnelle Bewegungen, rasche Prozesse sind schwer zu beobachten. Ganz besonders trifft das auf Vorgänge in der Quanten-Welt zu: Mit Millionen Kilometern pro Stunde bewegen sich Elektronen rund um den Atomkern. Die Zeitskala, auf der atomare Prozesse ablaufen, ist so kurz, dass sie mit unserer menschlichen Vorstellung kaum fassbar ist. Trotzdem gelingt es heute, in diesen Bereich vorzudringen. Mit Hilfe ultrakurzer Laserpulse lässt sich der zeitliche Ablauf von Quanten-Prozessen beobachten. Am Institut für Theoretische Physik der TU Wien wird daran seit Jahren erfolgreich geforscht.
Attosekunden: Der Takt, in dem die Quanten tanzen
Elektronen, die aus dem Atom herausgerissen werden oder Moleküle, die auseinanderbrechen – Quantenphänomene laufen meist sehr schnell ab. Sogar die Zeitskala moderner Mikroelektronik, die mit Gigahertz-Taktfrequenzen arbeitet, wirkt dagegen noch recht gemächlich. Untersucht werden diese Phänomene, indem man ultrakurze Laserpulse auf einzelne Atome oder Moleküle abfeuert.
Mittlerweile lassen sich Laserpulse in der Größenordnung von Attosekunden herstellen. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel eines Milliardstels einer Sekunde, also 10 hoch minus 18 Sekunden. Verglichen mit den Zeitskalen, mit denen wir im täglichen Leben zu tun haben, ist das unvorstellbar kurz: „Eine Attosekunde verhält sich zu einer Sekunde etwa so wie eine Sekunde zum Alter des Universums“, erklärt Prof. Joachim Burgdörfer, Vorstand des Instituts für Theoretische Physik. Die Lichtwelle des Attosekunden-Laserpulses hat nur Zeit für einige wenige Schwingungen, bevor der Laserpuls wieder vorüber ist.
Mit Papier, Bleistift und Supercomputern
Experimentelle und theoretische Forschung arbeiten in der Attosekundenphysik meist eng zusammen. Um die experimentellen Daten wirklich verstehen zu können, sind quantenphysikalische Computersimulationen notwendig – dafür nützt die Gruppe am Institut für theoretische Physik einige der leistungsfähigsten Computercluster der Welt. Auch der hauseigene Supercomputer VSC2, der seit 2011 für die Forschung zur Verfügung steht, ist für die Attosekunden-Forschungsgruppe ein wichtiges Werkzeug geworden. Viele der Quantenphänomene, mit denen man am Institut für Theoretische Physik beschäftigt, werden nur wenige hundert Meter weiter, am Institut für Photonik (Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik) experimentell untersucht. Auch mit anderen weltweit führenden Experimentalgruppen gibt es enge Zusammenarbeit – etwa zum Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.
Kontrolle über Quantenteilchen
Die Attosekundenphysik ist heute ein boomendes Forschungsgebiet, das auf der ganzen Welt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Das liegt nicht nur daran, dass man durch neue Attosekunden-Forschung einen tieferen Einblick in die fundamentalen Konzepte der Quantenphysik erhält, sondern auch an den technologischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. „Letzten Endes sollen ultrakurze Laserpulse dazu verwendet werden können, genau zum richtigen Zeitpunkt in atomare und molekulare Prozesse eingreifen zu können, zum Beispiel um gezielt chemische Bindungen aufzubrechen oder gewünschte Reaktionen zu beschleunigen“, sagt Renate Pazourek vom Institut für Theoretische Physik. „Dazu muss man allerdings das Zusammenspiel zwischen Licht und Materie noch besser verstehen und viele technologische Probleme besser in den Griff bekommen.“ So könnten sich etwa eines Tages Moleküle mit Hilfe von Laserpulsen in genau definierte Bruchstücke aufspalten lassen – doch bis das tatsächlich möglich wird, muss sich die Attosekundenphysik wohl noch einige Zeit lang ähnlich dynamisch weiterentwickeln, wie sie das auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan hat.
Rückfragehinweis:
Dr. Renate Pazourek
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13633
renate.pazourek[@]tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
EUR 400.000 für Schwarze Löcher und das holographische Prinzip
Internationale Projekte bewilligt - Argentinien, Korea, Deutschland
Im Jaenner 2013 wurde vom oesterreichischen akademischen Austauschdienst ein bilaterales Projekt zwischen Argentinien und dem Institut fuer Theoretische Physik an der TU Wien bewilligt. Mit den kuerzlich bewilligten bilateralen FWF-Projekten mit der LMU Muenchen und der Seoul National University stehen unserem Institut neue Forschungs- und Reisemittel im Umfang von ueber 400.000 (vierhunderttausend) Euro zur Verfuegung. Daniel Grumiller, der diese Mittel eingeworben hat, kann damit seine Forschungsgruppe zu Schwarzen Loechern und Quantengravitation weiter ausbauen.
Das holographische Prinzip
Wissenschaftlich beschaeftigen sich diese Projekte mit neuen Aspekten des holographischen Prinzips, das eine erstaunliche Relation zwischen Quantengravitationstheorien in z.B. drei Dimensionen und Quantenfeldtheorien in zwei Dimensionen herstellt. Aehnlich wie bei einem Hologramm wird 3-dimensionale Information auf 2 Dimensionen abgebildet (siehe [| Dreidimensional? Vierdimensional? Völlig egal!]).
Vielfältige Verwendung
Anwendungen hat dieses Prinzip in zwei verschiedene Richtungen, die beide an unserem Institut vertreten sind. Anton Rebhans Gruppe verwendet es, um sehr komplexe Probleme in Quantenfeldtheorien auf vergleichsweise einfache in Gravitationstheorien abzubilden und damit z.B. die Physik von Schwerionenstoessen am LHC und RHIC besser zu verstehen. Daniel Grumillers Gruppe verwendet es, um sehr schwierige Probleme in Quantengravitation auf vergleichsweise einfache in Quantenfeldtheorie abzubilden und damit konzeptuelle Fragen der Quantengravitation zu diskutieren, z.B. ein mikroskopisches Verstaendnis der Entropie von Schwarzen Loechern.
Einer der innovativen Aspekte dieser Projekte ist die Verwendung von Theorien mit hoeherem Spin (siehe [| Wenn Quanten und Gravitation Walzer tanzen]), die das Aufstellen von neuen holographischen Korrespondenzen erlaubt.
Rückfragehinweis:
Dr. Daniel Grumiller
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13634
grumil[@]hep.itp.tuwien.ac.at
Gefrorenes Chaos
Iva Březinová gelang es, mit Hilfe der Chaostheorie das Verhalten von ultrakalten Bose-Einstein-Kondensaten zu erklären. Dafür erhält sie den Hannspeter-Winter-Preis der TU Wien.
Hannspeter-Winter-Preisträgerin Iva Březinová
Es ist wohl der exotischste aller Materiezustände: Bei extrem niedrigen Temperaturen, knapp über dem absoluten Nullpunkt, können Atome zu einem Bose-Einstein-Kondensat zusammenfrieren. Sie befinden sich dann gemeinsam im gleichen Energiezustand und bewegen sich im Gleichtakt – ein Effekt der beispielsweise auch für die Supraleitung verantwortlich ist. Dass bei der Bewegung von Bose-Einstein-Kondensaten die Chaostheorie eine wichtige Rolle spielt, hatte man nicht vermutet. Iva Březinová vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien verknüpfte in ihren Computersimulationen allerdings Quantenphysik und Chaostheorie um den Rätseln des Bose-Einstein-Kondensats auf den Grund zu gehen. Sie bekommt dafür am 25. Jänner den Hannspeter-Winter-Preis der TU Wien.
Ultrakalte Quanten-Wellen
In der Quantenphysik wird jedes Teilchen als Welle beschrieben. Je niedriger die Temperatur ist, umso langsamer bewegen sich die Teilchen und umso größer wird die Wellenlänge. Knapp über dem absoluten Nullpunkt übersteigt die Länge der Teilchenwellen den durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Teilchen – die Wellen überlappen, ein Bose-Einstein-Kondensat entsteht. Die einzelnen Teilchen verlieren ihre Individualität, sie können nicht mehr getrennt voneinander betrachtet werden und vereinen sich zu einem einzigen großen Quantenobjekt. Das Bose-Einstein-Kondensat kann eine Größe von mehreren Mikrometern haben – in quantenphysikalischen Maßstäben betrachtet sind das gigantische Ausmaße.
Das Chaos in den Wellen
„Eigentlich ist das Bose-Einstein-Kondensat der geordnetste Zustand, den man sich vorstellen kann“, sagt Iva Březinová. „Und trotzdem zeigt sich in unseren Berechnungen, dass Chaos wichtige Hinweise über den Zustand des Kondensats geben kann.“ In Computersimulationen lässt sich nämlich berechnen, wie die Quanten-Wellen des Bose-Einstein-Kondensats durch winzige Unregelmäßigkeiten der Umgebung beeinflusst werden.
Bereits kleinste Störungen – etwa unregelmäßige elektromagnetische Felder – können die Bewegung der Quanten-Welle dramatisch verändern. „Zwei Quanten-Wellen, die zu Beginn fast völlig gleich aussehen, entwickeln sich chaotisch auf ganz unterschiedliche Weise, und nach einer gewissen Zeit ergeben sich völlig unterschiedliche End-Zustände“, erklärt Březinová. Genau das ist das entscheidende Kennzeichen chaotischen Verhaltens: Winzige Unterschiede in den Anfangsbedingungen können riesige Auswirkungen haben und zu völlig unterschiedlichen Endzuständen führen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Schmetterlingseffekt: Die kaum wahrnehmbaren Änderungen der Luftströmung, die der Flug eines Schmetterlings verursacht, können theoretisch den Verlauf des Wetters drastisch verändern, und letzten Endes vielleicht sogar darüber entscheiden, ob ein Wirbelsturm entsteht oder nicht.
Chaos dampft Atome fort
Das chaotische Verhalten der Quanten-Wellen hat eine wichtige Bedeutung für die Stabilität des Bose-Einstein-Kondensats: „Ein wesentliches Problem bei Experimenten entsteht, wenn die Atome aufhören sich im Gleichtakt zu bewegen. Das passiert genau dann, wenn einzelne Atome des Kondensats plötzlich mehr Energie bekommen, aus dem gemeinsamen Quanten-Zustand ausbrechen und das Kondensat verlassen“, sagt Iva Březinová. „Unsere Berechnungen zeigen, dass dieser Effekt dann eine wichtige Rolle spielt, wenn sich die Quanten-Welle des Bose-Einstein-Kondensats chaotisch verhält.“
Hannspeter-Winter-Preis für herausragende Dissertation
Jedes Jahr wird der Hannspeter-Winter-Preis an eine Absolventin des Doktoratsstudiums der TU Wien vergeben. Er ist mit € 10.000 dotiert und wird gemeinsam von der TU Wien und der BA/CA-Stiftung finanziert. Der Forschungspreis wurde im Gedenken an TU-Professor Hannspeter Winter gestiftet, der sich stets für die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen eingesetzt hat. Iva Březinová verfasste ihre Dissertation unter Anleitung von Prof. Joachim Burgdörfer am Institut für Theoretische Physik der TU Wien. Sie promovierte am 8. Juni 2012 sub auspiciis, in Anwesenheit von Bundespräsident Heinz Fischer.
Iva Březinovás Dissertation entstand im Rahmen des Doktoratsprogrammes CoQus (Complex Quantum Systems), das von der TU Wien und der Universität Wien gemeinsam betrieben wird.
Rückfragehinweis:
Dr. Iva Březinová
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13625
iva.brezinova[@]tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Ultrakurze Laserpulse kontrollieren chemische Prozesse
Wie kann man Moleküle gezielt zerbrechen? Ein neues Experiment an der TU Wien zeigt, wie die Forschung an ultrakurzen Laserpulsen mit der Chemie verknüpft werden kann.
Ein kurzer Laserpuls trifft auf ein Molekül (hier: Butadien), das in zwei Bruchstücke zerfällt.
Apparatur für die Vermessung der im Laserpuls erzeugten Molekülfragmente
Laseroptik am Institut für Photonik der TU Wien
Chemische Reaktionen laufen so schnell ab, dass es mit herkömmlichen Methoden völlig unmöglich ist, ihren Verlauf zu beobachten oder gar zu steuern. Doch immer wieder ermöglichen neue Entwicklungen in der Elektrotechnik und der Quantentechnologie, ein genaueres Verständnis und eine bessere Kontrolle über das Verhalten von Atomen und Molekülen zu erzielen. An der TU Wien gelang es nun, mit ultrakurzen Laserpulsen Einfluss auf das Zerbrechen großer Moleküle mit bis zu zehn Atomen auszuüben.
Der Lichtblitz, der Moleküle bricht
Der Bruch eines Moleküls ist ein Beispiel für eine elementare chemische Reaktion. Molekulare Bindungen mit einem Laserpuls zu zerbrechen ist relativ einfach. Viel schwieriger ist es allerdings, den Bruch einer bestimmten Bindung gezielt zu beeinflussen, also kontrolliert herbeizuführen oder zu unterdrücken. Um das zu erreichen, muss man in die komplexen Vorgänge auf atomarer Ebene eingreifen. Am Institut für Photonik der TU Wien macht man das mit speziell geformten Laserpulsen, mit einer Dauer von nur wenigen Femtosekunden. Eine Femtosekunde (10^-15 Sekunden) ist ein Millionstel einer Milliardstelsekunde.
Schnelle Elektronen, träge Atomkerne
Ein Kohlenstoffatom hat rund 22000 mal mehr Masse als ein Elektron. Daher ist es auch verhältnismäßig träge und nicht so leicht von seinem Aufenthaltsort fortzubewegen. Ein Laserpuls kann die Bewegung der kleinen, leichten Elektronen daher viel rascher verändern als die der Atomkerne: Ein Elektron kann aus dem Molekül herausgerissen werden, dann durch das Feld des Laserpulses zum Umkehren gebracht werden und wieder mit dem Molekül zusammenstoßen. Bei diesem Zusammenstoß kann das Elektron dann zusätzlich noch ein zweites Elektron aus dem Molekül reißen. So entsteht ein doppelt geladenes Molekül, das dann unter Umständen in zwei einfach geladene Bruchstücke aufbrechen kann.
„Bis sich die Atomkerne ausreichend weit voneinander entfernen und das Molekül in zwei Teile bricht, vergehen normalerweise viele Femtosekunden“, sagt Markus Kitzler vom Institut für Photonik der TU Wien. Der Zusammenstoß des Elektrons mit dem Molekül dauert hingegen nur einige hundert Attosekunden (10^-18 Sekunden). „Wir haben es also mit zwei verschiedenen Zeitskalen zu tun“, erklärt Kitzler. „Unsere speziell geformten ultrakurzen Laserpulse beeinflussen die rasch beweglichen Elektronen. Dadurch, dass die Elektronen durch den Zusammenstoss kontrolliert in einen anderen Zustand versetzt werden, beginnen sich dann auch die großen, trägen Atomkerne zu bewegen.“
Mit dieser Technik konnte das TU-Forschungsteam nun erstmals zeigen, dass bestimmte elementare chemische Reaktionen bei verschiedenen Kohlenwasserstoffmolekülen auch kontrolliert initiiert oder unterdrückt werden können, wenn die Bewegung der Atomkerne indirekt über die viel schnelleren Elektronen beeinflusst wird. Entscheidend dafür ist die genaue Form der Laserpulse.
Die Rolle der Elektronenbewegung für die Chemie
Um die experimentellen Daten richtig deuten zu können und um zu verstehen, was bei diesen unglaublich schnellen Vorgängen auf atomarer und elektronischer Ebene eigentlich passiert, sind auch theoretische Berechnungen und Computersimulationen nötig. Diese wurden ebenfalls an der TU Wien durchgeführt – am Institut für Theoretische Physik, das mit dem Institut für Photonik in Attosekunden-Projekten zusammenarbeitet. Mit der nun vorgestellten Methode kann man nicht nur beobachten ob und wie ein Molekül zerbricht. „Die Experimente und Simulationen zeigen, wie man durch präzises Kontrollieren des Laserpulses nun auch gezielt in den Ablauf chemischer Prozesse eingreifen kann“, sagt Katharina Doblhoff-Dier vom Institut für Theoretische Physik.
Originalpublikation:
X. Xie et al.: | Attosecond-Recollision-Controlled Selective Fragmentation of Polyatomic Molecules, PRL 109, 243001 (2012).
Rückfragehinweis:
Dr. Markus Kitzler
Institut für Photonik
Technische Universität Wien
Gußhausstraße 25-29, 1040 Wien
T: +43-1-58801-38772
markus.kitzler@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Schwingende Saiten zwischen zwei Buchdeckeln
Wichtige Beiträge zur Stringtheorie leistete der verstorbene Prof. Maximilian Kreuzer an der TU Wien. Nun wird ein Buch über sein Werk präsentiert.
Maximilian Kreuzer: 1960 – 2010
Ein Schnitt durch eine 6-dimensionale Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit, dargestellt durch Einbettung in unseren 3-dimensionalen Raum.
Vor fast genau zwei Jahren starb Prof. Maximilian Kreuzer, im Alter von erst 50 Jahren. Als Grenzgänger zwischen Physik und Mathematik hinterließ er bemerkenswerte Beiträge zur Stringtheorie, die auch in Zukunft weiterleben werden – in stringtheoretischer Forschungsarbeit auf der ganzen Welt. Im Gedenken an Maximilian Kreuzer wird nun ein Buch herausgegeben, das einen Einblick in die Stringtheorie gewährt und in Kreuzers Forschungsleistungen einführt. Präsentiert wurde das Buch "Strings, Gauge Fields, and the Geometry Behind - The Legacy of Maximilian Kreuzer" bei einer prominent besetzten wissenschaftlichen Veranstaltung, dem "Vienna Central European Seminar on Particle Physics and Quantum Field Theory".
Stringtheorie: Quanten und Relativität
Mit Hilfe der Stringtheorie hofft man, eines der großen naturwissenschaftlichen Rätsel unserer Zeit zu lösen: Wie hängen Quantentheorie und Einsteins Gravitationstheorie zusammen? Kann man sie innerhalb einer einzigen, gemeinsamen Theorie verstehen? In der Stringtheorie gibt es neben den uns vertrauten drei Raumdimensionen noch sechs weitere, die allerdings nur auf winzigsten Abmessungen eine Rolle spielen.
Die Geometrie des Universums
"Max Kreuzer wurde besonders durch zwei große Leistungen bekannt", sagt sein langjähriger Weggefährte Prof. Anton Rebhan: "Erstens klassifizierte er Anomalien in Feldtheorien und Gravitation, und zweitens gelang es ihm, die sogenannten vierdimensionalen reflexiven Polyeder vollständig zu klassifizieren." Diese vierdimensionalen geometrischen Objekte spielen in der Stringtheorie eine große Rolle. Mit ihrer Hilfe lässt sich beschreiben, auf welche Weise die überzähligen, uns unzugänglichen Raumdimensionen zusammengeknüllt sind und dadurch unsichtbar bleiben. Bereits in der Antike studierte man Polyeder – doch in vier Dimensionen ist die Sache recht kompliziert: Max Kreuzer gelang es durch eigens entwickelte Computerprogramme, alle 473,800,776 vierdimensionalen reflexiven Polyeder aufzulisten und als Datenbank der Forschungs-Community zur Verfügung zu stellen.
Beiträge für das Buch "Strings, Gauge Fields, and the Geometry Behind - The Legacy of Maximilian Kreuzer" lieferten prominente Stringtheoretiker aus der ganzen Welt, die mit Maximilian Kreuzer zusammengearbeitet hatten – etwa Joseph Polchinski (USA) oder Philip Candelas (Großbritannien). Friedemann Brandt und Norbert Dragon steuern bisher unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen über die Klassifikation von Anomalien bei, TU-Dozent Harald Skarke erarbeitete gemeinsam mit anderen Weggefährten Kreuzers eine umfassende Beschreibung des Softwarepaketes PALP, das von Kreuzer und Skarke für die Klassifikation reflexiver Polyeder entwickelt wurde.
Näheres zum Buch: http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8561
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Die schnellste Stoppuhr der Welt – bald am CERN?
An der TU Wien wurde eine Methode vorgeschlagen, millionenfach kürzere Lichtblitze zu vermessen als bisher – und zwar mit Geräten, die schon in wenigen Jahren am CERN aufgebaut werden sollen.
Zwei Blei-Atome kollidieren. Dabei entsteht ein Quark-Gluon-Plasma, das ultrakurze Lichtpulse aussenden kann.
Peter Somkuti (l) und Andreas Ipp (r)
Bei der Kollision schwerer Atomkerne am CERN sollten sich die kürzesten Lichtblitze der Welt erzeugen lassen, das konnte ein Forschungsteam der TU Wien in Computersimulationen zeigen. Doch was nützen die kürzesten Lichtpulse, wenn sie zu schnell vorüber sind, um von heutigen Geräten überhaupt vermessen werden zu können? Nun wurde im Journal „Physical Review Letters“ eine Methode präsentiert, für die ultrakurzen Lichtpulse die genaueste Stoppuhr der Welt herzustellen – mit Hilfe eines Detektors, der im Jahr 2018 in die Anlage des LHC-Beschleunigers am CERN eingebaut werden soll.
Klein, kurz und heiß
Ultrakurze Lichtpulse werden verwendet, um physikalische Vorgänge zu untersuchen, die auf extrem kurzen Zeitskalen ablaufen. Mit speziellen Lasern sind heute Pulse in der Größenordnung von Attosekunden möglich – Milliardstel einer Milliardstelsekunde (10 hoch -18 Sekunden). „Bei Kern-Kollisionen in Teilchenbeschleunigern wie dem LHC am CERN oder am RHIC in den USA können aber Lichtpulse erzeugt werden, die noch einmal millionenfach kürzer sind“, sagt Andreas Ipp vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien.
Beim Experiment ALICE am CERN werden Blei-Atomkerne fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dann zur Kollision gebracht. Aus Bestandteilen der Atomkerne und vielen weiteren Teilchen, die durch die Wucht des Aufpralls direkt beim Zusammenstoß erzeugt werden, entsteht ein Quark-Gluon-Plasma – ein Materiezustand, der so heiß ist, dass selbst Protonen und Neutronen aufgeschmolzen werden. Die elementaren Bestandteile der Materie – Quarks und Gluonen – bewegen sich wirr durcheinander. Dieses Quark-Gluon-Plasma existiert nur für die unvorstellbar kurze Zeitspanne von einigen Yoktosekunden (10 hoch -24 Sekunden).
Ideen aus der Astronomie
Im Quark-Gluon-Plasma nach einer Teilchenkollision können auch Lichtblitze entstehen, in denen wertvolle Information über das Plasma steckt. Doch herkömmliche Messmethoden sind viel zu langsam, um die Blitze auf der Yoktosekunden-Zeitskala aufzulösen. „Wir greifen daher auf den Hanbury Brown-Twiss-Effekt zurück, der ursprünglich für astronomische Messungen entwickelt wurde“, erklärt Andreas Ipp.
Bei Hanbury Brown-Twiss-Experimenten werden die Daten von zwei verschiedenen Licht-Detektoren miteinander verknüpft, daraus lässt sich beispielsweise der Durchmesser eines Sterns genau berechnen. „Anstatt räumliche Abstände zu studieren kann man diesen Effekt aber ebenso nutzen, um zeitliche Abstände zu vermessen“, sagt Peter Somkuti, Dissertant an der TU Wien, der einen großen Teil der Computersimulationen durchführte. Wie die Berechnungen nun zeigen, könnten die Yoktosekunden-Pulse durch ein Hanbury Brown-Twiss-Experiment aufgelöst werden. „Das wäre experimentell zwar recht aufwändig, aber es ist machbar“, sagt Ipp. Dafür würde man gar keine teuren zusätzlichen Detektoren benötigen: Die Messungen können mit dem „Forward Calorimeter“ durchgeführt werden, das 2018 am CERN in Betrieb gehen soll. Damit würde das ALICE-Experiment zur höchstauflösenden Stoppuhr der Welt werden.
Viele offene Fragen
Die Physik des Quark-Gluon-Plasmas ist nach wie vor voller ungelöster Rätsel: Es hat eine extrem niedrige Viskosität – ist also dünnflüssiger als alle Flüssigkeiten, die wir kennen. Außerdem strebt es extrem schnell in ein thermisches Gleichgewicht, auch wenn es anfangs in einem Zustand extremen Ungleichgewichts war. Die Vermessung der Lichtpulse aus dem Quark-Gluon-Plasma könnte wichtige neue Daten liefern, um diesen Materiezustand besser zu verstehen.
In Zukunft könnten die Lichtblitze vielleicht sogar verwendet werden, um Fragestellungen aus der Kernphysik zu untersuchen. „Experimente mit zwei Lichtpulsen hintereinander sind in der Quantenphysik sehr verbreitet“, sagt Andreas Ipp. „Der erste Lichtblitz ändert den Zustand des untersuchten Objektes, der zweite wird kurz darauf verwendet, um diese Veränderung zu messen.“ Mit Yoktosekunden-Lichtpulsen könnte man diese wohlerprobte Technik in Bereichen einsetzen, die der Forschung bisher noch völlig unzugänglich waren.
Originalpublikation:
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i19/e192301
Rückfragehinweis:
Dr. Andreas Ipp
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstr. 8-10, 1040 Wien
T: +43 1 58801 13635
ipp@hep.itp.tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Der Molekül-Baukasten: Strukturen, die sich selbst zusammenbauen
Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi: Sie untersucht Partikel, die sich automatisch zu kristallartigen Strukturen zusammenfügen – ein neues Hoffnungsgebiet für die Materialforschung.
Sternförmige Kolloide: Sie können sich aneinander andocken - über "Patches", die nicht starr sind, sondern ihre Position ändern können.
Emanuela Bianchi
Geladene Polymer-Sterne bilden veränderliche Patches auf der Oberfläche von Kolloiden mit entgegengesetzter Ladung. Sie sind winzig, sie sind vielseitig, sie könnten in der Materialwissenschaft bald eine besonders wichtige Rolle spielen: „Patchy Colloids“ sind mikroskopisch kleine Partikel, die aneinander andocken und sich ganz von selbst zu komplizierten Strukturen formieren können. Nun zeichnet sich eine völlig neue Methode ab, solche Partikel herzustellen. Emanuela Bianchi forscht seit Jahren an diesem Thema, sie wurde dafür heuer mit einem Elise Richter Stipendium ausgezeichnet.
Mikroskopisch kleine Partikel docken aneinander an
Welche faszinierenden Möglichkeiten die Patchy Colloids bieten könnten, wird schon seit Jahren theoretisch untersucht. „Man kann sich diese Partikel wie winzige Kügelchen vorstellen, die an ihrer Oberfläche eine bestimmte Anzahl klebriger Andockstellen haben“, erklärt Emanuela Bianchi. Je nach Art und der Anzahl der Andockstellen (den sogenannten„Patches“), durch die sich die Partikel miteinander verbinden können und abhängig von äußeren Bedingungen können sich die Teilchen zu einer geordneten Struktur zusammenfügen – ähnlich wie einzelne Atome, die gemeinsam einen Kristall bilden.
Besonders interessant sind solche Strukturen für die Optik: „Wenn es gelingt, aus Kolloiden diamantartige Strukturen zu erzeugen, dann könnte man sogenannte photonische Kristalle herstellen“, sagt Emanuela Bianchi. Mit solchen photonischen Kristallen könnte man Lichtwellen ganz gezielt manipulieren.
Das Problem der Herstellung
Die Synthese solcher Patchy Colloids ist allerdings schwierig. Das Ausgangsmaterial dafür sind normalerweise gewöhnliche Kolloide: Partikel (in der Größe von wenigen Nano- bis Mikrometern), die in einem mikroskopischen Trägermedium fein verteilt sind, etwa die winzigen Fetttröpfchen, die Milch undurchsichtig weiß erscheinen lassen, oder die Pigmentpartikel in farbiger Tinte. Um aus kleinen Partikeln Patchy Colloids zu machen, müssen sie an ihrer Oberfläche mit Andockstellen versehen werden. „Für diesen Prozess gibt es unterschiedliche Ideen, doch sie alle haben gemeinsam, dass sie sehr aufwändig sind und nur eine recht geringe Anzahl von Patchy Colloids hervorbringen“, sagt Emanuela Bianchi.
Sternförmige Moleküle
Doch wenn sich Kolloide durch Selbstorganisation zu großen kristallartigen Strukturen zusammenfügen können – warum sollte man dann das Prinzip der Selbstorganisation nicht auch benutzen können, um die winzigen Kolloide selbst zu erzeugen? Gemeinsam mit Barbara Capone von der Fakultät für Physik der Universität Wien forscht Bianchi nun an sogenannten Stern-Polymeren. Diese Strukturen bestehen aus vielen einzelnen Molekülketten, die sternförmig von der Mitte nach außen ragen. Wenn man Molekülketten mit passenden chemischen Eigenschaften wählt, dann fügen sie sich ganz von selbst zu Bündeln mit klebrigen Endpunkten zusammen. So werden sie zu Patchy Colloids, ohne dass man ihre Oberfläche von außen speziell manipulieren müsste.
Wie sich diese Polymerketten aneinanderkleben und wie die sternförmigen Strukturen zu diesen speziellen Kolloidteilchen werden, wird nun in Computersimulationen untersucht.
Diese neue Klasse von Patchy Colloids weist zwei spezielle Charakteristika auf: Im Gegensatz zu traditionellen Patchy Colloids sind die Teilchen nunmehr weich - sie können also in einem erheblichen Ausmaß überlappen - und die Patches sind in ihren Positionen nicht mehr fixiert - sie können also aus ihrer Gleichgewichtslage ausgelenkt werden. “Die Konsequenzen dieser neuen Eigenschaften könnten bei der Bildung kristalliner Strukturen sehr wichtig sein“, sagt Emanuela Bianchi. Das Gesamtproblem muss also auf unterschiedlichen Längenskalen betrachtet werden – von der molekularen Ebene bis hin zu makroskopischen Abmessungen. Das ist zwar wissenschaftlich höchst kompliziert, doch die Aussicht auf eine ganze Klasse neuartiger Materialien lässt die große Mühe heute jedenfalls lohnenswert erscheinen.
Elise Richter Stipendium für Emanuela Bianchi
Emanuela Bianchi wird ihre Forschung in den nächsten Jahren, finanziert durch das Elise Richter Stipendium des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, in der Arbeitsgruppe „Soft Matter Theory“ des Instituts für Theoretische Physik der TU Wien fortsetzen. Mit diesem Stipendium möchte der FWF junge Wissenschaftlerinnen an eine internationale akademische Karriere heranführen.
Mehr über Patchy Colloids: http://www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/7657
Rückfragehinweis:
Dr. Emanuela Bianchi
Institut für Theoretische Physik
Technische Universität Wien
emanuela.bianchi@tuwien.ac.at
T: +43-1-58801-13631
http://smt.tuwien.ac.at/index.html
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Nano-Hillocks: Wenn statt Löchern Berge wachsen
Elektrisch geladene Teilchen dienen als Werkzeug für die Nanotechnologie. Die TU Wien und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf konnten nun wichtige Fragen über die Wirkung von Ionen auf Oberflächen klären.
Robert Ritter am Atomkraftmikroskop
Kalziumfluorid-Oberfläche, beschossen mit Xenon-Ionen. Nach dem Ätzen werden dreieckige Löcher sichtbar (oben).
Niedrig geladene Ionen (links oben) führen nur zu kleinen Defekten in der Oberfläche, höher geladene Ionen stören das Material so stark, dass Teile weggeätzt werden können (Mitte) und hochgeladene Ionen tragen so viel Energie, dass das Material lokal aufgeschmolzen wird und Hügel ausbildet (unten rechts).
Prof. Aumayrs Geburtstagstorte: Die Y-förmige Figur links trennt den Energiebereich, der nicht zu sichtbaren Veränderungen führt (links) vom Bereich, in dem Löcher sichtbar werden (oben) und dem Bereich, in dem Nano-Hillocks entstehen (rechts).
Ionenstrahlen werden schon lange eingesetzt um Oberflächen zu manipulieren. An der TU Wien werden Ionen mit so hoher Energie untersucht, dass bereits ein einziges der Teilchen drastische Veränderungen auf der damit beschossenen Oberfläche hervorruft. Nach aufwändigen Forschungen konnte nun erklärt werden, warum sich dabei manchmal Einschusskrater, in anderen Fällen hingegen Erhebungen bilden. Die Untersuchungen wurden kürzlich im Fachjournal "Physical Review Letters" publiziert.
Ladung statt Wucht
"Will man möglichst viel Energie auf einem kleinen Punkt der Oberfläche einbringen, bringt es wenig, die Oberfläche einfach mit besonders schnellen Atomen zu beschießen", erklärt Prof. Friedrich Aumayr vom Institut für Angewandte Physik der TU Wien. "Schnelle Teilchen dringen tief in das Material ein und verteilen ihre Energie daher über einen weiten Bereich."
Wenn man den einzelnen Atomen allerdings zuerst viele Elektronen entreißt und die hochgeladenen Teilchen dann mit der Materialoberfläche kollidieren lässt, sind die Auswirkungen dramatisch: Die Energie, die man vorher aufwenden musste um die Atome zu ionisieren wird dann in einer Region von wenigen Nanometern Durchmesser freigesetzt.
Das kann bewirken, dass ein winziger Bereich des Materials schmilzt, seine geordnete atomare Struktur verliert und sich ausdehnt. Das Resultat sind sogenannte Nano-Hillocks, kleine Hügel auf der Materialoberfläche. Die hohe elektrische Ladung, die in Form des Ions in das Material eingebracht wird, hat einen starken Einfluss auf die Elektronen des Materials. Das führt dazu, dass sich die Atome aus ihren Plätzen lösen. Reicht die Energie nicht aus um das Material lokal zum Schmelzen zu bringen, können zwar keine Nano-Hillocks, aber kleine Löcher in der Oberfläche entstehen.
Um so ein detailliertes Bild von den Vorgängen an der Materialoberfläche zu bekommen, waren nicht nur aufwändige Experimente sondern auch Computersimulationen und theoretische Arbeit nötig. Friedrich Aumayr und sein Dissertant Robert Ritter arbeiteten daher eng mit Prof. Joachim Burgdörfer, Christoph Lemell und Georg Wachter vom Institut für Theoretische Physik der TU Wien zusammen. Die Experimente wurden in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf durchgeführt.
Potentielle und Kinetische Energie
"Wir haben zwei verschiedene Formen von Energie zur Verfügung", erklärt Friedrich Aumayr: "Einerseits die potentielle Energie der Ionen, die sie aufgrund ihrer elektrischen Ladung besitzen, andererseits die Bewegungsenergie, die sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit haben." Abhängig von diesen beiden Energie-Größen hinterlassen die Ionen unterschiedliche Spuren auf der Oberfläche.
Lange Zeit schien die Vorstellung, die man von diesen Prozessen hatte allerdings nicht so recht mit den Messungen übereinzustimmen. Verschiedene Materialien schienen sich unter Ionenbeschuss ganz unterschiedlich zu verhalten, manchmal war überhaupt keine Veränderung der Oberfläche zu sehen, auch wenn man eigentlich deutliche Löcher erwartet hätte.
Säure macht Oberflächen-Verletzungen sichtbar
"Das Rätsel konnte allerdings gelöst werden, in dem wir die Oberflächen kurz mit Säure behandelten", sagt Friedrich Aumayr. "Dabei zeigte sich, dass manche Oberflächen durch den Ionenbeschuss zwar verändert worden waren, die Atome hatten sich aber noch nicht völlig von der Oberfläche gelöst. Die mit einem Atomkraftmikroskop erstellten Bilder zeigten daher keine Veränderung." Durch Säurebehandlung wurden genau diese getroffenen Stellen allerdings viel stärker angegriffen als die feste, unverletzte Struktur – die Löcher wurden sichtbar.
Vermutung bestätigt
"Für uns war das der letzte große Puzzlestein für das Verständnis der Wechselwirkung zwischen den Ionen und der Oberfläche", sagt Aumayr. "Durch die Untersuchung mit Hilfe der Säure können wir nun viel besser nachweisen, bei welchen Energien die Oberfläche wie stark verändert wird – damit ergibt sich für uns nun endlich ein geschlossenes Bild." Das Entstehen der Hillocks hängt stark vom Ladungszustand, aber kaum von der Geschwindigkeit der Ionen-Geschoße ab. Das Auftreten von Löchern hingegen wird maßgeblich durch die Bewegungsenergie der Ionen bestimmt. "Vermutet hatten wir das schon lange. Meine Studenten haben mir sogar vor drei Jahren schon eine Geburtstagstorte geschenkt, die genau diesen Zusammenhang darstellte – in Schokolade und Zuckerguss", verrät Aumayr. Damals war das noch Spekulation – doch nun, nach aufwändigen Messungen, wurde ein beinahe identisches Diagramm im Fachjournal "Physical Review Letters" publiziert.
Publikation: A.S. El-Said, R.A. Wilhelm, R. Heller, S. Facsko, C. Lemell, G. Wachter, J. Burgdörfer, R. Ritter, F. Aumayr: | Phase diagram for nanostructuring CaF2 surfaces by slow highly charged ions, Physical Review Letters 109 (2012) 117602 (5 pages)
Rückfragehinweis:
Prof. Friedrich Aumayr
Institut für Angewandte Physik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8, 1040 Wien
T: +43-1-58801-13430
friedrich.aumayr@tuwien.ac.at
Autor:
Dr. Florian Aigner
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Technische Universität Wien
florian.aigner@tuwien.ac.at
Neues Center für atomistische Simulationen in Wien
Kooperation zwischen Universität Wien, Technischer Universität Wien und Universität für Bodenkultur
Simulationsschnappschuss eines Kristalls, gebildet aus 192 Polymerketten: Die jeweils 10 solvophilen („lösungsmittelliebenden“) Teilchen sind weiß, die jeweils 10 solvophoben („lösungsmittelmeidenden“) Teilchen sind grün gefärbt; Bindungen zwischen den Monomeren sind durch Stäbchen dargestellt.
Am kommenden Freitag, 14. September 2012, wird das "Danube Center for Atomistic Modelling" (DaCAM) in Wien eröffnet, das sich atomistischen und molekularen Simulationen in Forschung und Ausbildung widmet. Dieses Center bildet den 14. Knoten eines europäischen Netzwerkes (CECAM), der von der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur sowie dem "Center for Computational Materials Science" getragen wird. Ziel ist es, die wissenschaftliche Exzellenz der Wiener Forschungsgruppen auf diesem Gebiet zu bündeln und damit zu stärken. Darüber hinaus ermöglicht die geographische Lage Wiens einen wissenschaftlichen Brückenschlag zu Forschungsgruppen in zentral- und osteuropäischen Ländern.
Das "Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire" (CECAM) ist ein europäisches Netzwerk, das sich seit mehr als 50 Jahren intensiv der Grundlagenforschung von atomistischen und molekularen Simulationsmethoden und deren Anwendungen in wissenschaftlichen und technologischen Problemstellungen widmet. Innerhalb des europäischen Netzwerkes können die wissenschaftlichen Institutionen nationale CECAM-Knoten errichten. Somit werden die jährlich knapp 100 wissenschaftlichen Aktivitäten des CECAM (Tutorien, Workshops, Schulen, Diskussionsforen) dezentral an den mittlerweilen 14 nationalen Knoten durchgeführt.
Wien als weltweit führendes Zentrum der computerunterstützen Materialwissenschaften
Wiener Forschungsgruppen können auf eine lange und überaus erfolgreiche Tradition in atomistischen und molekularen Simulationen zurückblicken. Dabei reicht das thematische Spektrum von der Festkörperphysik über die Weiche Materie bis hin zur Chemie und Molekularbiologie. Beachtliche methodische Entwicklungen und deren Anwendungen in der akademischen und industriellen Forschung haben dazu beigetragen, dass Wien nunmehr zu den weltweit führenden Zentren der computerunterstützen Materialwissenschaften gehört. Um diese Expertise zu bündeln und sie im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstaltungen besser verbreiten zu können, haben Forschungsgruppen der Universität Wien, der Technischen Universität Wien und der Universität für Bodenkultur in Zusammenarbeit mit dem "Center for Computational Materials Science" die Initiative zur Schaffung eines Wiener CECAM-Knotens ergriffen.
Durch den neuen DaCAM-Knoten können die wissenschaftlichen Aktivitäten von Wiener Forschungsgruppen im Bereich der atomistischen Simulationen akkordiert und somit gestärkt werden; eine Tatsache, die zu einer verbesserten internationalen Sichtbarkeit des Forschungsstandortes Wien beiträgt. Darüber hinaus ermöglichen die geplanten wissenschaftlichen Veranstaltungen die direkte Weitergabe der vorhandenen Expertise – ein wichtiger Beitrag im Rahmen der Ausbildung zukünftiger Wissenschafter. Schließlich sollen über das Wiener Center gezielt Kontakte mit verwandten Arbeitsgruppen in den zentral- und osteuropäischen Ländern gefördert werden.
Ein Workshop zum Thema "Design of self-assembling materials", der letzte Woche an der Universität Wien stattgefunden hat, und eine Sommerschule zum Thema "Bandstructure meets many-body theory", die kommende Woche an der Technischen Universität abgehalten wird, stellen die ersten wissenschaftlichen Veranstaltungen des jüngsten CECAM-Knotens in Wien dar. Für die Eröffnungsveranstaltung des DaCAM-Knotens konnten mit Wilfred F. van Gunsteren (ETH Zürich), Kurt Binder (JGU Mainz) und Jürgen Kübler (TU Darmstadt) drei hochkarätige Vortragende gewonnen werden.
Eröffnung des DaCAM-Knotens:
Zeit: Freitag, 14. September 2012, 13:30 Uhr
Ort: Kuppelsaal der Technischen Universität Wien,
Karlsplatz 13,
1040 Wien
Programm
Anmeldung erbeten: gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Nähere Informationen:
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Kahl
Direktor des DaCAM-Knotens
Institut für Theoretische Physik
Center for Computational Materials Science
Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
T: +43-1-58801-13632
gerhard.kahl@tuwien.ac.at
Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Dellago
Österreichischer Vertreter im CECAM
Fakultät für Physik
Center for Computational Materials Science
Universität Wien
1090 Wien, Boltzmanngasse 5
T: +43-1-4277-512 60
christoph.dellago@univie.ac.at
Das Institut für Theoretische Physik trauert um sein früheres Mitglied,
wiss. Oberrat Dipl.-Ing. Dr. Gerhard ADAM
(8.12.1932 - 30.12.2012)